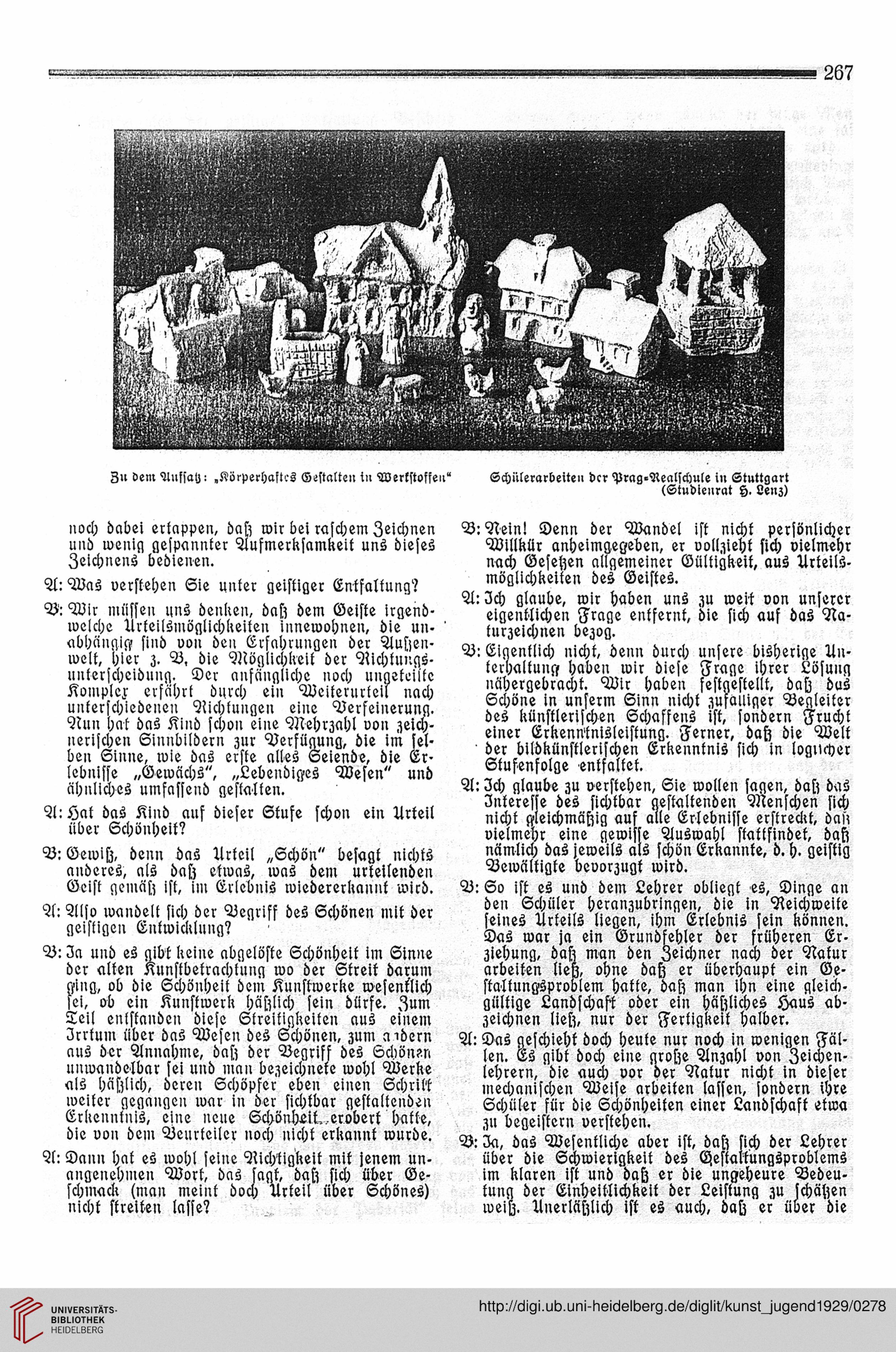267
Zu dem A»ssast: .Körperhastcs Eestalte» in Wsrkstofse»" SchiUerarbeite» dcr Prag-Realschule i» Stuttgart
(Studieurat H. Leuz)
noch dcibei ertappen, dnß wir bei raschem Zeichnen
unü wenist gespannter Aufmerksamkelt uns dieses
Zeichnens bedienen.
A:Was verskehen Sie unter geistiger Entfaltung?
B: Wir miissen uns denken, das; dem Geiste irgend-
welche Urteilsmöglichkeiten innewohnen, die un-
abhnngiff sind von den Erfnhrungen der Aus>en-
welt, hier z. B, die Möglichkeit der Aichkungs-
unterscheidung. Der nnsängliche noch ungrteilke
Komplep erfnhrt durch ein Weiterurkeil nach
unkerschiedenen Richkungen eine Verfeinerung.
Nun hnt das Kind schon eine Mehrzahl von zeich-
»erischen Sinnbildern zur Berfügung, die im sel-
ben Sinne, wie dns erste nlles Seiende, die Er-
lebnisse „Gewächs", „Lebendiges Wesen" und
ähnliches umfassend gestalken.
A:Hat das Kind nuf dieser Stufe schon ein Urteil
über Schönheik?
B: Gewiß, denn dns Ilrkeil „Schön" besagt nichts
nnderes, nls dasz etwns, was dem urtetlenden
Geist gemäs, ist, im Lrlebnis wiedererknnnk wicd.
A: Also wandelt sich der Begriff des Schönen mit der
geistigen Enkwicklung?
B: 2n und es gibt keine nbgelöste Schönhett Im Sinne
der alken Kunstbetrnchtung wo der Streit darum
ging, ob die Schönheik dem Kunstwerke wesenklich
sei, ob ein Kunstwerk häszlich sein dürfe. Zum
Teil entstnnden diese Skreikigkeiten nus einem
2rrkum über dns Wesen deS Schönen, zum n idern
nus der Annahme, dajz der Begriff des Schönen
unwandelbar sei und mnn bezeichneke wohl Werke
als häszlich, deren Schöpfer eben einen Schritt
weiker gegnngen war in dor sichtbar gestaltenden
Erkenntnis, eine neue Schönheit.wrobert hntte,
die von dem Äeurteiler noch nicht erkannt wurüe.
A: Dann hnl es wohl seine Richtigkeit mit jenem un-
angenehmen Wort, dns tagk, dasz sich über Ge-
schmack <man meint doch Urkeil über Schönes)
nichk skreiten lasse?
B:Nein! Denn der Wandel ist nichk persönlicher
Millkür anheimgegeben, er vollzieht sich vielmehr
nach Gesehen allgemeiner Gllltigkeit, aus Urteils-
möglichkeiten des Geistes.
A:3ch glaube, wir haben uns zu weit von unserer
eigentlichen Frage entfernt, die sich auf üas Na-
turzeichnen bezog.
B: Einentlich nicht, denn durch unsere bisherige Iln-
kerhalkunsf haben wir diese Frage ihrer Lösung
nähergebracht. Wir haben festaestellt, dajz dus
Schöne in unserm Sinn nicht zufcuiiger Begleiter
des künstlerischen Schaffens ist, sondern Frucht
einer Erkenntnisleistung. Ferner, daß die Welt
der bildkünstlerischen Erkennknis sich in logiicher
Stusenfolge -entfaltet.
A: llch glaube zu verstehen, Sie wollen sagen, dasz daS
llnkeresse des sichtbar gestaltenden Menschen sich
nicht gleichmässig auf alle Erlebnisse erstreckt, daü
vieimehr eine gewisse Auswahl stattfindet, daß
nämliä) das jeweils als schön Erkannte, d. h. geistig
Vewälkigte bevorzugt wird.
B: So ist es und dem Lehrer obliegt es, Dinge an
den Schüler heranzubringen, die !n Reichweite
seines Arteils liegen, ihm Erlebnis sein können.
Das war ja ein Grundfehler der früheren Er-
zjehung, daß man den Zeichner nach der Nakur
arbeiten ließ, ohne daß er überhaupt ein Gp-
stalkungsprobiem hatke, daß man ihn eine gleicb-
gültige Landschast oder ein häszliches Haus ab-
zeichnen ließ, nur der Fertigkeit halber.
A: Das geschieht doch heute nur noch in wenigen Fäl-
len. Es gibt doch eine grosze Anzahl von Zeichen-
lehrern, die auch vor der Natur nicht in dieser
mechanischen Weise arbeiten lassen, sondern ihre
Schlller für die Schönheiten einer Landschaft etwa
zu begeistern verstehen.
B: 2a, das Wesentliche aber ist, dasz sich der Lehrer
über die Schwierigkeit des Gestattungsproblems
im klaren ist und daß er die ungeheure Bedeu-
kung der Einheitlichkeit der Leistung zu Ichäszen
weisz. Unerläszlich ist es auch, daß er über die
Zu dem A»ssast: .Körperhastcs Eestalte» in Wsrkstofse»" SchiUerarbeite» dcr Prag-Realschule i» Stuttgart
(Studieurat H. Leuz)
noch dcibei ertappen, dnß wir bei raschem Zeichnen
unü wenist gespannter Aufmerksamkelt uns dieses
Zeichnens bedienen.
A:Was verskehen Sie unter geistiger Entfaltung?
B: Wir miissen uns denken, das; dem Geiste irgend-
welche Urteilsmöglichkeiten innewohnen, die un-
abhnngiff sind von den Erfnhrungen der Aus>en-
welt, hier z. B, die Möglichkeit der Aichkungs-
unterscheidung. Der nnsängliche noch ungrteilke
Komplep erfnhrt durch ein Weiterurkeil nach
unkerschiedenen Richkungen eine Verfeinerung.
Nun hnt das Kind schon eine Mehrzahl von zeich-
»erischen Sinnbildern zur Berfügung, die im sel-
ben Sinne, wie dns erste nlles Seiende, die Er-
lebnisse „Gewächs", „Lebendiges Wesen" und
ähnliches umfassend gestalken.
A:Hat das Kind nuf dieser Stufe schon ein Urteil
über Schönheik?
B: Gewiß, denn dns Ilrkeil „Schön" besagt nichts
nnderes, nls dasz etwns, was dem urtetlenden
Geist gemäs, ist, im Lrlebnis wiedererknnnk wicd.
A: Also wandelt sich der Begriff des Schönen mit der
geistigen Enkwicklung?
B: 2n und es gibt keine nbgelöste Schönhett Im Sinne
der alken Kunstbetrnchtung wo der Streit darum
ging, ob die Schönheik dem Kunstwerke wesenklich
sei, ob ein Kunstwerk häszlich sein dürfe. Zum
Teil entstnnden diese Skreikigkeiten nus einem
2rrkum über dns Wesen deS Schönen, zum n idern
nus der Annahme, dajz der Begriff des Schönen
unwandelbar sei und mnn bezeichneke wohl Werke
als häszlich, deren Schöpfer eben einen Schritt
weiker gegnngen war in dor sichtbar gestaltenden
Erkenntnis, eine neue Schönheit.wrobert hntte,
die von dem Äeurteiler noch nicht erkannt wurüe.
A: Dann hnl es wohl seine Richtigkeit mit jenem un-
angenehmen Wort, dns tagk, dasz sich über Ge-
schmack <man meint doch Urkeil über Schönes)
nichk skreiten lasse?
B:Nein! Denn der Wandel ist nichk persönlicher
Millkür anheimgegeben, er vollzieht sich vielmehr
nach Gesehen allgemeiner Gllltigkeit, aus Urteils-
möglichkeiten des Geistes.
A:3ch glaube, wir haben uns zu weit von unserer
eigentlichen Frage entfernt, die sich auf üas Na-
turzeichnen bezog.
B: Einentlich nicht, denn durch unsere bisherige Iln-
kerhalkunsf haben wir diese Frage ihrer Lösung
nähergebracht. Wir haben festaestellt, dajz dus
Schöne in unserm Sinn nicht zufcuiiger Begleiter
des künstlerischen Schaffens ist, sondern Frucht
einer Erkenntnisleistung. Ferner, daß die Welt
der bildkünstlerischen Erkennknis sich in logiicher
Stusenfolge -entfaltet.
A: llch glaube zu verstehen, Sie wollen sagen, dasz daS
llnkeresse des sichtbar gestaltenden Menschen sich
nicht gleichmässig auf alle Erlebnisse erstreckt, daü
vieimehr eine gewisse Auswahl stattfindet, daß
nämliä) das jeweils als schön Erkannte, d. h. geistig
Vewälkigte bevorzugt wird.
B: So ist es und dem Lehrer obliegt es, Dinge an
den Schüler heranzubringen, die !n Reichweite
seines Arteils liegen, ihm Erlebnis sein können.
Das war ja ein Grundfehler der früheren Er-
zjehung, daß man den Zeichner nach der Nakur
arbeiten ließ, ohne daß er überhaupt ein Gp-
stalkungsprobiem hatke, daß man ihn eine gleicb-
gültige Landschast oder ein häszliches Haus ab-
zeichnen ließ, nur der Fertigkeit halber.
A: Das geschieht doch heute nur noch in wenigen Fäl-
len. Es gibt doch eine grosze Anzahl von Zeichen-
lehrern, die auch vor der Natur nicht in dieser
mechanischen Weise arbeiten lassen, sondern ihre
Schlller für die Schönheiten einer Landschaft etwa
zu begeistern verstehen.
B: 2a, das Wesentliche aber ist, dasz sich der Lehrer
über die Schwierigkeit des Gestattungsproblems
im klaren ist und daß er die ungeheure Bedeu-
kung der Einheitlichkeit der Leistung zu Ichäszen
weisz. Unerläszlich ist es auch, daß er über die