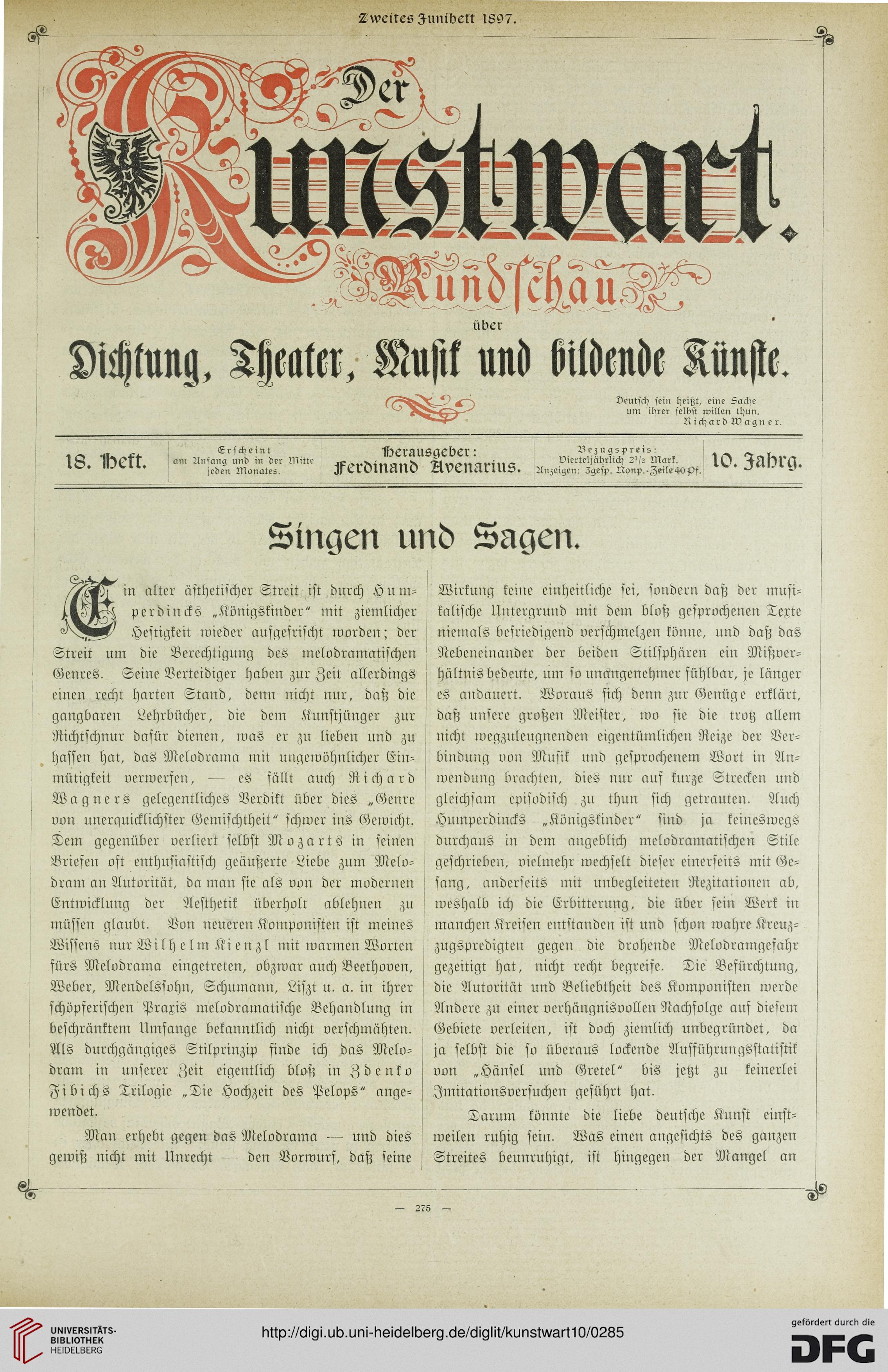Lwettes Aunibekt lS97
über
DiGung, WM, Mfil uni> bilScniik Mnstc
18. Dett.
Derausgeber:
zferdmand Nvenarius.
Bkzugspreis:
vicrtcljähriich 2'/s Mark.
w. Zabt-g.
Singen llnd Lugen.
.,in alter ästhetischer Ttreit ist durch H u m-
, perdincks „Köuigskiuder" mit Ziemlicher
Hestigkeit wieder ausgefrischt worden; der
Streit um die Berechtiguug des melodramatischen
Genres. Seiue Vertcidiger haben Zur Zeit allerdings
eineu recht harten Stand, denn nicht nur, daß die
gangbaren Lehrbücher, die dem Kunstjünger Zur
Richtschnur dasür dienen, was er zu liebeu und zu
hassen hat, das Melodrama mit ungewöhnlicher Ein-
mütigkeit verwersen, — es sällt auch Richard
Wagners gelegentliches Verdikt über dies „Genre
von unerquicklichster Gemischtheit" schwer ins Genucht.
Dem gegenüber verliert selbst Mozarts in seinen
Briesen oft enthusiastisch geäußerte Liebe Zum Meto-
dram an Autorität, da man sie als von der modernen
Entwicklung der Aesthetik überholt ablehnen zu
müssen glaubt. Von neueren Komponisten ist meines
Wissens nur Wilhelm Kienzl mit warmen Worten
sürs Melodrama eingetreten, obzwar auch Beethoven,
Weber, Mendelssohn, Schumann, Liszt u. a. in ihrer
schöpserischen Praxis melodramatische Behandlung in
beschränktem Umfange bekanntlich nicht verschmähten.
Als durchgängiges Stilprinzip sinde ich das Melo-
dram in unserer Zeit eigentlich bloß in Zdenko
Fibichs Trilogie „Die Hochzeit des Pelops" ange-
wendet.
Man erhebt gegen das Melodrama — und dies
gewiß nicht mit Unrecht — den Vorwurf, daß seine
Wirkung kcine einheitliche sei, sondern daß der musi-
kalische Untergrund mit dem bloß gesprochenen Texte
niemals besriedigend verschmelzen könne, und daß das
Nebeneinander der beiden Stilsphären ein Mißver-
hältnis bedeute, um so unangenehmer sühlbar, je länger
es andauert. Woraus sich denn zur Genüge erklärt,
daß unsere großen Meister, wo sie die trotz allem
nicht wegzuleugnenden eigentümlichen Reize der Ver-
bindung von Musik und gesprochenem Wort in An-
wendung brachten, dies nur aus kurze Strecken und
gleichsam cpisodisch zu thun sich getrauten. Auch
Humperdincks „Königskinder" sind ja keineswegs
durchaus in dem angeblich melodramatischen Stile
geschrieben, vielmehr wechselt dieser einerseits mit Ge-
sang, anderseits mit unbegleiteten Rezitationen ab,
weshalb ich die Erbitterung, die über sein Werk in
manchen Kreisen entstanden ist und schon wahre Kreuz-
zugspredigten gegen die drohende Melodramgesahr
gezeitigt hat, nicht recht begreife. Die Befürchtung,
die Autorität und Beliebtheit des Komponisten werde
Andere zu einer verhängnisvollen dlachfolge aus diesem
Gebiete verleiten, ist doch ziemlich unbegründet, da
ja selbst die so überaus lockende Aufführungsstatistik
von „Hänsel und Gretel" bis jetzt zu keinerlei
Jmitationsversuchen gesührt hat.
Darum könnte die liebe deutsche Kunst einst-
weilen ruhig sein. Was einen angesichts des ganzen
Streites beunruhigt, ist hingegen der Mangel an
275
über
DiGung, WM, Mfil uni> bilScniik Mnstc
18. Dett.
Derausgeber:
zferdmand Nvenarius.
Bkzugspreis:
vicrtcljähriich 2'/s Mark.
w. Zabt-g.
Singen llnd Lugen.
.,in alter ästhetischer Ttreit ist durch H u m-
, perdincks „Köuigskiuder" mit Ziemlicher
Hestigkeit wieder ausgefrischt worden; der
Streit um die Berechtiguug des melodramatischen
Genres. Seiue Vertcidiger haben Zur Zeit allerdings
eineu recht harten Stand, denn nicht nur, daß die
gangbaren Lehrbücher, die dem Kunstjünger Zur
Richtschnur dasür dienen, was er zu liebeu und zu
hassen hat, das Melodrama mit ungewöhnlicher Ein-
mütigkeit verwersen, — es sällt auch Richard
Wagners gelegentliches Verdikt über dies „Genre
von unerquicklichster Gemischtheit" schwer ins Genucht.
Dem gegenüber verliert selbst Mozarts in seinen
Briesen oft enthusiastisch geäußerte Liebe Zum Meto-
dram an Autorität, da man sie als von der modernen
Entwicklung der Aesthetik überholt ablehnen zu
müssen glaubt. Von neueren Komponisten ist meines
Wissens nur Wilhelm Kienzl mit warmen Worten
sürs Melodrama eingetreten, obzwar auch Beethoven,
Weber, Mendelssohn, Schumann, Liszt u. a. in ihrer
schöpserischen Praxis melodramatische Behandlung in
beschränktem Umfange bekanntlich nicht verschmähten.
Als durchgängiges Stilprinzip sinde ich das Melo-
dram in unserer Zeit eigentlich bloß in Zdenko
Fibichs Trilogie „Die Hochzeit des Pelops" ange-
wendet.
Man erhebt gegen das Melodrama — und dies
gewiß nicht mit Unrecht — den Vorwurf, daß seine
Wirkung kcine einheitliche sei, sondern daß der musi-
kalische Untergrund mit dem bloß gesprochenen Texte
niemals besriedigend verschmelzen könne, und daß das
Nebeneinander der beiden Stilsphären ein Mißver-
hältnis bedeute, um so unangenehmer sühlbar, je länger
es andauert. Woraus sich denn zur Genüge erklärt,
daß unsere großen Meister, wo sie die trotz allem
nicht wegzuleugnenden eigentümlichen Reize der Ver-
bindung von Musik und gesprochenem Wort in An-
wendung brachten, dies nur aus kurze Strecken und
gleichsam cpisodisch zu thun sich getrauten. Auch
Humperdincks „Königskinder" sind ja keineswegs
durchaus in dem angeblich melodramatischen Stile
geschrieben, vielmehr wechselt dieser einerseits mit Ge-
sang, anderseits mit unbegleiteten Rezitationen ab,
weshalb ich die Erbitterung, die über sein Werk in
manchen Kreisen entstanden ist und schon wahre Kreuz-
zugspredigten gegen die drohende Melodramgesahr
gezeitigt hat, nicht recht begreife. Die Befürchtung,
die Autorität und Beliebtheit des Komponisten werde
Andere zu einer verhängnisvollen dlachfolge aus diesem
Gebiete verleiten, ist doch ziemlich unbegründet, da
ja selbst die so überaus lockende Aufführungsstatistik
von „Hänsel und Gretel" bis jetzt zu keinerlei
Jmitationsversuchen gesührt hat.
Darum könnte die liebe deutsche Kunst einst-
weilen ruhig sein. Was einen angesichts des ganzen
Streites beunruhigt, ist hingegen der Mangel an
275