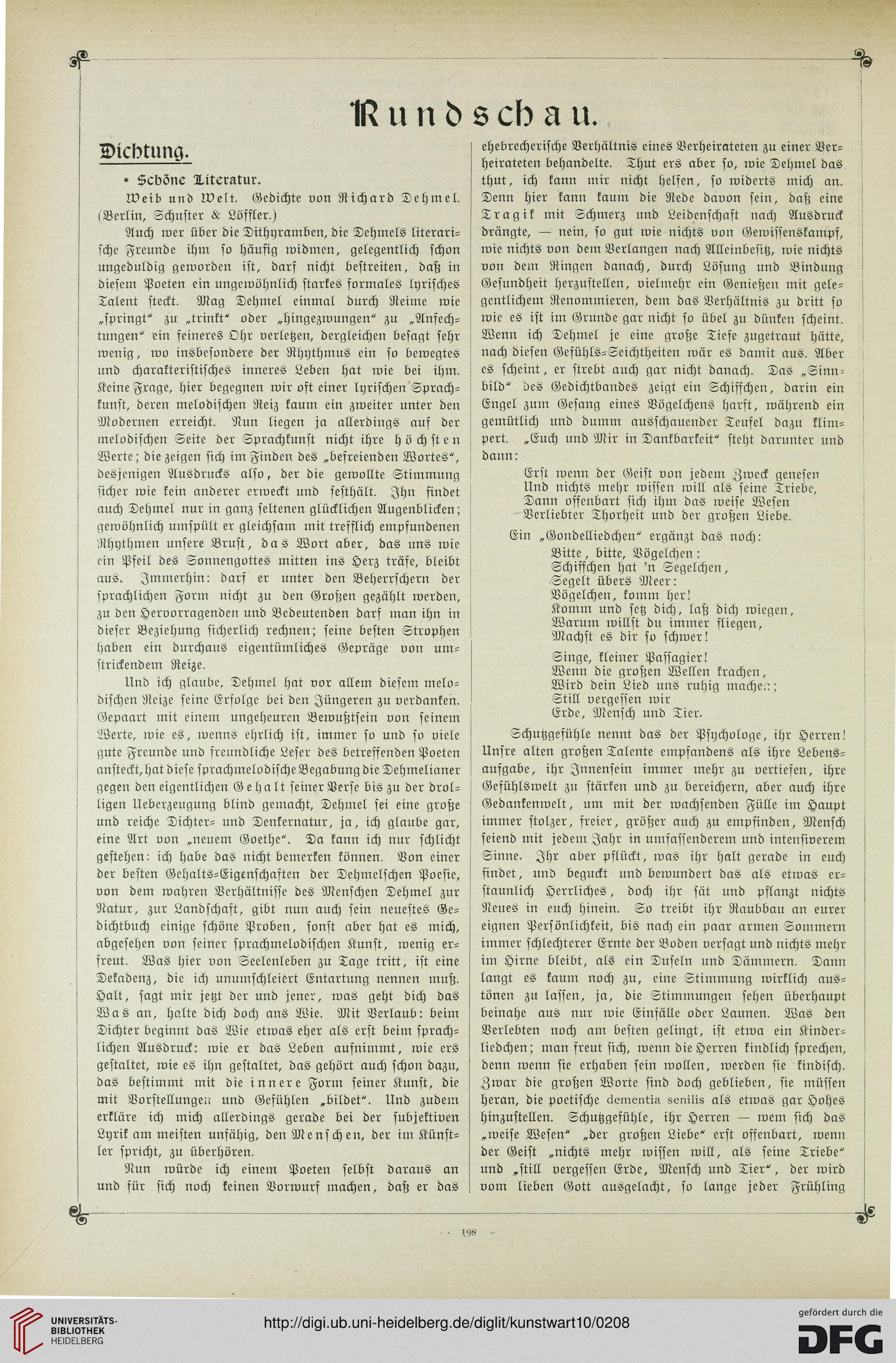1K u n d sck 3 u.
DLcbtung.
Scböne Literatur.
weib und welt. Gedichte von Richard Dehmel.
lBerlin, Schuster L Löffler.)
Auch wer über die Dithyramben, die Dehmels literari-
fche Freunde ihm so häufig widmen, gelegentlich schon
ungeduldig geworden ist, darf nicht bestreiten, daß in
diesem Poeten ein ungewöhnlich starkes formales lyrisches
Talent steckt. Mag Dehmel einmal durch Reime wie
„springt" zu „trinkt" oder „hingezwungen" zu „Anfech-
tungen" ein feineres Ohr verletzen, dergleichen besagt sehr
wenig, wo insbesondere der Rhythmus ein so bewegtes
und charakteristisches inneres Leben hat wie bei ihm.
Keine Frage, hier begegnen wir oft einer lyrischen Sprach-
kunst, deren melodischen Reiz kaum ein zweiter unter den
Modernen erreicht. Nun liegen ja allerdings auf der
melodischen Seite der Sprachkunst nicht ihre höchsten
Werte; die zeigen sich im Finden des „befreienden Wortes",
desjenigen Ausdrucks also, der die gewollte Stimmung
sicher wie kein anderer erweckt und sesthält. Jhn findet
auch Dehmel nur in ganz seltenen glücklichen Augenblicken;
gewöhnlich umspült er gleichsam mit trefflich empfundenen
Rhythmen unsere Brust, das Wort aber, das uns wie
ein Pfeil des Sonnengottes mitten ins Herz träfe, bleibt
aus. Jmmerhin: darf er unter den Beherrschern der
sprachlichen Form nicht zu den Großen gezählt werden,
zu den Hervorragenden und Bedeutenden darf man ihn in
dieser Beziehung sicherlich rechnen; seine besten Strophen
haben ein durchaus eigentümliches Gepräge von um-
strickendem Reize.
Und ich glaube, Dehmel hat vor allem diesem melo-
dischen Reize seine Erfolge bei den Jüngeren zu verdanken.
Gepaart mit einem ungeheuren Bewußtsein von seinem
Werte, wie es, wenns ehrlich ist, immer so und so viele
gute Freunde uud freundliche Leser des betreffenden Poeten
ansteckt,hat diese sprachmelodischeBegabung die Dehmelianer
gegen den eigentlichen Gehalt seiner Verse bis zu der drol-
ligen Ueberzeugung blind gemacht, Dehmel sei eine große
und reiche Dichter- und Denkernatur, ja, ich glaube gar,
eine Art von „neuem Goethe". Da kann ich nur schlicht
gestehen: ich habe das nicht bemerken können. Von einer
der besten Gehalts-Eigenschaften der Dehmelschen Poesie,
von dem wahren Verhältnisse des Menschen Dehmel zur
Natur, zur Landschaft, gibt nun auch sein neuestes Ge-
dichtbuch einige schöne Proben, sonst aber hat es mich,
abgesehen von seiner sprachmelodischen Kunst, wenig er-
freut. Was hier von Seelenleben zu Tage tritt, ist eine
Dekadenz, die ich unumschleiert Entartung nennen muß.
Halt, sagt mir jetzt der und jener, was geht dich das
Was an, halte dich doch ans Wie. Mit Verlaub: beim
Dichter beginnt das Wie etwas eher als erst beim sprach-
lichen Ausdruck: wie er das Leben aufnimmt, wie ers
gestaltet, wie es ihn gestaltet, das gehört auch schon dazu,
das bestimmt mit die innere Form seiner Kunst, die
mit Vorstellungeu und Gefühlen „bildet". Und zudem
erkläre ich mich allerdings gerade bei der subjektiven
Lyrik am meisten unfähig, den Menschen, der im Künst-
ler spricht, zu überhören.
Nun würde ich einem Poeten selbst daraus an
und für sich noch keinen Vorwurf machen, daß er das
ehebrecherische Verhältnis eines Verheirateten zu einer Ver-
heirateten behandelte. Thut ers aber so, wie Dehmel das
thut, ich kann mir nicht helfen, so widerts mich an.
Denn hier kann kaum die Rede davon sein, daß eine !
Tragik mit Schmerz und Leidenschaft nach Ausdruck
drängte, — nein, so gut wie nichts von Gewissenskampf,
wie nichts von dem Verlangen nach Alleinbesitz, wie nichts
von dem Ringen danach, durch Lösung und Bindung
Gesundheit herzustellen, vielmehr ein Genießen mit gele-
gentlichem Renommieren, dem das Verhültnis zu dritt so
wie es ist im Grunde gar nicht so übel zu dünken scheint.
Wenn ich Dehmel je eine große Tiefe zugetraut hätte,
nach diesen Gefühls-Seichtheiten wär es damit aus. Aber
es scheint, er strebt auch gar nicht danach. Das „Sinn-
bild" des Gedichtbandes zeigt ein Schiffchen, darin ein
Engel zum Gesang eines Vögelchens harst, während ein
gemütlich und dumm ausschauender Teufel dazu klim-
pert. „Euch und Mir in Dankbarkeit" steht darunter und
dann:
Erst wenn der Geist von jedem Zweck genesen
Und nichts mehr wissen will als seine Triebe,
Dann offenbart sich ihm das weise Wesen
Verliebter Thorheit und der großen Liebe.
Ein „Gondelliedchen" ergänzt das noch:
Bitte, bitte, Vögelchen:
Schiffchen hat 'n Segelchen,
Segelt übers Meer:
Vögelchen, komm her!
Komm und setz dich, laß dich wiegen,
Warum willst du immer fliegen,
Machst es dir so schwer!
Singe, kleiner Passagier!
Wenn die großen Wellen krachen,
Wird dein Lied uns ruhig macheu;
Still vergessen wir
Erde, Mensch und Tier.
Schutzgsfühle nennt das der Psychologe, ihr Herren!
Unsre alten großen Talente empfandens als ihre Lebens-
aufgabe, ihr Jnnensein immer mehr zu vertiefen, ihre
Gefühlswelt zu stärken und zu bereichern, aber auch ihre
Gedankenwelt, um mit der wachsenden Fülle im Haupt
immer stolzer, sreier, größer auch zu empfinden, Mensch
seiend mit jedem Jahr in umfassenderem und intensiverem
Sinne. Jhr aber pslückt, was ihr halt gerade in euch
findet, und beguckt und bewundert das als etwas er-
staunlich Herrliches, doch ihr sät und pflanzt nichts
Neues in euch hinein. So treibt ihr Raubbau an eurer
eignen Persönlichkeit, bis nach ein paar armen Sommern
immer schlechterer Ernte der Boden versagt und nichts mehr
im Hirne bleibt, als ein Duseln und Dümmern. Dann
langt es kaum noch zu, eine Stimmung wirklich aus-
tönen zu lassen, ja, die Stimmungen sehen überhaupt
beinahe aus nur wie Einfälle oder Launen. Was den
Verlebten noch am besten gelingt, ist etwa ein Kinder-
liedchen; man freut sich, wenn die Herren kindlich sprechen,
denn wenn sie erhaben sein wollen, werden sie kindisch.
Zwar die großen Worte sind doch geblieben, sie müssen
heran, die poetische ckementia. 8emli8 als etwas gar Hohes
hinzustellen. Schutzgefühle, ihr Herren — wem sich das
„weise Wesen" „der großen Liebe" erst offenbart, wenn
der Geist „nichts mehr wissen will, als seine Triebe"
und „still vergessen Erde, Mensch und Tier", der wird
vom lieben Gott ausgelacht, so lange jeder Frühling