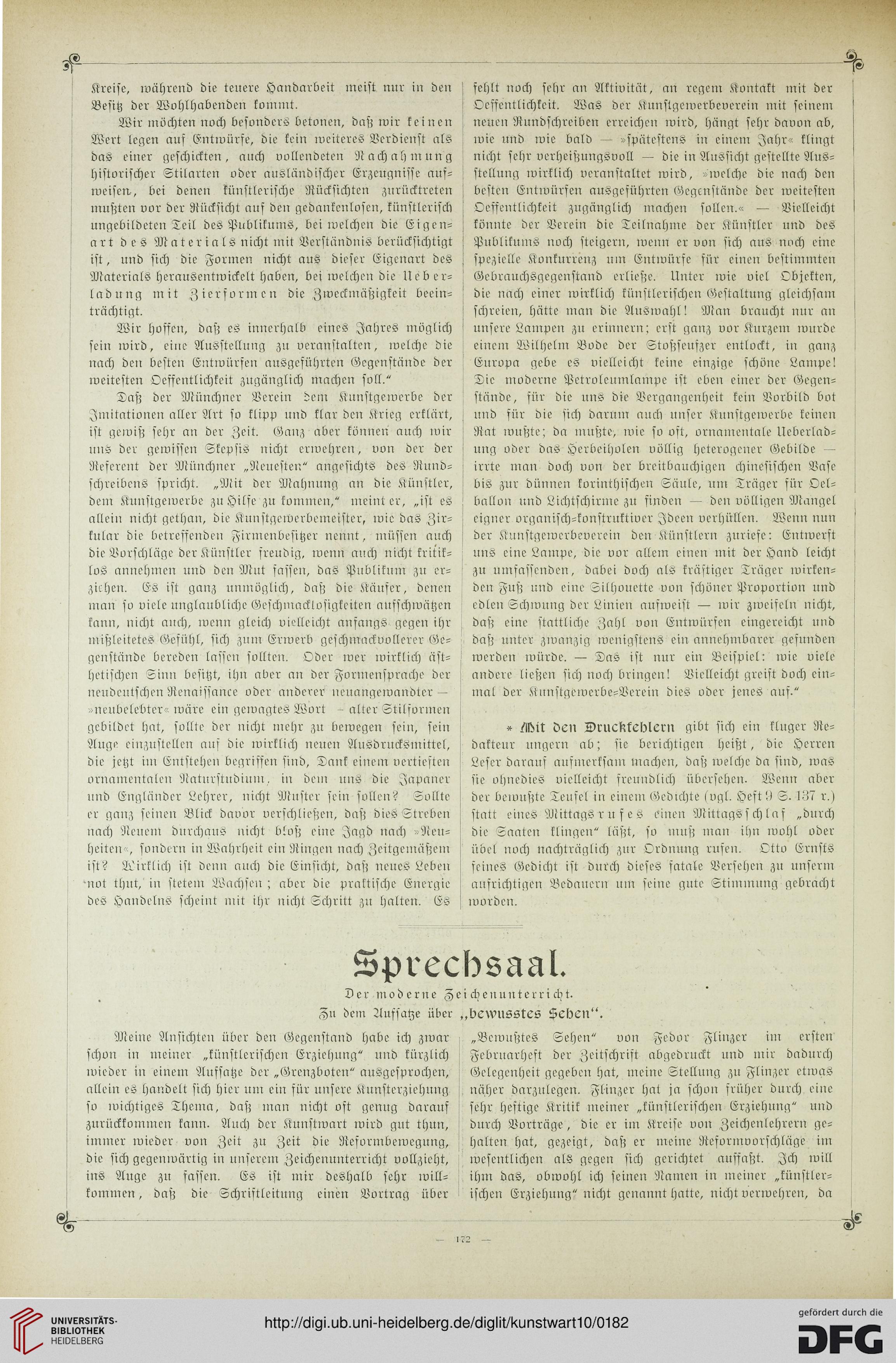- --
Kreise, wührend die teuere Handarbeit meist nur in den
Besitz der Wohlhabenden kommt.
Wir möchten noch besonders betonen, daß wir keinen
Wert legen auf Entwürfe, die kein weiteres Verdienst als
das einer geschickten, auch vollendeten Nachahmung
historischer Stilarten oder ausländischer Erzeugnisse auf-
weisen., bei denen künstlerische Rücksichten zurücktreten
mußten vor der Rücksicht auf den gedankenlosen, künstlerisch
ungebildeten Teil des Publikums, bei welchen die Eigen-
art des Materinls nicht mit Verständnis berücksichtigt
ist, und sich die Formen nicht aus dieser Eigenart des
Materials herausentwickelt haben, bei welchen die Ueb er-
ladung mit Zierformen die Zweckmäßigkeit beein-
trächtigt.
Wir hoffen, daß es innerhalb eines Jahres möglich
sein wird, eine Ausstellung zu ueranstalten, welche die
nach den besten Entwürfen ausgeführten Gegenstände der
weitesten Oeffentlichkeit zugänglich machen soll."
Daß der Münchner Verein Lem Kunstgewerbe der
Jmitationen aller Art so klipp und klar den Krieg erklärt,
ist gewiß sehr an der Zeit. Ganz aber können auch mir
uns der gewissen Skepsis nicht erwehren, von der der
Neferent der Münchner „Neuesten" angesichts des Rund-
schreibens spricht. „Mit der Mahnung an die Künstler,
dem Kunstgewerbe zu Hilfe zu kommen," meint er, „ist es
allein nicht gethan, die Kunstgemerbemeister^ ivic das Zir-
kular die betreffenden Firmenbesitzer nennt, müssen auch
die Vorschlüge der Künstler freudig, wenn auch nicht kritik-
los annehmen und den Mut fasseir, das Publikum zu er-
zichen. Es ist ganz unmöglich, daß die Käufer, dencn
man so viele unglaubliche Geschmacklosigkeiten aufschwätzen
kann, nicht anch, wenn gleich vielleicht anfangs gegen ihr
mißleitetes Gefühl, sich zum Erwerb geschmackvollerer Ge-
genstände bereden lassen sollten. Oder wer ivirklich äst-
hetischen Sinn besitzt, ihn aber an der Formensprache der
neudeutschen Renaissance oder arrderer neuangewandter —
»neubelebter« wäre ein gewagtes Wort - alter Stilsormen
gebildet hat, sollte der nicht mehr zu bewegen sein, sein
Auge einzustellen auf die wirklich neuen Ausdrucksmittel,
die jetzt irn Entstehen begriffen sind, Dank einem vertiesten
ornamentalen Naturstudium, in dem uns die Japaner
und Englünder Lehrer, nicht Muster sein sollen? Sollte
er ganz seinen Blick davor verschließen, daß dies Streben
nach Neuenr durchaus nicht bloß eine Jagd nach »Neu-
heiten«, sondern in Wahrheit ein Ringen nach Zeitgemüßern
ist? Wirklich ist denn auch die Einsicht, daß neues Leben
mot thut, in stetem Wachsen; aber die praktische Energie
des Handelns scheint rnit ihr nicht Schritt zu halten. Es
fehlt noch sehr an Aktivitüt, an regem Kontakt mit der
Oeffentlichkeit. Was der Kunstgewerbeverein mit scinem
neuen Rundschreiben erreichen wird, hüngt sehr davon ab,
wie und wie bald — »spätestens in einem Jahr« klingt
nicht sehr verheißungsvoll — die in Aussicht gestellte Aus-
stellung wirklich veranstaltet wird, »welche die nach den
besten Entrvürfen ausgesührten Gegenstände der weitesten
Oeffentlichkeit zugänglich machen sollen.« — Vielleicht !
könnte der Verein die Teilnahme der Künstler und des
Publikums noch steigern, wenn er von sich aus noch eine ^
spezielle Konkurrenz um Entwürfe für einen bestimmten
Gebrauchsgegenstand erließe. Unter wie viel Objekten,
die nach einer wirklich künstlerischen Gestaltung gleichsam
schreien, hätte man die Auswahl! Man braucht nur an
unsere Lampen zu erinnern; erst ganz vor Kurzem wurde
einem Wilhelm Bode der Stoßseufzer entlockt, in ganz I
Europa gebe es vielleicht keine einzige schöne Lanrpe!
Die moderne Petroleumlampe ist eben einer der Gegen-
stände, sür die uns die Vergangenheit kein Vorbild bot
und für die sich darum auch unser Kunstgewerbe keinen
Rat wußte; da mußte, wie so oft, ornarnentnle Ueberlad-
ung ader das Herbeiholen völlig heterogener Gebilde —
irrte man doch von der breitbauchigen chinesischen Vase
bis zur dünnen korinthischen Säule, um Träger sür Oel-
ballon und Lichtschirme zu finden — den völligen Mangel
eigner organisch-konstruktiver Jdeen verhüllen. Wenn nun
der Kunstgewerbeverein den Künstlern zuriefe: Entwerft
uns eine Lampe, die vor allem einen mit der Hand leicht
zu umfassenden, dabei doch als kräftiger Trüger wirken-
den Fuß und eine Silhouette von schöner Proportion und
edlen Schwung der Linien aufweist — wir zweifeln nicht,
daß eine stattliche Zahl von Entwürfen eingereicht und
daß unter zwanzig wenigstens ein annehmbarer gesunden
werden würde. — Das ist nur ein Beispiel: wie viele
andere ließen sich noch bringen! Vielleicht greift doch ein-
mal der Kunstgewerbe-Verein dies oder jenes auf."
» stldtt den Druekfebkcrn gibt sich ein kluger Re-
dakteur ungern ab; sie berichtigen heißt, die Herren
Leser darauf aufmerksam rnachen, daß rvelche da sind, was
sie ohnedies vielleicht freundlich übersehen. Wenn aber
der bervußte Teufel in einem Gedrchte (vgl. Heft st S. 137 r.)
statt eines Mittagsrufes einen Mittagsschlas „durch
die Saaten klingcn" läßt, so rnuß man ihn wohl oder
übel noch nachträglich zur Ordnung rufen. Otto Ernsts
feines Gedicht ist durch dieses satale Versehen zu unserm
aufrichtigen Bedauern um seine grrte Stimmung gebracht
rvorden.
Lprecdsaal.
Dermoderne Zeichenunterricht.
Zn dem Aufsatze über „bewusstes Sebeu".
Meine Ansichterr über den Gegenstand habe ich zwar
schon in meiner „künstlerischen Erziehrrng" und kürzlich
wieder in einem Aufsatze der „Grenzboten" ausgesprochen,
allein es handelt sich hier um ein für unsere Kunsterziehung
so rvichtiges Thema, daß rnnn nicht oft genug darnuf
zurückkomrnen kann. Auch der Kunstwart wird gut thun,
immer wieder von Zeit zu Zeit die Reformbewegung,
die sich gegenwärtig in unserem Zeichenunterricht vollzieht,
ins Auge zu sassen. Es ist mir deshalb sehr rvill-
kommen, daß die Schriftleitung einen Vortrag über
„Bcwußtes Sehen" von Fedor Flinzer im ersten
Februarhest der Zeitschrist abgedruckt und mir dadurch
Gelegenheit gegeben hat, meine Stellung zu Flinzer etwas
näher darzulegen. Flinzer hat ja schon früher durch eine
sehr heftige Kritik meiner „künstlerischen Erziehung" und
durch Vorträge, die er im Kreise von Zeichenlehrern ge-
halten hat, gezeigt, daß er meine Reformvorschläge irn
wesentlichen als gegen sich gerichtet auffaßt. Jch will
ihm das, obrvohl ich seinen Namen in meiner „künstler-
ischen Erziehung" nicht genannt hatte, nicht verrvehren, da
172