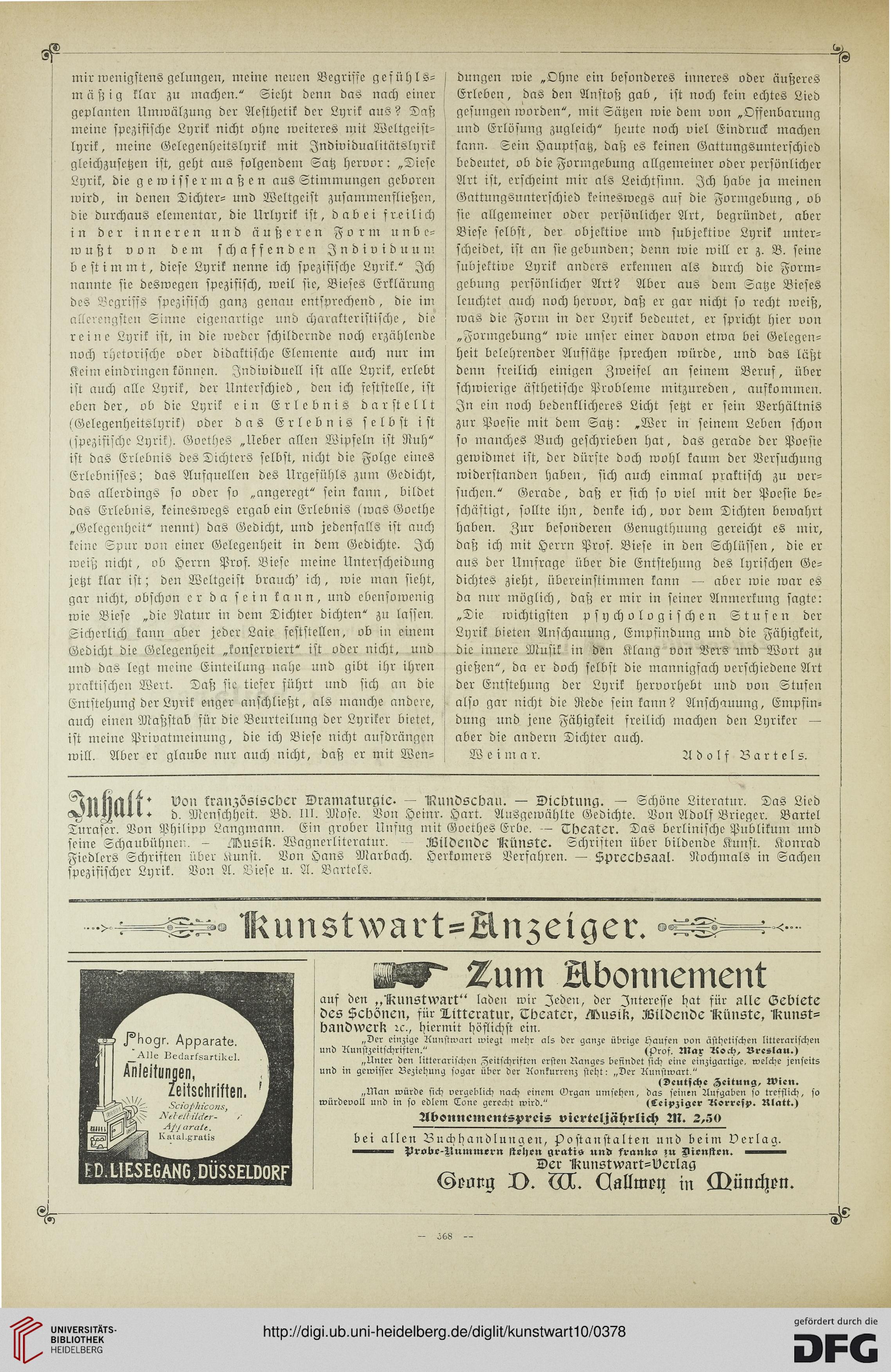mir wenigstens gelungen, meine neuen Begrisfe gesühls- !
mäßig klar zu machen." Sieht denn das nach einer !
geplanten Umwälzung der Aesthetik der Lyrik aus? Daß
meine spezifische Lyrik nicht ohne weiteres mit Weltgeist-
lyrik, meine Gelegenhcitslprik mit Jndividualitätslyrik
gleichzusetzen ist, geht aus folgendem Satz hervor: „Diese
Lyrik, die g e w i ss e r m a ß e n aus Stimmungen geboren
wird, in denen Dichter- und Weltgeist zusammenfließen,
die durchaus elementar, die Urlyrik ist, dabei sr.eilich
in der inneren und üußeren Forni unbe-
wußt von dem schaffenden Jndividuum
bestimmt, diese Lyrik nenne ich spezifische Lyrik." Jch
nannte sie deswegen spezifisch, weil sie, Bieses Erklärung
des Begrisfs spezifisch ganz genau entsprechend, die ini
allerengsten Sinne cigenartige und charakteristische, die
reine Lyrik ist, in die wedcr schildernde noch erzählende
noch rhetorische oder didaktische Elemente auch nur im
Keim eindringen können. Jndividuell ist alle Lyrik, erlebt
ist auch alle Lyrik, der Unterschied, den ich seststelle, ist
eben der, ob die Lyrik ein Erlebnis darstellt
(Gelegenheitslyrik) oder das Erlebnis selbst ist
lspezifische Lyrik). Goethes „Ueber allen Wipfeln ist Nuh"
ist das Erlebnis des Dichters selbst, nicht die Folge eines
Erlebnisses; das Aufquellen des Urgefühls zum Gedicht,
das allerdings so oder so „angeregt" sein kann, bildet
das Erlebnis, keineswegs ergab ein Erlebnis (was Goethe
„Gelegcnhcit" nennt) das Gedicht, und jedenfalls ist auch
keinc Spur von einer Gelegenheit in dem Gedichte. Jch
weiß nicht, ob Herrn Pros. Viese meine Unterscheidung
jetzt klar ist; den Weltgeist brauch' ich, wie man sieht,
gar nicht, obschon er da sein kann, und ebensowenig
wie Biese „die Natur in dem Dichter dichterU zu lassen.
Sicherlich kann aber jeder Laie feststellen, ob in einem
Gedicht die Gelegenheit „konserviert" ist oder nicht, und
und das legt meine Eintcilung nahe und gibt ihr ihren
praktischen Wert. Daß sie tiefer sührt und sich an die
Entstehung der Lyrik enger anschließt, als manche andere,
auch einen Maßstab für die Beurteilung der Lyriker bietet,
ist meine Privatmeinung, die ich Biese nicht aufdrängen
will. Aber er glaube nur auch nicht, daß er mit Wen-
dungen wie „Ohne ein besonderes inneres oder äußeres
Erleben, das den Anstoß gab, ist noch kein echtes Lied
gesungen worden", mit Sätzen wie dem von „Ofsenbarung
und Erlösung zugleich" heute noch viel Eindruck machen
kann. Sein Hauptsatz, daß es keinen Gattungsunterschied
bedeutet, ob die Formgebung allgemeiner oder persönlicher
Art ist, erscheint mir als Leichtsinn. Jch habe ja meinen
Gattungsunterschied keineswegs auf die Formgebung, ob
sie allgemeiner oder persönlicher Art, begründet, aber
Biese selbst, der objektive und subjektive Lyrik unter-
scheidet, ist an sie gebunden; denn wie will er z. B. seine
subjektive Lyrik andcrs erkennen als durch die Form-
gebung persönlicher Art? Aber aus dem Satze Bieses
leuchtet auch noch hervor, daß er gar nicht so recht weiß,
was die Form in der Lyrik bedeutet, er spricht hier von
„Formgebung" wie unser einer üavon etwa bei Gelegen-
heit belehrender Aussätze sprechen würde, und das läßt
denn freilich einigen Zweifel an seinem Berus, über
schwierige ästhetische Probleme mitzureden, aufkommen.
Jn ein noch bedenklicheres Licht setzt er sein Verhältnis
zur Poesie mit dem Satz: „Wer in seinem Leben schon
so manches Buch geschrieben hat, das gerade der Poesie
gewidmet ist, der dürfte doch wohl kaum der Versuchung
widerstanden haben, sich auch einmal praktisch zu ver-
suchen." Gerade, daß er sich so viel mit der Poesie be-
schäftigt, sollte ihn, denke ich, vor dem Dichten bewahrt
haben. Zur besonderen Genugthuung gereicht es mir,
daß ich mit Herrn Prof. Biese in den Schlüssen, die er
aus der Umsrage über die Entstehung des lyrischen Ge-
dichtes zieht, übereinstimmen kann — aber wie war es
da nur möglich, daß er mir in seiner Anmerkung sagte:
„Die wichtigsten psychologischen Stufen der
Lyrik bieten Anschauung, Empfindung und die Fähigkeit,
dic innere Musik in den Klang von Vers und Wort zu
gießen", da er doch selbst die mannigfach verschiedene Art
der Entstehung der Lyrik hervorhebt und von Stufen
also gar nicht die Rede sein kann? Anschauung, Empfin-
dung und jene Fähigkeit sreilich machen den Lyriker —
aber die andern Dichter auch.
Weimar. Adolf Bartels.
Von frnnzösiscber Drnmnturgre. — Inuudscbuu. — Dicbtuirg. — Schöne Literatur. Das Lied
ö. Menschheit. Bd. III. Mose. Von Heinr. Hart. Ausgewählte Gedichte. Von Aüolf Brieger. Bartel
Turaser. Von Philipp Langmann. Ein grober Unfug mit Goethes Erbe. — Obenter. Das berlinische Publikum und
seine Schaubühnen. - -Dusik- Wagnerliteratur. -- Wildende 'kltünste. Schristen über bildende Kunst. Konrad
Fiedlers Schristen über Kunst. Von Hans Marbach. Herkomers Verfahren. — Hpreebsaul. Nochmals in Sachen
spezisischer Lyrik. Von A. Biese u. A. Bartels.
UullstWart--Nnzeiger.
Lmn Nbomlement
auf den „Ikunstvvnrt" laden wir Zeden, der Znteresse hat für nlle Gebiete
des Hcbönen, für Litteratur, Tbeater, /Sdusik» Mldende Ikünste, Ikunst-
bnndvverk rc., hiermit höflichst ein.
und Aunstzeitschriften." ^ ^ ^ 00rof. rNax Tioch, Sreslau.)
und in gewisser Beziebung sogar über der Aonkurrenz steht: „Der Aunstwart."
(Deutsche Zeit»»ng, wien.
„Man würde sich vergeblich nach einem Vrgan umseben, das seinen Aufgaben so trefflich, so
Absiinesnentspreis vievtelMhrlich Al. 2,A0
bei allen Buchhandlungen, j)oftanstalten und beim verlag.
. Probe-Uuinrrrevn fteiierr geatrs nnr» feanko ;u Diensten. -
Der Ikuustvvftrt-Verläg
Gearg V. M. Oallmey in <I>ünchen.
mäßig klar zu machen." Sieht denn das nach einer !
geplanten Umwälzung der Aesthetik der Lyrik aus? Daß
meine spezifische Lyrik nicht ohne weiteres mit Weltgeist-
lyrik, meine Gelegenhcitslprik mit Jndividualitätslyrik
gleichzusetzen ist, geht aus folgendem Satz hervor: „Diese
Lyrik, die g e w i ss e r m a ß e n aus Stimmungen geboren
wird, in denen Dichter- und Weltgeist zusammenfließen,
die durchaus elementar, die Urlyrik ist, dabei sr.eilich
in der inneren und üußeren Forni unbe-
wußt von dem schaffenden Jndividuum
bestimmt, diese Lyrik nenne ich spezifische Lyrik." Jch
nannte sie deswegen spezifisch, weil sie, Bieses Erklärung
des Begrisfs spezifisch ganz genau entsprechend, die ini
allerengsten Sinne cigenartige und charakteristische, die
reine Lyrik ist, in die wedcr schildernde noch erzählende
noch rhetorische oder didaktische Elemente auch nur im
Keim eindringen können. Jndividuell ist alle Lyrik, erlebt
ist auch alle Lyrik, der Unterschied, den ich seststelle, ist
eben der, ob die Lyrik ein Erlebnis darstellt
(Gelegenheitslyrik) oder das Erlebnis selbst ist
lspezifische Lyrik). Goethes „Ueber allen Wipfeln ist Nuh"
ist das Erlebnis des Dichters selbst, nicht die Folge eines
Erlebnisses; das Aufquellen des Urgefühls zum Gedicht,
das allerdings so oder so „angeregt" sein kann, bildet
das Erlebnis, keineswegs ergab ein Erlebnis (was Goethe
„Gelegcnhcit" nennt) das Gedicht, und jedenfalls ist auch
keinc Spur von einer Gelegenheit in dem Gedichte. Jch
weiß nicht, ob Herrn Pros. Viese meine Unterscheidung
jetzt klar ist; den Weltgeist brauch' ich, wie man sieht,
gar nicht, obschon er da sein kann, und ebensowenig
wie Biese „die Natur in dem Dichter dichterU zu lassen.
Sicherlich kann aber jeder Laie feststellen, ob in einem
Gedicht die Gelegenheit „konserviert" ist oder nicht, und
und das legt meine Eintcilung nahe und gibt ihr ihren
praktischen Wert. Daß sie tiefer sührt und sich an die
Entstehung der Lyrik enger anschließt, als manche andere,
auch einen Maßstab für die Beurteilung der Lyriker bietet,
ist meine Privatmeinung, die ich Biese nicht aufdrängen
will. Aber er glaube nur auch nicht, daß er mit Wen-
dungen wie „Ohne ein besonderes inneres oder äußeres
Erleben, das den Anstoß gab, ist noch kein echtes Lied
gesungen worden", mit Sätzen wie dem von „Ofsenbarung
und Erlösung zugleich" heute noch viel Eindruck machen
kann. Sein Hauptsatz, daß es keinen Gattungsunterschied
bedeutet, ob die Formgebung allgemeiner oder persönlicher
Art ist, erscheint mir als Leichtsinn. Jch habe ja meinen
Gattungsunterschied keineswegs auf die Formgebung, ob
sie allgemeiner oder persönlicher Art, begründet, aber
Biese selbst, der objektive und subjektive Lyrik unter-
scheidet, ist an sie gebunden; denn wie will er z. B. seine
subjektive Lyrik andcrs erkennen als durch die Form-
gebung persönlicher Art? Aber aus dem Satze Bieses
leuchtet auch noch hervor, daß er gar nicht so recht weiß,
was die Form in der Lyrik bedeutet, er spricht hier von
„Formgebung" wie unser einer üavon etwa bei Gelegen-
heit belehrender Aussätze sprechen würde, und das läßt
denn freilich einigen Zweifel an seinem Berus, über
schwierige ästhetische Probleme mitzureden, aufkommen.
Jn ein noch bedenklicheres Licht setzt er sein Verhältnis
zur Poesie mit dem Satz: „Wer in seinem Leben schon
so manches Buch geschrieben hat, das gerade der Poesie
gewidmet ist, der dürfte doch wohl kaum der Versuchung
widerstanden haben, sich auch einmal praktisch zu ver-
suchen." Gerade, daß er sich so viel mit der Poesie be-
schäftigt, sollte ihn, denke ich, vor dem Dichten bewahrt
haben. Zur besonderen Genugthuung gereicht es mir,
daß ich mit Herrn Prof. Biese in den Schlüssen, die er
aus der Umsrage über die Entstehung des lyrischen Ge-
dichtes zieht, übereinstimmen kann — aber wie war es
da nur möglich, daß er mir in seiner Anmerkung sagte:
„Die wichtigsten psychologischen Stufen der
Lyrik bieten Anschauung, Empfindung und die Fähigkeit,
dic innere Musik in den Klang von Vers und Wort zu
gießen", da er doch selbst die mannigfach verschiedene Art
der Entstehung der Lyrik hervorhebt und von Stufen
also gar nicht die Rede sein kann? Anschauung, Empfin-
dung und jene Fähigkeit sreilich machen den Lyriker —
aber die andern Dichter auch.
Weimar. Adolf Bartels.
Von frnnzösiscber Drnmnturgre. — Inuudscbuu. — Dicbtuirg. — Schöne Literatur. Das Lied
ö. Menschheit. Bd. III. Mose. Von Heinr. Hart. Ausgewählte Gedichte. Von Aüolf Brieger. Bartel
Turaser. Von Philipp Langmann. Ein grober Unfug mit Goethes Erbe. — Obenter. Das berlinische Publikum und
seine Schaubühnen. - -Dusik- Wagnerliteratur. -- Wildende 'kltünste. Schristen über bildende Kunst. Konrad
Fiedlers Schristen über Kunst. Von Hans Marbach. Herkomers Verfahren. — Hpreebsaul. Nochmals in Sachen
spezisischer Lyrik. Von A. Biese u. A. Bartels.
UullstWart--Nnzeiger.
Lmn Nbomlement
auf den „Ikunstvvnrt" laden wir Zeden, der Znteresse hat für nlle Gebiete
des Hcbönen, für Litteratur, Tbeater, /Sdusik» Mldende Ikünste, Ikunst-
bnndvverk rc., hiermit höflichst ein.
und Aunstzeitschriften." ^ ^ ^ 00rof. rNax Tioch, Sreslau.)
und in gewisser Beziebung sogar über der Aonkurrenz steht: „Der Aunstwart."
(Deutsche Zeit»»ng, wien.
„Man würde sich vergeblich nach einem Vrgan umseben, das seinen Aufgaben so trefflich, so
Absiinesnentspreis vievtelMhrlich Al. 2,A0
bei allen Buchhandlungen, j)oftanstalten und beim verlag.
. Probe-Uuinrrrevn fteiierr geatrs nnr» feanko ;u Diensten. -
Der Ikuustvvftrt-Verläg
Gearg V. M. Oallmey in <I>ünchen.