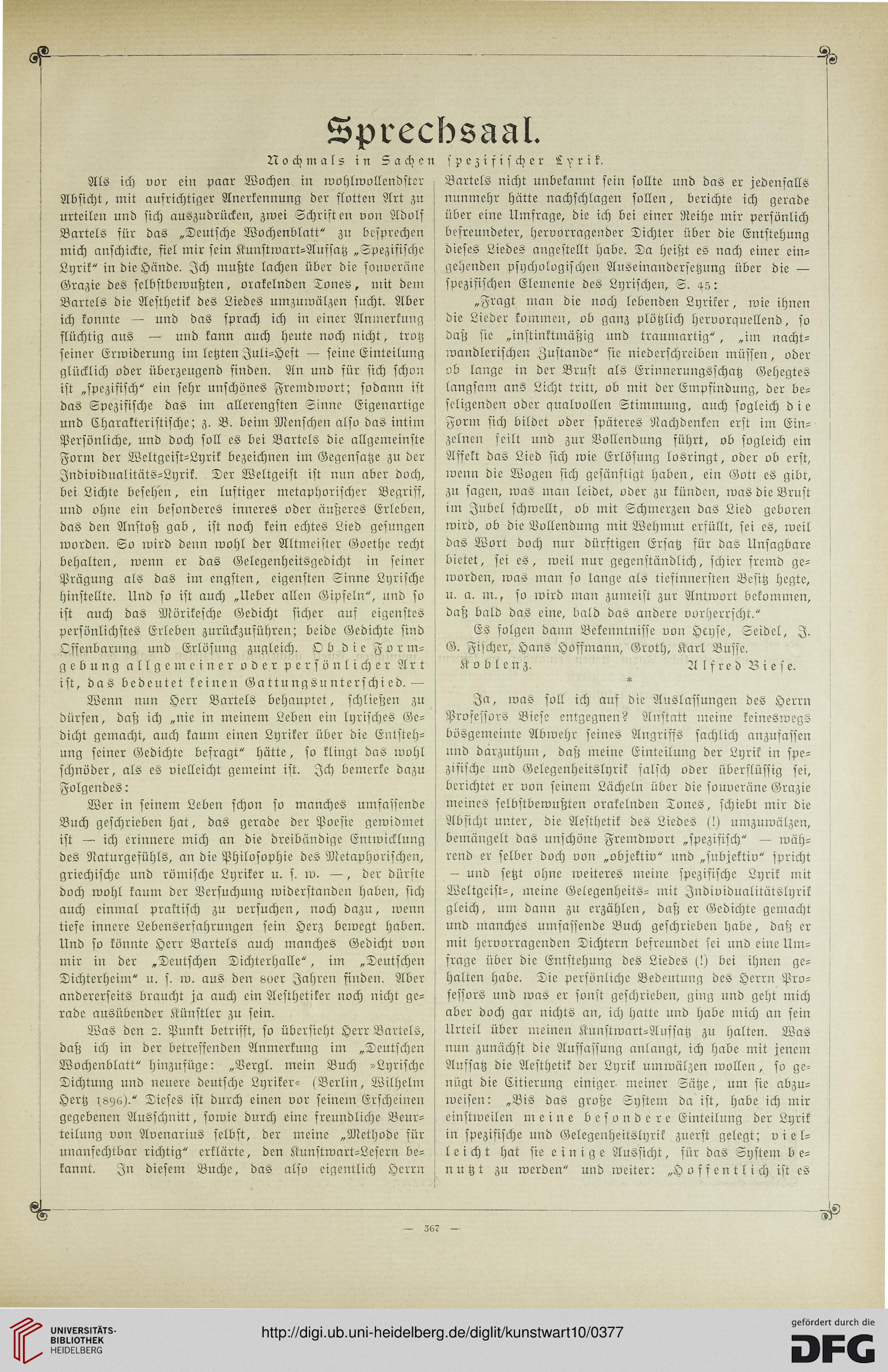Lprecbsaal
N o ch nr a l s in Sachen
Als ich vor ein paar Wochen in wohlwollendster
Absicht, mit ausrichtiger Anerkennung der slotten Art zu
urteilen und sich auszudrücken, zwei Schriften von Adolf
Bartels sür das „Deutsche Wochenblatt" zu besprechen
mich anschickte, fiel mir sein Kunstwart-Aufsatz „Spezisische
Lyrik" in die Hände. Jch mußte lachen über die souvernne
Grazie des selbstbewußten, orakelnden Tones, mit dem
Barrels die Aesthetik des Liedes umzuwälzen sucht. Aber
ich konnte — und das sprach ich in einer Anmerkung
flüchtig aus — und kann auch heute noch nicht, trotz
seiner Erwiderung im letzten Juli-Heft — seine Einteilung
glücklich oder überzeugend finden. An und für sich schon
ist „spezifisch" ein sehr unschönes Fremdwort; sodann ist
das Spezifische das im allerengsten Sinne Eigenartige
und Charakteristische; z. B. beim Menschen also das intim
Persönliche, und doch soll es bei Bartels die allgemeinste
Form der Weltgeist-Lyrik bezeichnen im Gegensatze zu der
Jndividualitäts-Lyrik. Der Weltgeist ist nun aber doch,
bei Lichte besehen, ein luftiger metaphorischer Begriff,
und ohne ein besonderes inneres oder äußeres Erleben,
das den Anstoß gab, ist noch kein echtes Lied gesungen
worden. So wird denn wohl der Altmeisler Goethe recht
behalten, wenn er das Gelegenheitsgedicht in seiner
Prägung als das im engsten, eigensten Sinne Lyrische
hinstellte. Und so ist auch „Ueber allen Gipfeln", und so
ist auch das Mörikesche Gedicht sicher aus eigenstes
persönlichstes Erleben zurückzusühren; beide Gedichte sind
Lfsenbarung und Erlösung zugleich. Ob die For m-
gebung allgemeiner oder persönlicher Art
ist, das bedeutet keinen Gattungsunterschied.—
Wenn nun Herr Bartels behauptet, schließen zu
dürfen, daß ich „nie in meinem Leben ein lyrisches Ge-
' dicht gemacht, auch kaum einen Lyriker über die Entsteh-
ung seiner Gedichte befragt" hätte, so klingt das wohl
fchnöder, als es vielleicht gemeint ist. Jch bemerke dazu
Folgendes:
Wer in feinem Leben schon so manches umfassende
Buch geschrieben hat, das gerade der Poesie gewidmet
ist — ich erinnere mich an die dreibändige Entwicklung
des Naturgefühls, an die Philosophie des Metaphorischen,
griechische und römische Lyriker u. s. w. —, der dürfte
doch wohl kaum der Versuchur:g widerstanden haben, sich
auch einmal praktisch zu versuchen, noch dazu, wenn
tiefe innere Lebenserfahrungen sein Herz bewegt haben.
Und so könnte Herr Bartels auch manches Gedicht von
mir in der „Deutschen Dichterhalle", im „Deutschen
Dichterheim" u. s. w. aus den 8oer Jahren finden. Aber
andererseits braucht fa auch ein Aesthetiker noch nicht ge-
rade ausübender Künstler zu sein.
Was den 2. Punkt betrifft, so übersieht Herr Bartels,
daß ich in der betreffenden Anmerkung im „Deutschen
Wochenblatt" hinzufüge: „Vergl. mein Buch »Lyrifche
Dichtung und neuere deutsche Lyriker« (Berlin, Wilhelm
Hertz zLys)." Dieses ist durch einen vor seinem Erscheinen
gegebenen Ausschnitt, sowie durch eine freundliche Beur-
teilung von Avenarius selbft, der meine „Methode für
unanfechtbar richtig" erklärte, den Kunftwart-Lesern be-
kannt. Jn diesem Buche, das also eigentlich Herrn
fpezififcher Lyrik.
Bartels nicht unbekannt sein sollte und das er jedenfalls
nunmehr hätte nachschlagen sollen, berichte ich gerade
über eine Umfrage, die ich bei einer Reihe mir persönlich
befreundeter, hervorragender Dichter über die Entstehung
dieses Liedes angestellt habe. Da heißt es nach einer ein-
gehenden psychologischen Auseinandersetzung über die —
spezifischen Elemente des Lyrischen, S. q-s:
„Fragt man die noch lebenden Lyriker, wie ihnen
die Lieder kommen, ob ganz plötzlich hervorquellend, so
daß fic „instinktmäßig und traumartig", „im nacht-
wandlerischen Zustande" sie niederschreiben müssen, oder
ob lange in der Brust als Erinnerungsschatz Gehegtes
langsam ans Licht tritt, ob mit der Empfindung, der be-
feligenden oder qualvollen Stimmung, auch sogleich die
Form sich bildct oder späteres Nachdenken erst im Ein-
zelnen feilt und zur Vollendung führt, ob sogleich ein
Affekt das Lied fich wie Erlösung losringt, oder ob erst,
wenn die Wogen sich gesänftigt haben, ein Gott es gibt,
zu sagen, was man leidet, oder zu künden, was die Brust
im Jubel schwellt, ob mit Schmerzen das Lied geboren
wird, ob die Vollendung mit Wehmut erfüllt, fei es, weil
das Wort doch nur dürstigen Ersatz für das Unsagbare
bietet, sei es, weil nur gegenständlich, schier sremd ge-
worden, was man so lange als tiefinnersten Besitz hegte,
u. a. m., so wird man zumeist zur Antwort bekommen,
daß bald das eine, bald das andere vorherrscht."
Es folgen dann Bekenntnisse von Heyse, Seidel, I.
G. Fischer, Hans Hoffmann, Groth, Karl Busse.
K o b l e n z. Alfred Biese.
Ja, was soll ich auf die Auslassungen des Herrn
Professors Biese entgegnen? Anftatt meine keineswegs
bösgemeinte Abwehr seines Angriffs sachlich anzufassen
und darzuthun, daß meine Einteilung der Lyrik in spe-
zifische und Gelegenheitslyrik falsch oder überslüssig fei,
berichtet er von feinem Lücheln über üie souveräne Grazie
meines selbstbewußten orakelnden Tones, schiebt mir die
Absicht unter, die Aesthetik des Liedes (!) umzuwälzen,
bemängelt das unschöne Fremdwort „spezifisch" — wäh-
rend er selber doch von „obfektiv" und „subfektiv" spricht
— und setzt ohne weiteres meine fpezifische Lyrik mit
Weltgcist-, meine Gelegenheits- mit Jndividualitätslyrik
gleich, um dann zu erzählen, daß er Gedichte gemacht
und manches umfassende Buch geschrieben habe, daß er
mit hervorragenden Dichtern befreundet sei und eine Um-
frage über die Entstehung des Liedes (!) bei ihnen ge-
halten habe. Die persönliche Bedeutung des Herrn Pro-
fessors und was er sonst geschrieben, ging und geht mich
aber doch gar nichts an, ich hatte und habe mich an fein
Urteil über meinen Kunstwart-Aufsatz zu halten. Was
nun zunächst die Auffassung anlangt, ich habe mit jenem !
Aufsatz die Aesthetik der Lyrik umwälzen wollen, so ge-
nügt die Citierung einiger- meiner Sätze, um sie abzu-
weisen: „Bis das große System da ist, habe ich mir
einstweilen meine besondere Einteilung der Lyrik
in fpezifische und Gelegenheitslyrik zuerst gelegt; v i e l-
leicht hat sie einige Aussicht, für das Syftem b e-
nutzt zu werden" und weiter: „tzoffentlich ist es
N o ch nr a l s in Sachen
Als ich vor ein paar Wochen in wohlwollendster
Absicht, mit ausrichtiger Anerkennung der slotten Art zu
urteilen und sich auszudrücken, zwei Schriften von Adolf
Bartels sür das „Deutsche Wochenblatt" zu besprechen
mich anschickte, fiel mir sein Kunstwart-Aufsatz „Spezisische
Lyrik" in die Hände. Jch mußte lachen über die souvernne
Grazie des selbstbewußten, orakelnden Tones, mit dem
Barrels die Aesthetik des Liedes umzuwälzen sucht. Aber
ich konnte — und das sprach ich in einer Anmerkung
flüchtig aus — und kann auch heute noch nicht, trotz
seiner Erwiderung im letzten Juli-Heft — seine Einteilung
glücklich oder überzeugend finden. An und für sich schon
ist „spezifisch" ein sehr unschönes Fremdwort; sodann ist
das Spezifische das im allerengsten Sinne Eigenartige
und Charakteristische; z. B. beim Menschen also das intim
Persönliche, und doch soll es bei Bartels die allgemeinste
Form der Weltgeist-Lyrik bezeichnen im Gegensatze zu der
Jndividualitäts-Lyrik. Der Weltgeist ist nun aber doch,
bei Lichte besehen, ein luftiger metaphorischer Begriff,
und ohne ein besonderes inneres oder äußeres Erleben,
das den Anstoß gab, ist noch kein echtes Lied gesungen
worden. So wird denn wohl der Altmeisler Goethe recht
behalten, wenn er das Gelegenheitsgedicht in seiner
Prägung als das im engsten, eigensten Sinne Lyrische
hinstellte. Und so ist auch „Ueber allen Gipfeln", und so
ist auch das Mörikesche Gedicht sicher aus eigenstes
persönlichstes Erleben zurückzusühren; beide Gedichte sind
Lfsenbarung und Erlösung zugleich. Ob die For m-
gebung allgemeiner oder persönlicher Art
ist, das bedeutet keinen Gattungsunterschied.—
Wenn nun Herr Bartels behauptet, schließen zu
dürfen, daß ich „nie in meinem Leben ein lyrisches Ge-
' dicht gemacht, auch kaum einen Lyriker über die Entsteh-
ung seiner Gedichte befragt" hätte, so klingt das wohl
fchnöder, als es vielleicht gemeint ist. Jch bemerke dazu
Folgendes:
Wer in feinem Leben schon so manches umfassende
Buch geschrieben hat, das gerade der Poesie gewidmet
ist — ich erinnere mich an die dreibändige Entwicklung
des Naturgefühls, an die Philosophie des Metaphorischen,
griechische und römische Lyriker u. s. w. —, der dürfte
doch wohl kaum der Versuchur:g widerstanden haben, sich
auch einmal praktisch zu versuchen, noch dazu, wenn
tiefe innere Lebenserfahrungen sein Herz bewegt haben.
Und so könnte Herr Bartels auch manches Gedicht von
mir in der „Deutschen Dichterhalle", im „Deutschen
Dichterheim" u. s. w. aus den 8oer Jahren finden. Aber
andererseits braucht fa auch ein Aesthetiker noch nicht ge-
rade ausübender Künstler zu sein.
Was den 2. Punkt betrifft, so übersieht Herr Bartels,
daß ich in der betreffenden Anmerkung im „Deutschen
Wochenblatt" hinzufüge: „Vergl. mein Buch »Lyrifche
Dichtung und neuere deutsche Lyriker« (Berlin, Wilhelm
Hertz zLys)." Dieses ist durch einen vor seinem Erscheinen
gegebenen Ausschnitt, sowie durch eine freundliche Beur-
teilung von Avenarius selbft, der meine „Methode für
unanfechtbar richtig" erklärte, den Kunftwart-Lesern be-
kannt. Jn diesem Buche, das also eigentlich Herrn
fpezififcher Lyrik.
Bartels nicht unbekannt sein sollte und das er jedenfalls
nunmehr hätte nachschlagen sollen, berichte ich gerade
über eine Umfrage, die ich bei einer Reihe mir persönlich
befreundeter, hervorragender Dichter über die Entstehung
dieses Liedes angestellt habe. Da heißt es nach einer ein-
gehenden psychologischen Auseinandersetzung über die —
spezifischen Elemente des Lyrischen, S. q-s:
„Fragt man die noch lebenden Lyriker, wie ihnen
die Lieder kommen, ob ganz plötzlich hervorquellend, so
daß fic „instinktmäßig und traumartig", „im nacht-
wandlerischen Zustande" sie niederschreiben müssen, oder
ob lange in der Brust als Erinnerungsschatz Gehegtes
langsam ans Licht tritt, ob mit der Empfindung, der be-
feligenden oder qualvollen Stimmung, auch sogleich die
Form sich bildct oder späteres Nachdenken erst im Ein-
zelnen feilt und zur Vollendung führt, ob sogleich ein
Affekt das Lied fich wie Erlösung losringt, oder ob erst,
wenn die Wogen sich gesänftigt haben, ein Gott es gibt,
zu sagen, was man leidet, oder zu künden, was die Brust
im Jubel schwellt, ob mit Schmerzen das Lied geboren
wird, ob die Vollendung mit Wehmut erfüllt, fei es, weil
das Wort doch nur dürstigen Ersatz für das Unsagbare
bietet, sei es, weil nur gegenständlich, schier sremd ge-
worden, was man so lange als tiefinnersten Besitz hegte,
u. a. m., so wird man zumeist zur Antwort bekommen,
daß bald das eine, bald das andere vorherrscht."
Es folgen dann Bekenntnisse von Heyse, Seidel, I.
G. Fischer, Hans Hoffmann, Groth, Karl Busse.
K o b l e n z. Alfred Biese.
Ja, was soll ich auf die Auslassungen des Herrn
Professors Biese entgegnen? Anftatt meine keineswegs
bösgemeinte Abwehr seines Angriffs sachlich anzufassen
und darzuthun, daß meine Einteilung der Lyrik in spe-
zifische und Gelegenheitslyrik falsch oder überslüssig fei,
berichtet er von feinem Lücheln über üie souveräne Grazie
meines selbstbewußten orakelnden Tones, schiebt mir die
Absicht unter, die Aesthetik des Liedes (!) umzuwälzen,
bemängelt das unschöne Fremdwort „spezifisch" — wäh-
rend er selber doch von „obfektiv" und „subfektiv" spricht
— und setzt ohne weiteres meine fpezifische Lyrik mit
Weltgcist-, meine Gelegenheits- mit Jndividualitätslyrik
gleich, um dann zu erzählen, daß er Gedichte gemacht
und manches umfassende Buch geschrieben habe, daß er
mit hervorragenden Dichtern befreundet sei und eine Um-
frage über die Entstehung des Liedes (!) bei ihnen ge-
halten habe. Die persönliche Bedeutung des Herrn Pro-
fessors und was er sonst geschrieben, ging und geht mich
aber doch gar nichts an, ich hatte und habe mich an fein
Urteil über meinen Kunstwart-Aufsatz zu halten. Was
nun zunächst die Auffassung anlangt, ich habe mit jenem !
Aufsatz die Aesthetik der Lyrik umwälzen wollen, so ge-
nügt die Citierung einiger- meiner Sätze, um sie abzu-
weisen: „Bis das große System da ist, habe ich mir
einstweilen meine besondere Einteilung der Lyrik
in fpezifische und Gelegenheitslyrik zuerst gelegt; v i e l-
leicht hat sie einige Aussicht, für das Syftem b e-
nutzt zu werden" und weiter: „tzoffentlich ist es