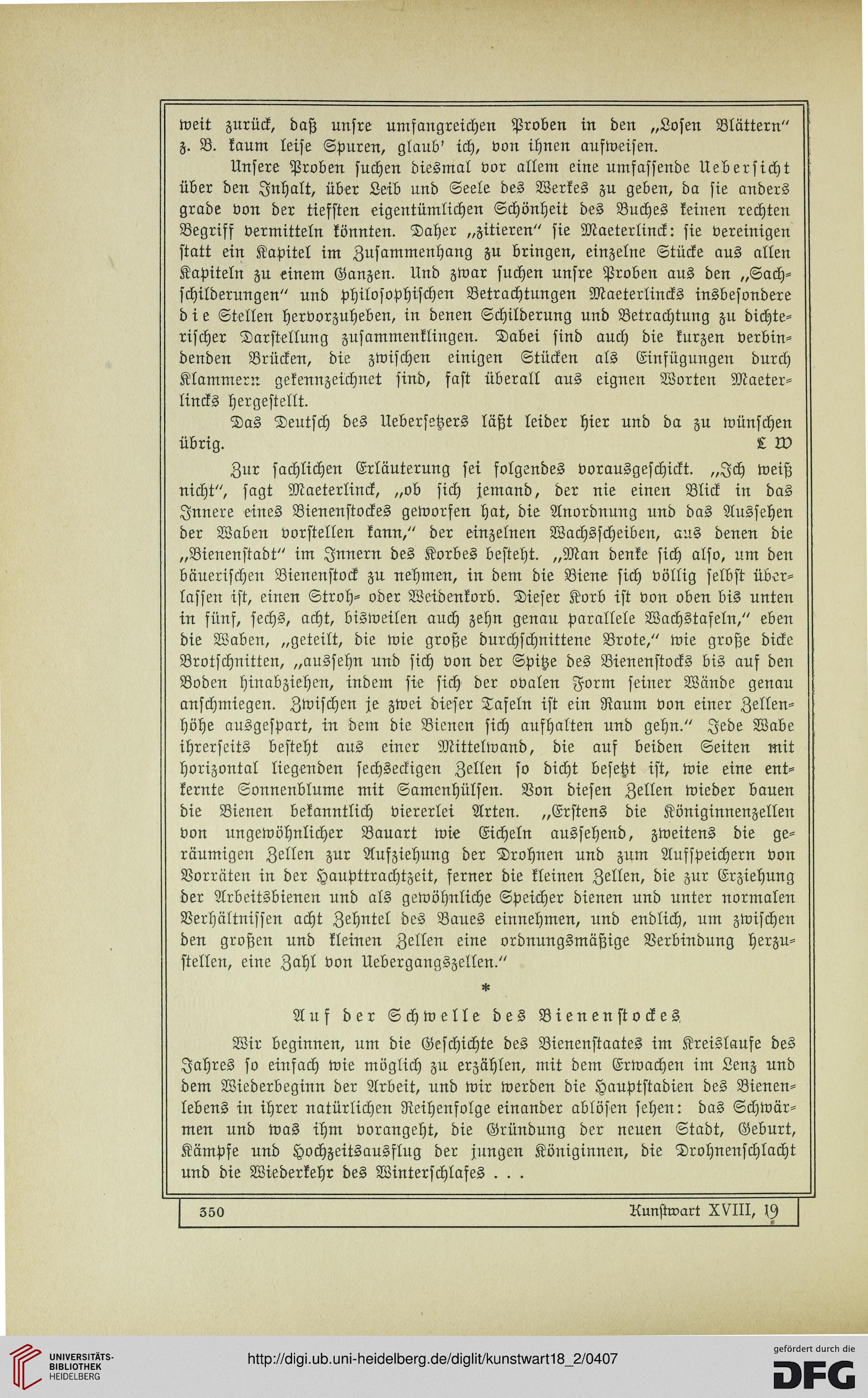weit zurück, daß unsre umfangreichen Proben in den „Losen Blättern"
z. B. kaum leise Spuren, glaub' ich, von ihnen aufweisen.
Unsere Proben suchen diesmal vor allem eine umfassende Uebersicht
über den Jnhalt, über Leib und Seele des Werkes zu geben, da sie anders
grade von der tiefsten eigentümlichen Schönheit des Buches keinen rechten
Begriff vermitteln könnten. Daher „zitieren" sie Maeterlinck: sie vereinigen
statt ein Kapitel im Zusammenhang zu bringen, einzelne Stücke aus allen
Kapiteln zu einem Ganzen. Und zwar suchen unsre Proben aus den „Sach-
schilderungen" und philosophischen Betrachtungen Maeterlincks insbesondere
die Stellen hervorzuheben, in denen Schilderung und Betrachtung zu dichte-
rischer Darstellung zusammenklingen. Dabei sind auch die kurzen verbin-
denden Brücken, die zwischen einigen Stücken als Einfügungen durch
Klammern gekennzeichnet sind, fast überall aus eignen Worten Maeter-
lincks hergestellt.
Das Deutsch des Uebersetzers läßt leider hier und da zu wünschen
übrig. L kv
Zur sachlichen Erläuterung sei folgendes vorausgeschickt. „Jch weiß
nicht", sagt Maeterlinck, „ob sich jemand, der nie einen Blick in das
Jnnere eines Bienenstockes geworfen hat, die Anordnung und das Aussehen
der Waben vorstellen kann," der einzelnen Wachsscheiben, aus denen die
„Bienenstadt" im Jnnern des Korbes besteht. „Man denke sich also, um den
bäuerischen Bienenstock zu nehmen, in dem die Biene sich völlig selbst über-
lassen ist, einen Stroh- oder Weidenkorb. Dieser Korb ist von oben bis unten
in fünf, sechs, acht, bisweilen auch zehn genau parallele Wachstafeln," eben
die Waben, „geteilt, die wie große durchschnittene Brote," wie große dicke
Brotschnitten, „aussehn und sich von der Spitze des Bienenstocks bis auf den
Boden hinabziehen, indem sie sich der ovalen Form seiner Wände genau
anschmiegen. Zwischen je zwei dieser Tafeln ist ein Raum von einer Zellen-
höhe ausgespart, in dem die Bienen sich aufhalten und gehn." Jede Wabe
ihrerseits besteht aus einer Mittelwand, die auf beiden Seiten mit
horizontal liegenden sechseckigen Zellen so dicht besetzt ist, wie eine ent-
kernte Sonnenblume mit Samenhülsen. Von diesen Zellen wieder bauen
die Bienen bekanntlich viererlei Arten. „Erstens die Königinnenzellen
von ungewöhnlicher Bauart wie Eicheln aussehend, zweitens die ge-
räumigen Zellen zur Aufziehung der Drohnen und zum Aufspeichern von
Vorräten in der Haupttrachtzeit, ferner die kleinen Zellen, die zur Erziehung
der Arbeitsbienen und als gewöhnliche Speicher dienen und unter normalen
Verhältnissen acht Zehntel des Baues einnehmen, und endlich, um zwischen
den großen und kleinen Zellen eine ordnungsmäßige Verbindung herzu-
stellen, eine Zahl von Uebergangszellen."
*
Auf der Schwelle des Bienenstockes
Wir beginnen, um die Geschichte des Bienenstaates im Kreislaufe des
Jahres so einfach wie möglich zu erzählen, mit dem Erwachen im Lenz und
dem Wiederbeginn der Arbeit, und wir werden die Hauptstadien des Bienen-
lebens in ihrer natürlichen Reihenfolge einander ablösen sehen: das Schwär-
men und was ihm vorangeht, die Gründung der neuen Stadt, Geburt,
Kämpfe und Hochzeitsausflug der jungen Königinnen, die Drohnenschlacht
und die Wiederkehr des Winterschlafes . . .
350 Runstwart XVIII, l9
z. B. kaum leise Spuren, glaub' ich, von ihnen aufweisen.
Unsere Proben suchen diesmal vor allem eine umfassende Uebersicht
über den Jnhalt, über Leib und Seele des Werkes zu geben, da sie anders
grade von der tiefsten eigentümlichen Schönheit des Buches keinen rechten
Begriff vermitteln könnten. Daher „zitieren" sie Maeterlinck: sie vereinigen
statt ein Kapitel im Zusammenhang zu bringen, einzelne Stücke aus allen
Kapiteln zu einem Ganzen. Und zwar suchen unsre Proben aus den „Sach-
schilderungen" und philosophischen Betrachtungen Maeterlincks insbesondere
die Stellen hervorzuheben, in denen Schilderung und Betrachtung zu dichte-
rischer Darstellung zusammenklingen. Dabei sind auch die kurzen verbin-
denden Brücken, die zwischen einigen Stücken als Einfügungen durch
Klammern gekennzeichnet sind, fast überall aus eignen Worten Maeter-
lincks hergestellt.
Das Deutsch des Uebersetzers läßt leider hier und da zu wünschen
übrig. L kv
Zur sachlichen Erläuterung sei folgendes vorausgeschickt. „Jch weiß
nicht", sagt Maeterlinck, „ob sich jemand, der nie einen Blick in das
Jnnere eines Bienenstockes geworfen hat, die Anordnung und das Aussehen
der Waben vorstellen kann," der einzelnen Wachsscheiben, aus denen die
„Bienenstadt" im Jnnern des Korbes besteht. „Man denke sich also, um den
bäuerischen Bienenstock zu nehmen, in dem die Biene sich völlig selbst über-
lassen ist, einen Stroh- oder Weidenkorb. Dieser Korb ist von oben bis unten
in fünf, sechs, acht, bisweilen auch zehn genau parallele Wachstafeln," eben
die Waben, „geteilt, die wie große durchschnittene Brote," wie große dicke
Brotschnitten, „aussehn und sich von der Spitze des Bienenstocks bis auf den
Boden hinabziehen, indem sie sich der ovalen Form seiner Wände genau
anschmiegen. Zwischen je zwei dieser Tafeln ist ein Raum von einer Zellen-
höhe ausgespart, in dem die Bienen sich aufhalten und gehn." Jede Wabe
ihrerseits besteht aus einer Mittelwand, die auf beiden Seiten mit
horizontal liegenden sechseckigen Zellen so dicht besetzt ist, wie eine ent-
kernte Sonnenblume mit Samenhülsen. Von diesen Zellen wieder bauen
die Bienen bekanntlich viererlei Arten. „Erstens die Königinnenzellen
von ungewöhnlicher Bauart wie Eicheln aussehend, zweitens die ge-
räumigen Zellen zur Aufziehung der Drohnen und zum Aufspeichern von
Vorräten in der Haupttrachtzeit, ferner die kleinen Zellen, die zur Erziehung
der Arbeitsbienen und als gewöhnliche Speicher dienen und unter normalen
Verhältnissen acht Zehntel des Baues einnehmen, und endlich, um zwischen
den großen und kleinen Zellen eine ordnungsmäßige Verbindung herzu-
stellen, eine Zahl von Uebergangszellen."
*
Auf der Schwelle des Bienenstockes
Wir beginnen, um die Geschichte des Bienenstaates im Kreislaufe des
Jahres so einfach wie möglich zu erzählen, mit dem Erwachen im Lenz und
dem Wiederbeginn der Arbeit, und wir werden die Hauptstadien des Bienen-
lebens in ihrer natürlichen Reihenfolge einander ablösen sehen: das Schwär-
men und was ihm vorangeht, die Gründung der neuen Stadt, Geburt,
Kämpfe und Hochzeitsausflug der jungen Königinnen, die Drohnenschlacht
und die Wiederkehr des Winterschlafes . . .
350 Runstwart XVIII, l9