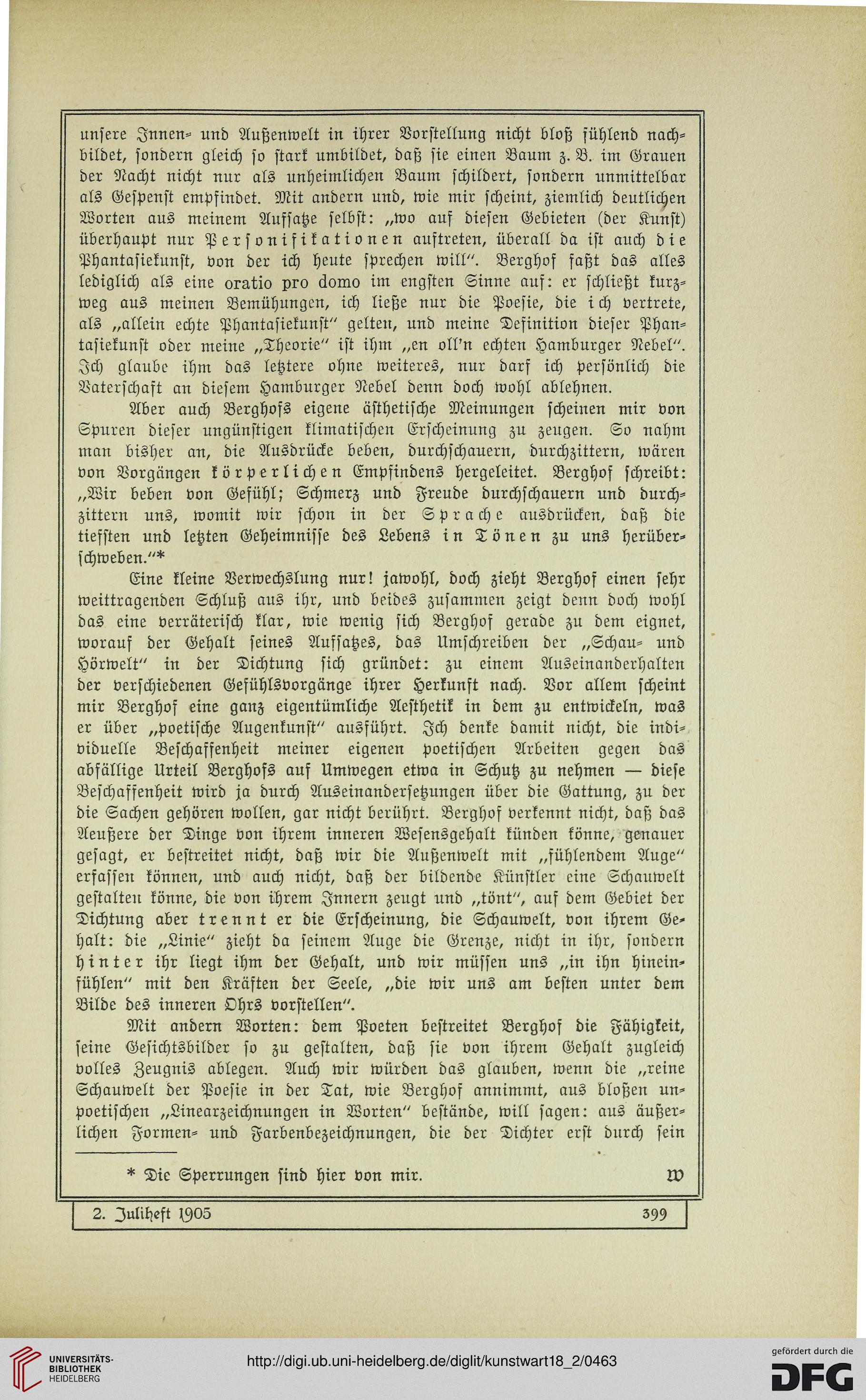unsere Jnnen- und Außenwelt in ihrer Vorstellung nicht bloß fühlend nach-
bildet, sondern gleich so stark umbildet, daß sie einen Baum z. B. im Grauen
der Nacht nicht nnr als unheimlichsn Baum schildert, sondern nnmittelbar
als Gespenst empfindet. Mit andern und, wie mir scheint, ziemlich deutlichen
Worten aus meinem Aufsatze selbst: „wo auf diesen Gebieten (der Knnst)
überhaupt nur Personifikationen auftreten, überall da ist auch die
Phantasiekunst, von der ich hente sprechen will". Berghof faßt das alles
lediglich als eine orntio pro äorao im engsten Sinne auf: er schließt kurz-
weg aus meinen Bemühungen, ich ließe nur die Poesie, die ich vertrete,
als „allein echte Phantasiekunst" gelten, und meine Definition dieser Phan-
tasiekunst oder meine „Theorie" ist ihm „en oll'n echten Hamburger Nebel".
Jch glaube ihm das letztere ohne weiteres, nur darf ich persönlich die
Vaterschaft an diesem Hamburger Nebel denn doch wohl ablehnen.
Aber auch Berghofs eigene ästhetische Meinungen scheinen mir von
Spuren dieser ungünstigen klimatischen Erscheinung zu zeugen. So nahm
man bisher an, die Ausdrücke bebeu, durchschauern, durchzittern, wären
von Vorgängen körperlichen Empfindens hergeleitet. Berghof schreibt:
„Wir beben von Gefühl; Schmerz und Freude durchschauern und durch-
zittern uns, womit wir schon in der Sprache ausdrücken, daß die
tiefsten und letzten Geheimnisse des Lebens in Tönen zu uns herüber-
schweben."*
Eine kleine Verwechslung nur! jawohl, doch zieht Berghos einen sehr
weittragenden Schluß aus ihr, und beides zusammen zeigt denn doch wohl
das eine verräterisch klar, wie wenig sich Berghof gerade zu dem eignet,
worauf der Gehalt seines Aufsatzes, das Umschreiben der „Schau- und
Hörwelt" in der Dichtung sich gründet: zu einem Auseinanderhalten
der verschiedenen Gefühlsvorgänge ihrer Herkunft nach. Vor allem scheint
mir Berghof eine ganz eigentümliche Aesthetik in dem zu entwickeln, was
er über „Poetische Augenkunst" ausführt. Jch denke damit nicht, die indi-
viduelle Beschaffenheit meiner eigenen poetischen Arbeiten gegen das
abfällige Urteil Berghofs auf Umwegen etwa in Schutz zu nehmen — diese
Beschaffenheit wird ja durch Auseinandersetzungen über die Gattung, zu der
die Sachen gehören wollen, gar nicht berührt. Berghof verkennt nicht, daß das
Aeußere der Dinge von ihrem inneren Wesensgehalt künden könne, genauer
gesagt, er bestreitet nicht, daß wir die Außenwelt mit „fühlendem Auge"
erfasseu können, und auch nicht, daß der bildende Wnstler eine Schauwelt
gestalteu köune, die von ihrem Jnnern zeugt und „tönt", auf dem Gebiet der
Dichtung aber trennt er die Erscheinung, die Schauwelt, von ihrem Ge-
halt: die „Linie" zieht da seinem Auge die Grenze, nicht in ihr, sondern
hinter ihr liegt ihm der Gehalt, und wir müssen uns „in ihn hinein-
fühlen" mit den Kräften der Seele, „die wir uns am besten unter dem
Bilde des inneren Ohrs vorstellen".
Mit andern Worten: dem Poeten bestreitet Berghof die Fähigkeit,
seine Gesichtsbilder so zu gestalten, daß sie von ihrem Gehalt zugleich
volles Zeugnis ablegen. Auch wir würden das glauben, wenn die „reine
Schauwelt der Poesie in der Tat, wie Berghof annimmt, aus bloßen un-
poetischen „Linearzeichnungen in Worten" bestände, will sagen: aus äußer-
lichen Formen- und Farbenbezeichnungen, die der Dichter erst durch sein
* Die Sperrungen sind hier von mir. lv
2. Iuliheft lZOö 399
bildet, sondern gleich so stark umbildet, daß sie einen Baum z. B. im Grauen
der Nacht nicht nnr als unheimlichsn Baum schildert, sondern nnmittelbar
als Gespenst empfindet. Mit andern und, wie mir scheint, ziemlich deutlichen
Worten aus meinem Aufsatze selbst: „wo auf diesen Gebieten (der Knnst)
überhaupt nur Personifikationen auftreten, überall da ist auch die
Phantasiekunst, von der ich hente sprechen will". Berghof faßt das alles
lediglich als eine orntio pro äorao im engsten Sinne auf: er schließt kurz-
weg aus meinen Bemühungen, ich ließe nur die Poesie, die ich vertrete,
als „allein echte Phantasiekunst" gelten, und meine Definition dieser Phan-
tasiekunst oder meine „Theorie" ist ihm „en oll'n echten Hamburger Nebel".
Jch glaube ihm das letztere ohne weiteres, nur darf ich persönlich die
Vaterschaft an diesem Hamburger Nebel denn doch wohl ablehnen.
Aber auch Berghofs eigene ästhetische Meinungen scheinen mir von
Spuren dieser ungünstigen klimatischen Erscheinung zu zeugen. So nahm
man bisher an, die Ausdrücke bebeu, durchschauern, durchzittern, wären
von Vorgängen körperlichen Empfindens hergeleitet. Berghof schreibt:
„Wir beben von Gefühl; Schmerz und Freude durchschauern und durch-
zittern uns, womit wir schon in der Sprache ausdrücken, daß die
tiefsten und letzten Geheimnisse des Lebens in Tönen zu uns herüber-
schweben."*
Eine kleine Verwechslung nur! jawohl, doch zieht Berghos einen sehr
weittragenden Schluß aus ihr, und beides zusammen zeigt denn doch wohl
das eine verräterisch klar, wie wenig sich Berghof gerade zu dem eignet,
worauf der Gehalt seines Aufsatzes, das Umschreiben der „Schau- und
Hörwelt" in der Dichtung sich gründet: zu einem Auseinanderhalten
der verschiedenen Gefühlsvorgänge ihrer Herkunft nach. Vor allem scheint
mir Berghof eine ganz eigentümliche Aesthetik in dem zu entwickeln, was
er über „Poetische Augenkunst" ausführt. Jch denke damit nicht, die indi-
viduelle Beschaffenheit meiner eigenen poetischen Arbeiten gegen das
abfällige Urteil Berghofs auf Umwegen etwa in Schutz zu nehmen — diese
Beschaffenheit wird ja durch Auseinandersetzungen über die Gattung, zu der
die Sachen gehören wollen, gar nicht berührt. Berghof verkennt nicht, daß das
Aeußere der Dinge von ihrem inneren Wesensgehalt künden könne, genauer
gesagt, er bestreitet nicht, daß wir die Außenwelt mit „fühlendem Auge"
erfasseu können, und auch nicht, daß der bildende Wnstler eine Schauwelt
gestalteu köune, die von ihrem Jnnern zeugt und „tönt", auf dem Gebiet der
Dichtung aber trennt er die Erscheinung, die Schauwelt, von ihrem Ge-
halt: die „Linie" zieht da seinem Auge die Grenze, nicht in ihr, sondern
hinter ihr liegt ihm der Gehalt, und wir müssen uns „in ihn hinein-
fühlen" mit den Kräften der Seele, „die wir uns am besten unter dem
Bilde des inneren Ohrs vorstellen".
Mit andern Worten: dem Poeten bestreitet Berghof die Fähigkeit,
seine Gesichtsbilder so zu gestalten, daß sie von ihrem Gehalt zugleich
volles Zeugnis ablegen. Auch wir würden das glauben, wenn die „reine
Schauwelt der Poesie in der Tat, wie Berghof annimmt, aus bloßen un-
poetischen „Linearzeichnungen in Worten" bestände, will sagen: aus äußer-
lichen Formen- und Farbenbezeichnungen, die der Dichter erst durch sein
* Die Sperrungen sind hier von mir. lv
2. Iuliheft lZOö 399