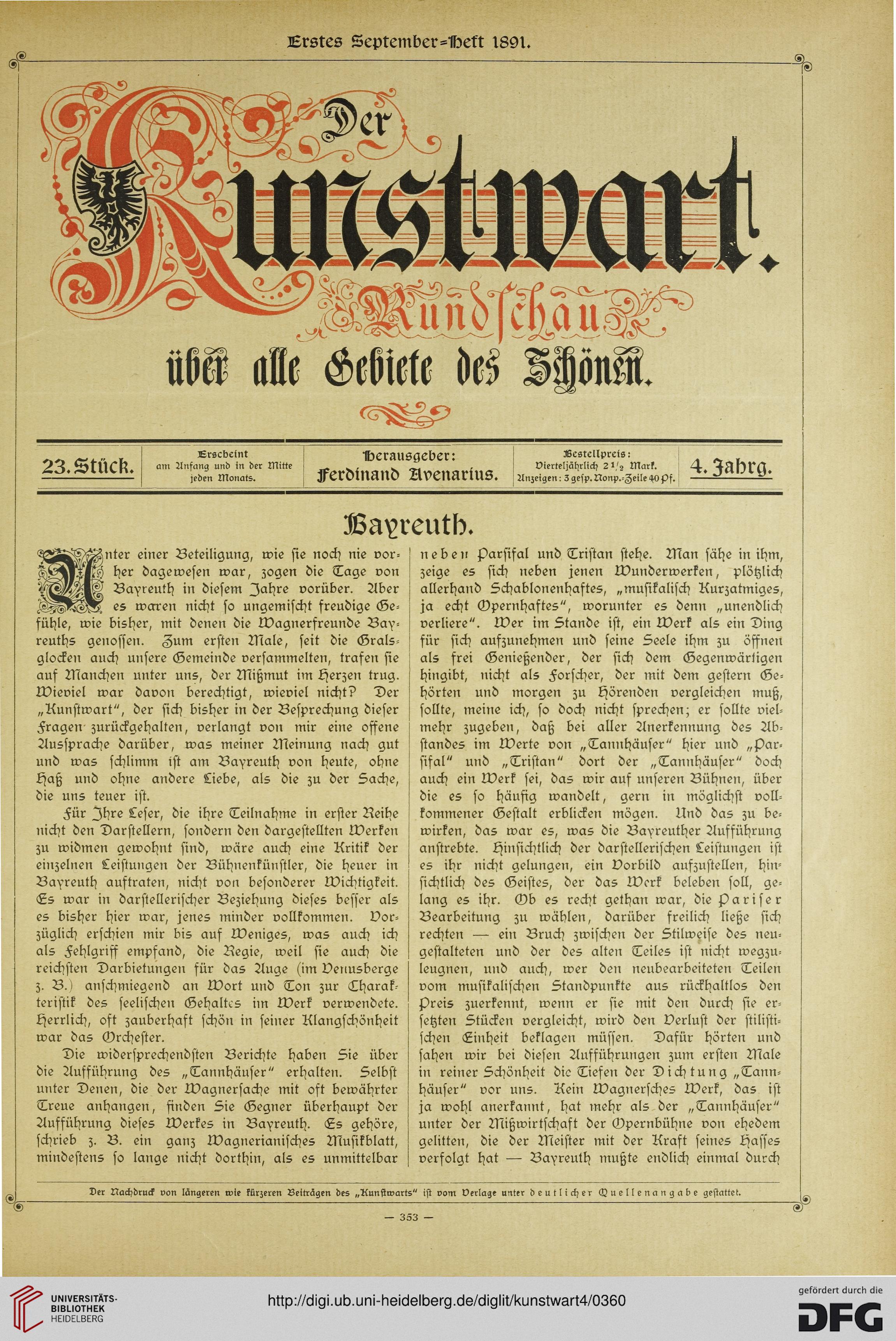Lrstes September-Dett 1691.
23.Stück.
Lrscbeinl
am Anfang und in der Mitte
Derausgeber:
zferdinand Nvenarius.
Wesleilpreis:
vierteljährlich 21/2 Mark.
Ku^reutb
V3^?Mnter einer Beteiligung, wie sie noch nie vor-
her dagewesen war, zogen die Tage von
Bayreuth in diesem Iahre vorüber. Aber
es waren nicht so ungemischt sreudige Ge-
fühle, wie bisher, mit denen die wagnersreunde Bay-
reuths genossen. Zum ersten Alale, seit die Grals-
glocken auch unsere Gemeinde versammelten, trasen sie
aus Wanchen unter uns, der Blißmut im L)erzen trug.
wieviel war davon berechtigt, wieviel nicht? Der
„Runstwart", der sich bisher in der Besprechung dieser
Lragen zurückgehalten, verlangt voil mir eine offene
Aussprache darüber, was meiner Aleinung nach gut
und was schlimm ist am Bayreuth von heute, ohne
Haß und ohne andere Liebe, als die zu der 6ache,
die uns teuer ist.
Für Zhre Leser, die ihre Teilnahme in erster Neihe
nicht den Darstellern, sondern den dargestellten werken
zu widmen gewohnt sind, wäre auch eine Kritik der
einzelnen Leistungen der Bühnenkünstler, die heuer in
Bayreuth auftraten, nicht von besonderer wichtigkeit.
Ls war in darstellerischer Beziehung dieses besser als
es bisher hier war, jenes minder vollkommen. Dor-
züglich erschien mir bis aus Weniges, was auch ich
als Fehlgriff empsand, die Begie, weil sie auch die
reichsten Darbietungeil für das Auge (im Venusberge
z. B.) anschmiegend an wort und Ton zur Lharak-
teristik des seelischen Gehaltcs im werk verwendete.
Ljerrlich, ost zauberhaft schön in seiner Rlangschönheit
war das Grchester.
Die widersprechendsten Berichte haben 6>ie über
die Aufführung des „Tannhäuser" erhalten. 6elbst
unter Denen, die der Wagnersache mit oft bewährter
Treue anhangen, ffuden 6ie Gegner überhaupt der
Aufführung dieses werkes in Bayreuth. Ts gehöre,
schrieb z. B. ein ganz wagnerianisches Musikblatt,
mindestens so lange nicht dorthin, als es unmittelbar
neben Parsifal und Tristan stehe. Alan sähe in ihm,
zeige es sich neben fenen Wunderwerken, plötzlich
allerhand Schablonenhaftes, „musikalisch Rurzatmiges,
ja echt Gpernhaftes", worunter es denn „unendlich
verliere". wer im Stande ist, ein werk als ein Ding
für sich aufzunehmen und seine 6eele ihm zu öffnen
als frei Genießender, der sich dem Gegenwärtigen
hingibt, nicht als Forscher, der mit dem gestern Ge-
hörten und morgen zu Hörenden vergleichen muß,
sollte, meine ich, so doch nicht sprechen; er sollte viel-
mehr zugeben, daß bei aller Anerkennung des Ab-
standes im werte von „Tannhäuser" hier und „par-
sifal" und „Tristan" dort der „Tannhäuser" doch
auch ein Werk sei, das wir auf unseren Bühnen, über
die es so häufig wandelt, gern in möglichst voll-
kommener Gestalt erblicken mögen. Und das zu be-
wirken, das war es, was die Bayreuther Ausführung
anstrebte. Lffnsichtlich der darstellerischen Leistungen ist
es ihr nicht gelungen, ein Dorbild aufzustellen, hin-
sichtlich des Geistes, der das werk beleben soll, ge-
lang es ihr. Gb es recht gethan war, die pariser
Bearbeitung zu wählen, darüber freilich ließe sich
rechten — ein Bruch zwischen der Stilweise des neu-
gestalteten und der des alten Teiles ist nicht wegzu-
leugnen, und auch, wer den neubearbeiteten Teilen
vom musikalischen Standpunkte aus rückhaltlos den
preis zuerkennt, wenn er sie mit den durch sie er-
setzten Stücken vergleicht, wird den Verlust der stilisti-
schen Linheit beklagen müssen. Dafür hörten und
sahen wir bei diesen Aufführungen zum ersten Male
in reiner Schönheit die Tiefen der Dichtung „Tann-
häuser" vor uns. Aein wagnersches werk, das ist
ja wohl anerkannt, hat mehr als der „Tannhäuser"
unter der Alißwirtschaft der Opernbühne von ehedem
gelitten, die der Alleister mit der Araft seines bjasses
verfolgt hat — Bayreuth mußte endlich einmal durch
— 353 —
23.Stück.
Lrscbeinl
am Anfang und in der Mitte
Derausgeber:
zferdinand Nvenarius.
Wesleilpreis:
vierteljährlich 21/2 Mark.
Ku^reutb
V3^?Mnter einer Beteiligung, wie sie noch nie vor-
her dagewesen war, zogen die Tage von
Bayreuth in diesem Iahre vorüber. Aber
es waren nicht so ungemischt sreudige Ge-
fühle, wie bisher, mit denen die wagnersreunde Bay-
reuths genossen. Zum ersten Alale, seit die Grals-
glocken auch unsere Gemeinde versammelten, trasen sie
aus Wanchen unter uns, der Blißmut im L)erzen trug.
wieviel war davon berechtigt, wieviel nicht? Der
„Runstwart", der sich bisher in der Besprechung dieser
Lragen zurückgehalten, verlangt voil mir eine offene
Aussprache darüber, was meiner Aleinung nach gut
und was schlimm ist am Bayreuth von heute, ohne
Haß und ohne andere Liebe, als die zu der 6ache,
die uns teuer ist.
Für Zhre Leser, die ihre Teilnahme in erster Neihe
nicht den Darstellern, sondern den dargestellten werken
zu widmen gewohnt sind, wäre auch eine Kritik der
einzelnen Leistungen der Bühnenkünstler, die heuer in
Bayreuth auftraten, nicht von besonderer wichtigkeit.
Ls war in darstellerischer Beziehung dieses besser als
es bisher hier war, jenes minder vollkommen. Dor-
züglich erschien mir bis aus Weniges, was auch ich
als Fehlgriff empsand, die Begie, weil sie auch die
reichsten Darbietungeil für das Auge (im Venusberge
z. B.) anschmiegend an wort und Ton zur Lharak-
teristik des seelischen Gehaltcs im werk verwendete.
Ljerrlich, ost zauberhaft schön in seiner Rlangschönheit
war das Grchester.
Die widersprechendsten Berichte haben 6>ie über
die Aufführung des „Tannhäuser" erhalten. 6elbst
unter Denen, die der Wagnersache mit oft bewährter
Treue anhangen, ffuden 6ie Gegner überhaupt der
Aufführung dieses werkes in Bayreuth. Ts gehöre,
schrieb z. B. ein ganz wagnerianisches Musikblatt,
mindestens so lange nicht dorthin, als es unmittelbar
neben Parsifal und Tristan stehe. Alan sähe in ihm,
zeige es sich neben fenen Wunderwerken, plötzlich
allerhand Schablonenhaftes, „musikalisch Rurzatmiges,
ja echt Gpernhaftes", worunter es denn „unendlich
verliere". wer im Stande ist, ein werk als ein Ding
für sich aufzunehmen und seine 6eele ihm zu öffnen
als frei Genießender, der sich dem Gegenwärtigen
hingibt, nicht als Forscher, der mit dem gestern Ge-
hörten und morgen zu Hörenden vergleichen muß,
sollte, meine ich, so doch nicht sprechen; er sollte viel-
mehr zugeben, daß bei aller Anerkennung des Ab-
standes im werte von „Tannhäuser" hier und „par-
sifal" und „Tristan" dort der „Tannhäuser" doch
auch ein Werk sei, das wir auf unseren Bühnen, über
die es so häufig wandelt, gern in möglichst voll-
kommener Gestalt erblicken mögen. Und das zu be-
wirken, das war es, was die Bayreuther Ausführung
anstrebte. Lffnsichtlich der darstellerischen Leistungen ist
es ihr nicht gelungen, ein Dorbild aufzustellen, hin-
sichtlich des Geistes, der das werk beleben soll, ge-
lang es ihr. Gb es recht gethan war, die pariser
Bearbeitung zu wählen, darüber freilich ließe sich
rechten — ein Bruch zwischen der Stilweise des neu-
gestalteten und der des alten Teiles ist nicht wegzu-
leugnen, und auch, wer den neubearbeiteten Teilen
vom musikalischen Standpunkte aus rückhaltlos den
preis zuerkennt, wenn er sie mit den durch sie er-
setzten Stücken vergleicht, wird den Verlust der stilisti-
schen Linheit beklagen müssen. Dafür hörten und
sahen wir bei diesen Aufführungen zum ersten Male
in reiner Schönheit die Tiefen der Dichtung „Tann-
häuser" vor uns. Aein wagnersches werk, das ist
ja wohl anerkannt, hat mehr als der „Tannhäuser"
unter der Alißwirtschaft der Opernbühne von ehedem
gelitten, die der Alleister mit der Araft seines bjasses
verfolgt hat — Bayreuth mußte endlich einmal durch
— 353 —