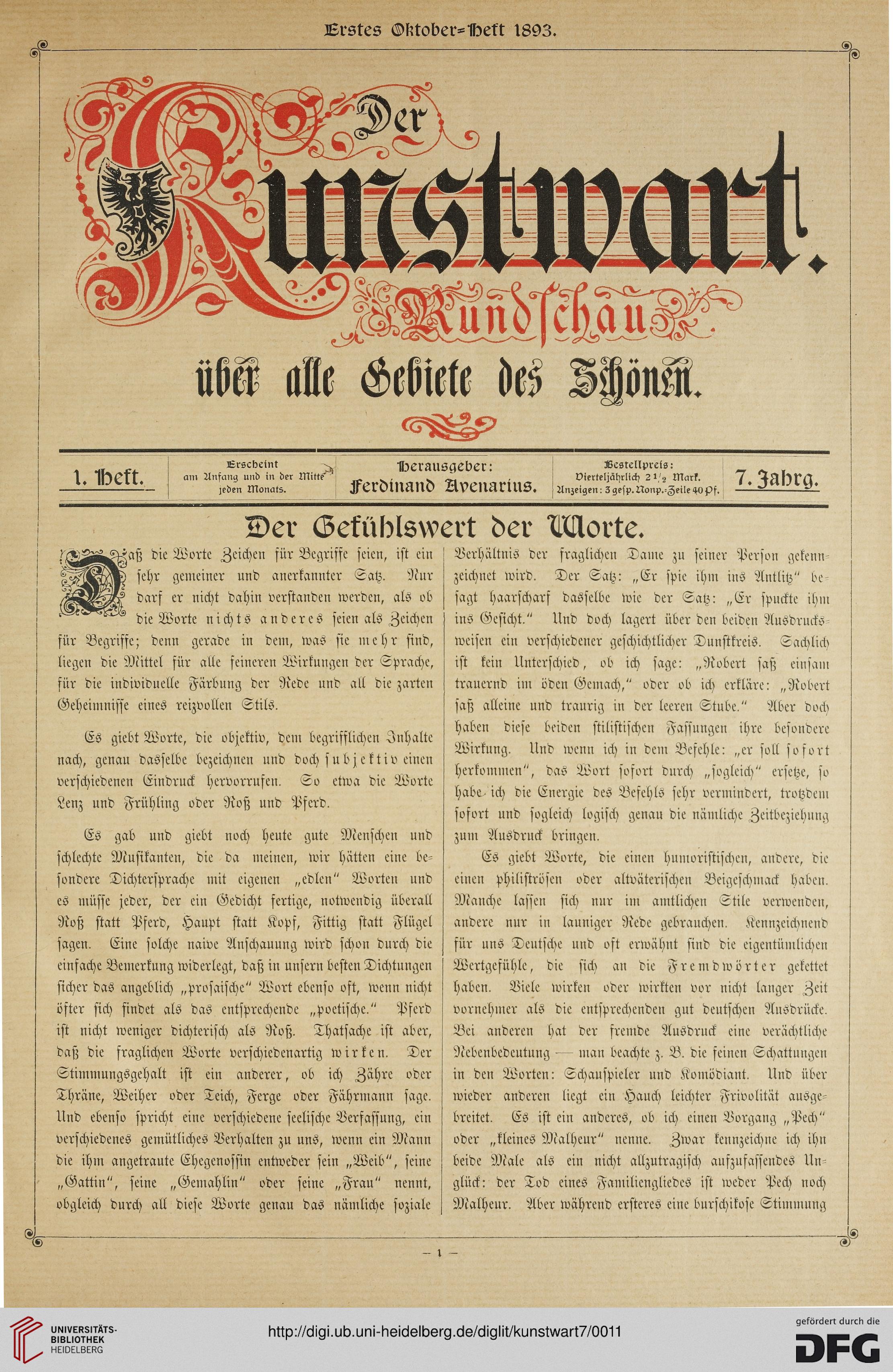Lrstes Gktober-Dett 1SS3.
1. Dekt.
Lrscbetnk ^
Derausgever:
Ferdinand Nvennrius.
Kcskcllprets:
vierteljährltch 2 t/2 Mnrk. ^
Der Getüklsvvert der Morte.
die Worte Zeichen für Begrisfe seien, ist ein
^ sthr gemeiner und anerkannter Satz. Nnr
darf er nicht dahin verstanden werden, als ob
nichts anderes seien als Zeichen
für Begrisfe; denn gerade in dem, was sie mehr sind,
liegen die Mittel für alle feineren Wirkungen der Sprache,
für die individuelle Färbung der Rede und all die zarten
Geheimnisfe eines reizvollen Stils.
Es giebt Worte, die objektiv, dem begrifflichen Jnhalte
nach, genau dasselbe bezeichnen und doch fubjektiv einen
verfchiedenen Eindruck hervorrufen. So etwa die Worte
Lenz und Frühling oder Roß und Pferd.
Es gab und giebt noch heute gute Menfchen und
fchlechte Musikanten, die da meinen, wir hätten eine be-
sondere Dichtersprache mit eigenen „edlen" Worten und
es müsfe jeder, der ein Gedicht fertige, notwendig überall
Roß statt Pferd, Haupt statt Kopf, Fittig statt Flügel
sagen. Eine folche naive Anschauung wird schon durch die
einfache Bemerkung widerlegt, daß in unsern besten Dichtungen
sicher das angeblich „prosaische" Wort ebenfo oft, wenn nicht
öfter sich findet als das entsprechende „poetische." Pferd
ist nicht weniger dichterisch als Roß. Thatsache ist aber,
daß die fraglichen Worte verfchiedenartig wirken. Der
Stimmungsgehalt ist ein anderer, ob ich Zähre oder
Thräne, Weiher oder Teich, Ferge oder Fährmann sage.
Und ebenso spricht eine verschiedene feelifche Berfasfung, ein
verschiedenes gemütliches Verhalten zu uns, wenn eiu Mann
die ihm angetraute Ehegenossin entweder fein „Weib", seine
„Gattin", feine „Gemahlin" oder feine „Frau" nennt,
obgleich durch all diese Worte genau das nämliche foziale
^-
Verhältnis der fraglichen Dame zu seiner Person gekenn
zeichnet wird. Der Satz: „Er spie ihm ins Antlitz" be-
sagt haarscharf dasselbe wie der Satz: „Er spnckte ihm
ins Gestcht." Und doch lagert über den beiden Ausdrucks-
weisen ein verschiedener geschichtlicher Dunstkreis. Sachlich
ist kein Unterschied, vb ich sage: „Robert saß einsam
trauernd im öden Gemach," oder ob ich erkläre: „Robert
saß alleine und traurig in der leeren Stube." Aber doch
haben diese beiden stilistischen Fassungen ihre besondere
Wirkung. Und wenn ich in dem Befehle: „er soll sofort
herkommen", das Wort sofort durch „sogleich" ersetze, so
habeüich die Energie des Befehls sehr vermindert, trotzdem
sofort und sogleich logisch genau die nämliche Zeitbeziehung
zum Ausdruck bringen.
Es giebt Worte, die einen humoristischen, andere, die
einen philiströsen oder altväterischen Beigeschmack haben.
Manche lassen sich nur im amtlichen Stile verwenden,
andere nur in launiger Rede gebrauchen. Kennzeichnend
für uns Deutsche und ost erwähnt sind die eigentümlichen
Wertgesühle, die sich an die Fremdwörter gekettet
haben. Viele wirken oder wirkten vor nicht langer Zeit
vornehmer als die entsprechenden gut deutschen Ausdrücke.
Bei anderen hat der fremde Ausdruck eine verächtliche
Nebenbedeutung -— man beachte z. B. die feinen Schattungen
in den Worten: Schauspieler und Komödiant. Und über
wieder anderen liegt ein Hauch leichter Frivolität ausge-
breitet. Es ist ein anderes, ob ich einen Vorgang „Pech"
oder „kleines Malheur" nenne. Zwar kennzeichne ich ihn
beide Male als ein nicht allzutragifch aufzufasfendes Un-
glück: der Tod eines Familiengliedes ist weder Pech noch
Malheur. Aber während ersteres eine burschikose Stimmung
M Kkßiktk i>k§ LHöS.
- r -
1. Dekt.
Lrscbetnk ^
Derausgever:
Ferdinand Nvennrius.
Kcskcllprets:
vierteljährltch 2 t/2 Mnrk. ^
Der Getüklsvvert der Morte.
die Worte Zeichen für Begrisfe seien, ist ein
^ sthr gemeiner und anerkannter Satz. Nnr
darf er nicht dahin verstanden werden, als ob
nichts anderes seien als Zeichen
für Begrisfe; denn gerade in dem, was sie mehr sind,
liegen die Mittel für alle feineren Wirkungen der Sprache,
für die individuelle Färbung der Rede und all die zarten
Geheimnisfe eines reizvollen Stils.
Es giebt Worte, die objektiv, dem begrifflichen Jnhalte
nach, genau dasselbe bezeichnen und doch fubjektiv einen
verfchiedenen Eindruck hervorrufen. So etwa die Worte
Lenz und Frühling oder Roß und Pferd.
Es gab und giebt noch heute gute Menfchen und
fchlechte Musikanten, die da meinen, wir hätten eine be-
sondere Dichtersprache mit eigenen „edlen" Worten und
es müsfe jeder, der ein Gedicht fertige, notwendig überall
Roß statt Pferd, Haupt statt Kopf, Fittig statt Flügel
sagen. Eine folche naive Anschauung wird schon durch die
einfache Bemerkung widerlegt, daß in unsern besten Dichtungen
sicher das angeblich „prosaische" Wort ebenfo oft, wenn nicht
öfter sich findet als das entsprechende „poetische." Pferd
ist nicht weniger dichterisch als Roß. Thatsache ist aber,
daß die fraglichen Worte verfchiedenartig wirken. Der
Stimmungsgehalt ist ein anderer, ob ich Zähre oder
Thräne, Weiher oder Teich, Ferge oder Fährmann sage.
Und ebenso spricht eine verschiedene feelifche Berfasfung, ein
verschiedenes gemütliches Verhalten zu uns, wenn eiu Mann
die ihm angetraute Ehegenossin entweder fein „Weib", seine
„Gattin", feine „Gemahlin" oder feine „Frau" nennt,
obgleich durch all diese Worte genau das nämliche foziale
^-
Verhältnis der fraglichen Dame zu seiner Person gekenn
zeichnet wird. Der Satz: „Er spie ihm ins Antlitz" be-
sagt haarscharf dasselbe wie der Satz: „Er spnckte ihm
ins Gestcht." Und doch lagert über den beiden Ausdrucks-
weisen ein verschiedener geschichtlicher Dunstkreis. Sachlich
ist kein Unterschied, vb ich sage: „Robert saß einsam
trauernd im öden Gemach," oder ob ich erkläre: „Robert
saß alleine und traurig in der leeren Stube." Aber doch
haben diese beiden stilistischen Fassungen ihre besondere
Wirkung. Und wenn ich in dem Befehle: „er soll sofort
herkommen", das Wort sofort durch „sogleich" ersetze, so
habeüich die Energie des Befehls sehr vermindert, trotzdem
sofort und sogleich logisch genau die nämliche Zeitbeziehung
zum Ausdruck bringen.
Es giebt Worte, die einen humoristischen, andere, die
einen philiströsen oder altväterischen Beigeschmack haben.
Manche lassen sich nur im amtlichen Stile verwenden,
andere nur in launiger Rede gebrauchen. Kennzeichnend
für uns Deutsche und ost erwähnt sind die eigentümlichen
Wertgesühle, die sich an die Fremdwörter gekettet
haben. Viele wirken oder wirkten vor nicht langer Zeit
vornehmer als die entsprechenden gut deutschen Ausdrücke.
Bei anderen hat der fremde Ausdruck eine verächtliche
Nebenbedeutung -— man beachte z. B. die feinen Schattungen
in den Worten: Schauspieler und Komödiant. Und über
wieder anderen liegt ein Hauch leichter Frivolität ausge-
breitet. Es ist ein anderes, ob ich einen Vorgang „Pech"
oder „kleines Malheur" nenne. Zwar kennzeichne ich ihn
beide Male als ein nicht allzutragifch aufzufasfendes Un-
glück: der Tod eines Familiengliedes ist weder Pech noch
Malheur. Aber während ersteres eine burschikose Stimmung
M Kkßiktk i>k§ LHöS.
- r -