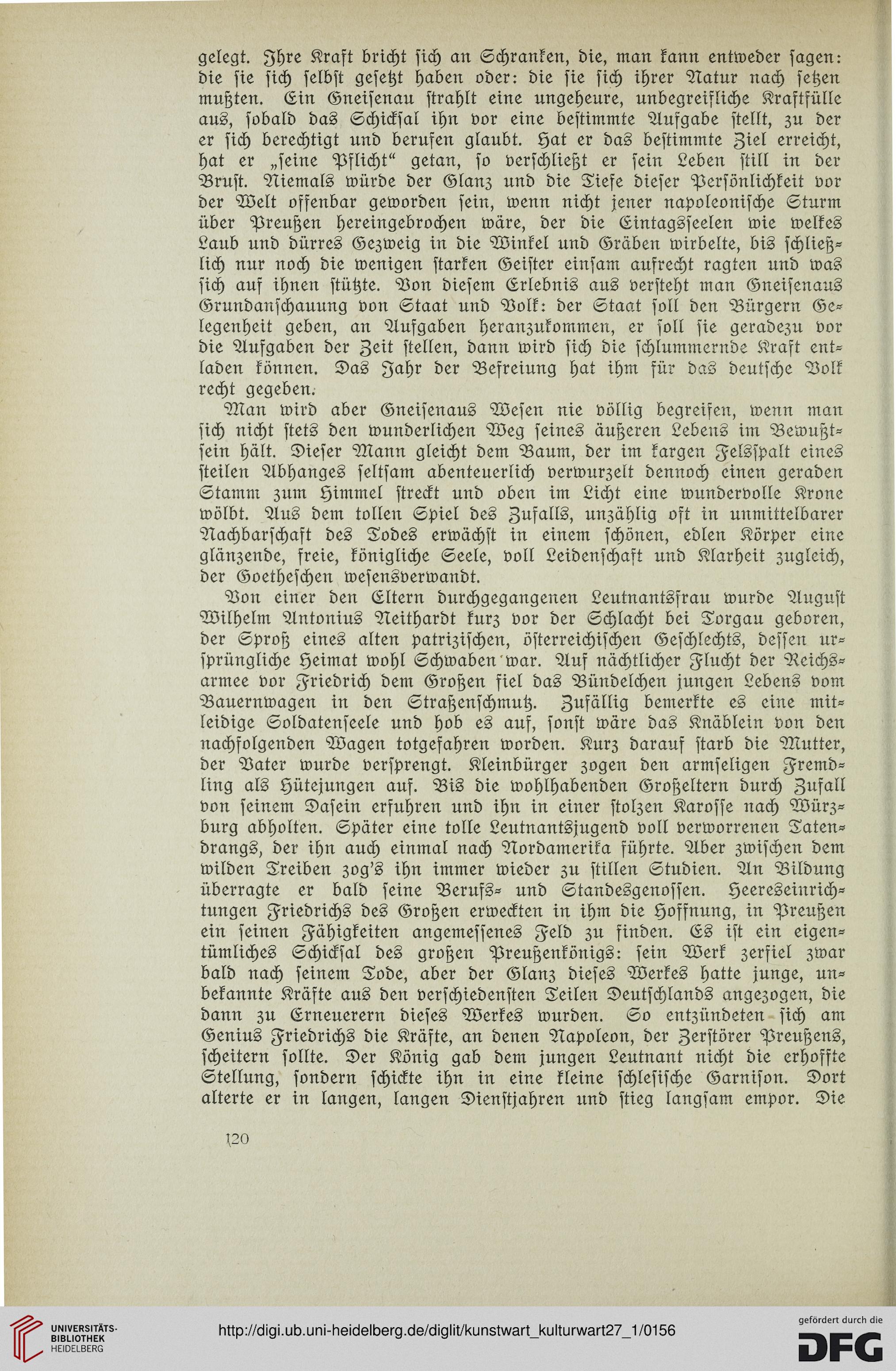gelegt. Ihre Kraft bricht sich an Schranken, die, man kann entweder sagen:
die sie sich selbst gesetzt haben oder: die sie sich ihrer Natur nach setzen
mußten. <Lin Gneisenau strahlt eine ungeheure, unbegreisliche Kraftsülle
aus, sobald das Schicksal ihn vor eine bestimmte Aufgabe stellt, zu der
er sich berechtigt und berusen glaubt. Hat er das bestimmte Ziel erreicht,
hat er „seine Pflicht" getan, so verschließt er sein Leben still in der
Brust. Niemals würde der Glanz und die Tiefe dieser Persönlichkeit vor
der Welt offenbar geworden sein, wenn nicht jener napoleonische Sturm
über Preußen hereingebrochen wäre, der die Eintagsseelen wie welkes
Laub und dürres Gezweig in die Winkel und Gräben wirbelte, bis schließ-
lich nur noch die wenigen starken Geister einsam aufrecht ragten und was
sich aus ihnen stützte. Von diesem Erlebnis aus versteht man Gneisenaus
Grundanschauung von Staat und Volk: der Staat soll den Bürgern Ge-
legenheit geben, an Aufgaben heranzukommen, er soll sie geradezu vor
die Aufgaben der Zeit stellen, dann wird sich die schlummernde Krast ent-
laden können. Das Iahr der Befreiung hat ihm sür das deutsche Volk
recht gegeben.
Man wird aber Gneisenaus Wesen nie völlig begreisen, wenn man
sich nicht stets den wunderlichen Weg seines äußeren Lebens im Bewußt-
sein hält. Dieser Mann gleicht dem Baum, der im kargen Felsspalt eines
steilen Abhanges seltsam abenteuerlich verwurzelt dennoch einen geraden
Stamm zum Himmel streckt und oben im Licht eine wundervolle Krone
wölbt. Aus dem tollen Spiel des Zufalls, unzählig ost in unmittelbarer
Nachbarschast des Todes erwächst in einem schönen, edlen Körper eine
glänzende, freie, königliche Seele, voll Leidenschast und Klarheit zugleich,
der Goetheschen wesensverwandt.
Von einer den Eltern durchgegangenen Leutnantsfrau wurde August
Wilhelm Antonius Neithardt kurz vor der Schlacht bei Torgau geboren,
der Sproß eines alten patrizischen, österreichischen Geschlechts, dessen ur-
sprüngliche Heimat wohl Schwaben'war. Auf nächtlicher Flucht der Reichs-
armee vor Friedrich dem Großen fiel das Bündelchen jungen Lebens vom
Bauernwagen in den Straßenschmutz. Zusällig bemerkte es eine mit-
leidige Soldatenseele und hob es auf, sonst wäre das Knäblein von den
nachfolgenden Wagen totgefahren worden. Kurz darauf starb die Mutter,
der Vater wurde versprengt. Kleinbürger zogen den armseligen Fremd-
ling als Hütejungen auf. Bis die wohlhabenden Großeltern durch Zufall
von seinem Dasein erfuhren und ihn in einer stolzen Karosse nach Würz-
burg abholten. Später eine tolle Leutnantsjugend voll verworrenen Taten-
drangs, der ihn auch einmal nach Nordamerika sührte. Aber zwischen dem
wilden Treiben zog's ihn immer wieder zu stillen Studien. An Bildung
überragte er bald seine Berufs- und Standesgenossen. Heereseinrich-
tungen Friedrichs des Großen erweckten in ihm die Hosfnung, in Preußen
ein seinen Fähigkeiten angemessenes Feld zu finden. Es ist ein eigen-
tümliches Schicksal des großen Preußenkönigs: sein Werk zersiel zwar
bald nach seinem Tode, aber der Glanz dieses Werkes hatte junge, un-
bekannte Kräfte aus den verschiedensten Teilen Deutschlands angezogen, die
dann zu Erneuerern dieses Werkes wurden. So entzündeten sich am
Genius Friedrichs die Kräfte, an denen Napoleon, der Zerstörer Preußens,
scheitern sollte. Der König gab dem jungen Leutnant nicht die erhosfte
Stellung, sondern schickte ihn in eine kleine schlesische Garnison. Dort
alterte er in langen, langen Dienstjahren und stieg langsam empor. Die
t20
die sie sich selbst gesetzt haben oder: die sie sich ihrer Natur nach setzen
mußten. <Lin Gneisenau strahlt eine ungeheure, unbegreisliche Kraftsülle
aus, sobald das Schicksal ihn vor eine bestimmte Aufgabe stellt, zu der
er sich berechtigt und berusen glaubt. Hat er das bestimmte Ziel erreicht,
hat er „seine Pflicht" getan, so verschließt er sein Leben still in der
Brust. Niemals würde der Glanz und die Tiefe dieser Persönlichkeit vor
der Welt offenbar geworden sein, wenn nicht jener napoleonische Sturm
über Preußen hereingebrochen wäre, der die Eintagsseelen wie welkes
Laub und dürres Gezweig in die Winkel und Gräben wirbelte, bis schließ-
lich nur noch die wenigen starken Geister einsam aufrecht ragten und was
sich aus ihnen stützte. Von diesem Erlebnis aus versteht man Gneisenaus
Grundanschauung von Staat und Volk: der Staat soll den Bürgern Ge-
legenheit geben, an Aufgaben heranzukommen, er soll sie geradezu vor
die Aufgaben der Zeit stellen, dann wird sich die schlummernde Krast ent-
laden können. Das Iahr der Befreiung hat ihm sür das deutsche Volk
recht gegeben.
Man wird aber Gneisenaus Wesen nie völlig begreisen, wenn man
sich nicht stets den wunderlichen Weg seines äußeren Lebens im Bewußt-
sein hält. Dieser Mann gleicht dem Baum, der im kargen Felsspalt eines
steilen Abhanges seltsam abenteuerlich verwurzelt dennoch einen geraden
Stamm zum Himmel streckt und oben im Licht eine wundervolle Krone
wölbt. Aus dem tollen Spiel des Zufalls, unzählig ost in unmittelbarer
Nachbarschast des Todes erwächst in einem schönen, edlen Körper eine
glänzende, freie, königliche Seele, voll Leidenschast und Klarheit zugleich,
der Goetheschen wesensverwandt.
Von einer den Eltern durchgegangenen Leutnantsfrau wurde August
Wilhelm Antonius Neithardt kurz vor der Schlacht bei Torgau geboren,
der Sproß eines alten patrizischen, österreichischen Geschlechts, dessen ur-
sprüngliche Heimat wohl Schwaben'war. Auf nächtlicher Flucht der Reichs-
armee vor Friedrich dem Großen fiel das Bündelchen jungen Lebens vom
Bauernwagen in den Straßenschmutz. Zusällig bemerkte es eine mit-
leidige Soldatenseele und hob es auf, sonst wäre das Knäblein von den
nachfolgenden Wagen totgefahren worden. Kurz darauf starb die Mutter,
der Vater wurde versprengt. Kleinbürger zogen den armseligen Fremd-
ling als Hütejungen auf. Bis die wohlhabenden Großeltern durch Zufall
von seinem Dasein erfuhren und ihn in einer stolzen Karosse nach Würz-
burg abholten. Später eine tolle Leutnantsjugend voll verworrenen Taten-
drangs, der ihn auch einmal nach Nordamerika sührte. Aber zwischen dem
wilden Treiben zog's ihn immer wieder zu stillen Studien. An Bildung
überragte er bald seine Berufs- und Standesgenossen. Heereseinrich-
tungen Friedrichs des Großen erweckten in ihm die Hosfnung, in Preußen
ein seinen Fähigkeiten angemessenes Feld zu finden. Es ist ein eigen-
tümliches Schicksal des großen Preußenkönigs: sein Werk zersiel zwar
bald nach seinem Tode, aber der Glanz dieses Werkes hatte junge, un-
bekannte Kräfte aus den verschiedensten Teilen Deutschlands angezogen, die
dann zu Erneuerern dieses Werkes wurden. So entzündeten sich am
Genius Friedrichs die Kräfte, an denen Napoleon, der Zerstörer Preußens,
scheitern sollte. Der König gab dem jungen Leutnant nicht die erhosfte
Stellung, sondern schickte ihn in eine kleine schlesische Garnison. Dort
alterte er in langen, langen Dienstjahren und stieg langsam empor. Die
t20