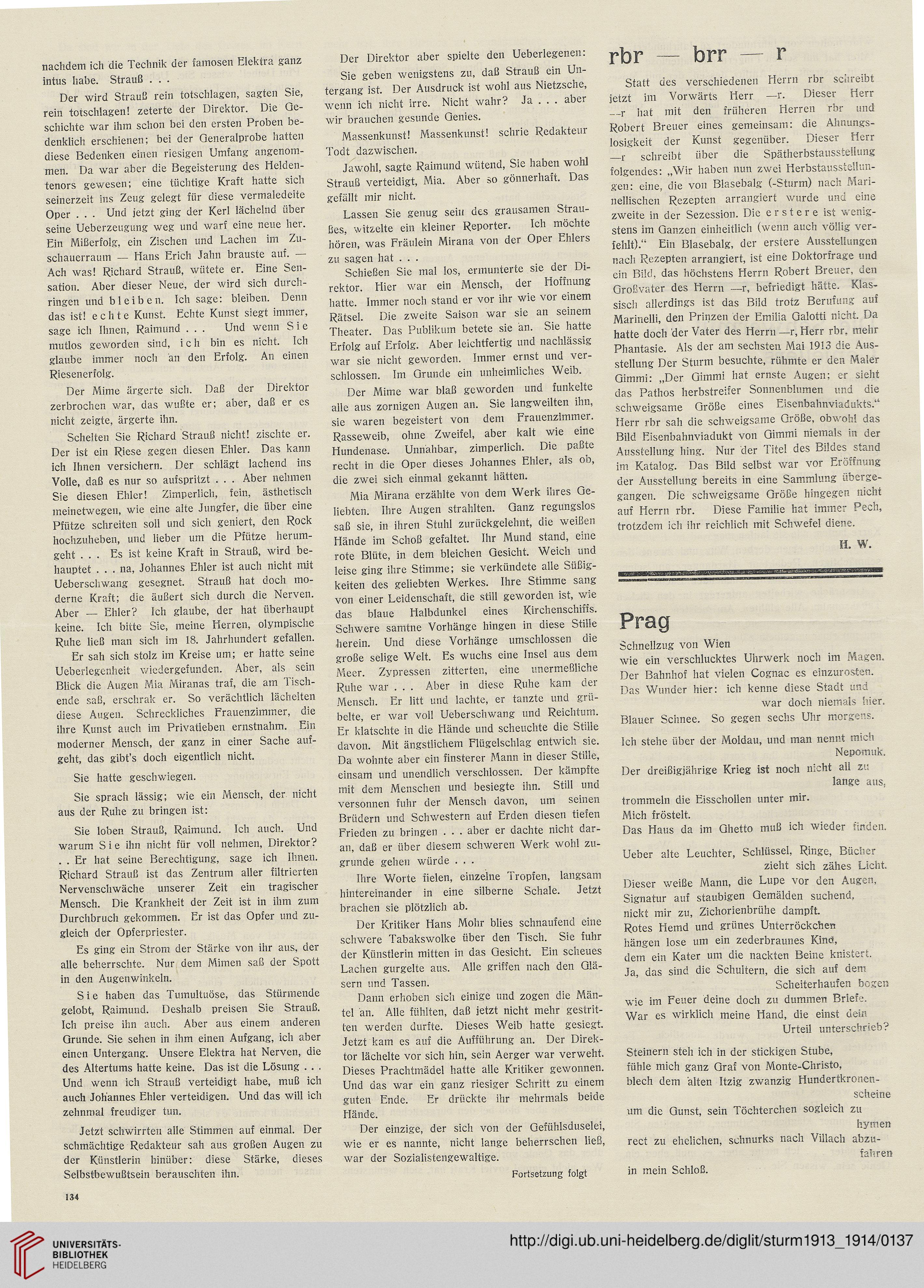nachdem ich die Technik der famosen Elektra ganz
intus habe. Strauß . . .
Der wird Strauß rein totschlagen, sagten Sie,
rein totschlagen! zeterte der Direktor. Die Ge-
schichte war ihm schon bei den ersten Proben be-
denklich erschienen; bei der Generalprobe hatten
diese Bedenken einen riesigen Umfang angenom-
men. Da war aber die Begeisterung des Helden-
tenors gewesen; eine tüchtige Kraft hatte sich
seinerzeit ins Zeug gelegt für diese vermaledeite
Oper . . . Und jetzt ging der Kerl lächelnd über
seine Ueberzeugung weg und warf eine neue her.
Ein Mißerfolg, ein Zischen und Lachen im Zu-
schauerraum — Hans Erich Jahn brauste auf. —
Ach was! Richard Strauß, wütete er. Eine Sen-
sation. Aber dieser Neue, der wird sich durch-
ringen und bleiben. Ich sage: bleiben. Denn
das ist! echte Kunst. Echte Kunst siegt immer,
sage ich Ihnen, Raimund . . . Und wenn S i e
mutlos geworden sind, i c h bin es nicht. Ich
glaube immer noch an den Erfolg. An einen
Riesenerfolg.
Der Mime ärgerte sich. Daß der Direktor
zerbrochen war, das wußte er; aber, daß er es
nicht zeigte, ärgerte ihn.
Schelten Sie Richard Strauß nicht! zischte er.
Der ist ein Riese gegen diesen Ehler. Das kann
ich Ihnen versichern. Der schlägt lachend ins
Volle, daß es nur so aufspritzt . . . Aber nehmen
Sie diesen Ehler! Zimperlich, fein, ästhetisch
meinetwegen, wie eine alte Jungfer, die über eine
Pfütze schreiten soll und sich geniert, den Rock
hochzuheben, und lieber um die Pfütze herum-
geht ... Es ist keine Kraft in Strauß, wird be-
hauptet . . . 11a, Johannes Ehler ist auch nicht mit
Ueberschwang gesegnet. Strauß hat doch mo-
derne Kraft; die äußert sich durch die Nerven.
Aber — Ehler? Ich glaube, der hat überhaupt
keine. Ich bitte Sie, meine Herren, olympische
Ruhe ließ man sich im 18. Jahrhundert gefallen.
Er sah sich stolz im Kreise um; er hatte seine
Ueberlegenheit wiedergefunden. Aber, als sein
Blick die Augen Mia Miranas traf, die am Tisch-
ende saß, erschrak er. So verächtlich lächelten
diese Augen. Schreckliches Frauenzimmer, die
ihre Kunst auch im Privatleben ernstnahm. Ein
moderner Mensch, der ganz in einer Sache auf-
geht, das gibt’s doch eigentlich nicht.
Sie hatte geschwiegen.
Sie sprach lässig; wie ein Mensch, der nicht
aus der Ruhe zu bringen ist:
Sie loben Strauß, Raimund. Ich auch. Und
warum Sie ihn nicht für voll nehmen, Direktor?
. . Er hat seine Berechtigung, sage ich Ihnen.
Richard Strauß ist das Zentrum aller filtrierten
Nervenschwäche unserer Zeit ein tragischer
Mensch. Die Krankheit der Zeit ist in ihm zum
Durchbruch gekommen. Er ist das Opfer und zu-
gleich der Opferpriester.
Es ging ein Strom der Stärke von ihr aus, der
alle beherrschte. Nur dem Mimen saß der Spott
in den Augenwinkeln.
Sie haben das Tumultuöse, das Stürmende
gelobt, Raimund. Deshalb preisen Sie Strauß.
Ich preise ihn auch. Aber aus einem anderen
Grunde. Sie sehen in ihm einen Aufgang, ich aber
einen Untergang. Unsere Elektra hat Nerven, die
des Altertums hatte keine. Das ist die Lösung . . .
Und wenn ich Strauß verteidigt habe, muß ich
auch Johannes Ehler verteidigen. Und das will ich
zehnmal freudiger tun.
Jetzt schwirrten alle Stimmen auf einmal. Der
schmächtige Redakteur sah aus großen Augen zu
der Künstlerin hinüber: diese Stärke, dieses
Selbstbewußtsein berauschten ihn.
Der Direktor aber spielte den Ueberlegenen:
Sie geben wenigstens zu, daß Strauß ein Un-
tergang ist. Der Ausdruck ist wohl aus Nietzsche,
wenn ich nicht irre. Nicht wahr? Ja . . . aber
wir brauchen gesunde Genies.
Massenkunst! Massenkunst! schrie Redakteur
Todt dazwischen.
Jawohl, sagte Raimund wütend, Sic haben wohl
Strauß verteidigt, Mia. Aber so gönnerhaft. Das
gefällt mir nicht.
Lassen Sie genug sein des grausamen Strau-
ßes, witzelte ein kleiner Reporter. Ich möchte
hören, was Fräulein Mirana von der Oper Ehlers
zu sagen hat . . .
Schießen Sie mal los, ermunterte sie der Di-
rektor. Hier war ein Mensch, der Hoffnung
hatte. Immer noch stand er vor ihr wie vor einem
Rätsel. Die zweite Saison war sie an seinem
Theater. Das Publikum betete sie an. Sie hatte
Erfolg auf Erfolg. Aber leichtfertig und nachlässig
war sie nicht geworden. Immer ernst und ver-
schlossen. Im Grunde ein unheimliches Weib.
Der Mime war blaß geworden und funkelte
alle aus zornigen Augen an. Sie langweilten ihn,
sie waren begeistert von dem Frauenzimmer.
Rasseweib, ohne Zweifel, aber kalt wie eine
Hundenase. Unnahbar, zimperlich. Die paßte
recht in die Oper dieses Johannes Ehler, als ob,
die zwei sich einmal gekannt hätten.
Mia Mirana erzählte von dem Werk ihres Ge-
liebten. Ihre Augen strahlten. Ganz regungslos
saß sie, in ihren Stuhl zurückgelehnt, die weißen
Hände im Schoß gefaltet. Ihr Mund stand, eine
rote Blüte, in dem bleichen Gesicht. Weich und
leise ging ihre Stimme; sie verkündete alle Süßig-
keiten des geliebten Werkes. Ihre Stimme sang
von einer Leidenschaft, die still geworden ist, wie
das blaue Halbdunkel eines Kirchenschiffs.
Schwere samtne Vorhänge hingen in diese Stille
herein. Und diese Vorhänge umschlossen die
große selige Welt. Es wuchs eine Insel aus dem
Meer. Zypressen zitterten, eine unermeßliche
Ruhe war . . . Aber in diese Ruhe kam der
Mensch. Er litt und lachte, er tanzte und grü-
belte, er war voll Ueberschwang und Reichtum.
Er klatschte in die Hände und scheuchte die Stille
davon. Mit ängstlichem Flügelschlag entwich sie.
Da wohnte aber ein finsterer Mann in dieser Stille,
einsam und unendlich verschlossen. Der kämpfte
mit dem Menschen und besiegte ihn. Still und
versonnen fuhr der Mensch davor,, um seinen
Brüdern und Schwestern auf Erden diesen tiefen
Frieden zu bringen . . . aber er dachte nicht dar-
an, daß er über diesem schweren Werk wohl zu-
grunde gehen würde . . .
Ihre Worte fielen, einzelne Tropfen, langsam
hintereinander in eine silberne Schale. Jetzt
brachen sie plötzlich ab.
Der Kritiker Hans Mohr blies schnaufend eine
schwere Tabakswolke über den Tisch. Sie fuhr
der Künstlerin mitten in das Gesicht. Ein scheues
Lachen gurgelte aus. Alle griffen nach den Glä-
sern und Tassen.
Dann erhoben sich einige und zogen die Män-
tel an. Alle fühlten, daß jetzt nicht mehr gestrit-
ten werden durfte. Dieses Weib hatte gesiegt.
Jetzt kam es auf die Aufführung an. Der Direk-
tor lächelte vor sich hin, sein Aerger war verweht.
Dieses Prachtmädel hatte alle Kritiker gewonnen.
Und das war ein ganz riesiger Schritt zu einem
guten Ende. Er drückte ihr mehrmals beide
Hände.
Der einzige, der sich von der Gefühlsduselei,
wie er es nannte, nicht lange beherrschen ließ,
war der Sozialistengewaltige.
Fortsetzung folgt
rbr — brr — r
Statt des verschiedenen Herrn rbr schreibt
jetzt im Vorwärts Herr —r. Dieser Herr
—r hat mit den früheren Herren rbr und
Robert Breuer eines gemeinsam: die Ahnungs-
losigkeit der Kunst gegenüber. Dieser Herr
—r schreibt über die Spätherbstausstellung
folgendes: „Wir haben nun zwei Herbstausstellun-
gen: eine, die von Blasebalg (-Sturm) nach Mari-
nellischen Rezepten arrangiert wurde und eine
zweite in der Sezession. Die e r s t e r e ist wenig-
stens im Ganzen einheitlich (wenn auch völlig ver-
fehlt).“ Ein Blasebalg, der erstere Ausstellungen
nach Rezepten arrangiert, ist eine Doktorfrage und
ein Bild, das höchstens Herrn Robert Breuer, den
Großvater des Herrn —r, befriedigt hätte. Klas-
sisch allerdings ist das Bild trotz Berufung auf
Marinelli, den Prinzen der Emilia Galotti nicht. Da
hatte doch der Vater des Herrn —r, Herr rbr, mehr
Phantasie. Als der am sechsten Mai 1913 die Aus-
stellung Der Sturm besuchte, rühmte er den Maler
Gimmi: „Der Gimmi hat ernste Augen; er sieht
das Pathos herbstreifer Sonnenblumen und die
schweigsame Größe eines Eisenbahnviadukts.“
Herr rbr sah die schweigsame Größe, obwohl das
Bild Eisenbahnviadukt von Gimmi niemals in der
Ausstellung hing. Nur der Titel des Bildes stand
im Katalog. Das Bild selbst war vor Eröffnung
der Ausstellung bereits in eine Sammlung überge-
gangen. Die schweigsame Größe hingegen nicht
auf Herrn rbr. Diese Familie hat immer Pech,
trotzdem ich ihr reichlich mit Schwefel diene.
Ii. W.
Prag
Schnellzug von Wien
wie ein verschlucktes Uhrwerk noch im Magen.
Der Bahnhof hat vielen Cognac es einzurosten.
Das Wunder hier: ich kenne diese Stadt und
war doch niemals hier.
Blauer Schnee. So gegen sechs Uhr morgens.
Ich stehe über der Moldau, und man nennt mich
Nepomuk.
Der dreißigjährige Krieg ist noch nicht all zu
lange aus,
trommeln die Eisschollen unter mir.
Mich fröstelt.
Das Haus da im Ghetto muß ich wieder finden.
Ueber alte Leuchter, Schlüssel, Ringe, Bücher
zieht sich zähes Licht.
Dieser weiße Mann, die Lupe vor den Augen,
Signatur auf staubigen Gemälden suchend,
nickt mir zu, Zichorienbrühe dampft.
Rotes Hemd und grünes Unterröckchen
hängen lose um ein zederbraunes Kind,
dem ein Kater um die nackten Beine knistert.
Ja, das sind die Schultern, die sich auf dem
Scheiterhaufen bogen
wie im Feuer deine doch zu dummen Briefe.
War es wirklich meine Hand, die einst dein
Urteil unterschrieb?
Steinern steh ich in der stickigen Stube,
fühle mich ganz Graf von Monte-Christo,
blech dem alten Itzig zwanzig Hundertkronen-
scheine
um die Gunst, sein Töchterchen sogleich zu
hymen
rect zu ehelichen, schnurks nach Villach abzu-
fahren
in mein Schloß.
134
intus habe. Strauß . . .
Der wird Strauß rein totschlagen, sagten Sie,
rein totschlagen! zeterte der Direktor. Die Ge-
schichte war ihm schon bei den ersten Proben be-
denklich erschienen; bei der Generalprobe hatten
diese Bedenken einen riesigen Umfang angenom-
men. Da war aber die Begeisterung des Helden-
tenors gewesen; eine tüchtige Kraft hatte sich
seinerzeit ins Zeug gelegt für diese vermaledeite
Oper . . . Und jetzt ging der Kerl lächelnd über
seine Ueberzeugung weg und warf eine neue her.
Ein Mißerfolg, ein Zischen und Lachen im Zu-
schauerraum — Hans Erich Jahn brauste auf. —
Ach was! Richard Strauß, wütete er. Eine Sen-
sation. Aber dieser Neue, der wird sich durch-
ringen und bleiben. Ich sage: bleiben. Denn
das ist! echte Kunst. Echte Kunst siegt immer,
sage ich Ihnen, Raimund . . . Und wenn S i e
mutlos geworden sind, i c h bin es nicht. Ich
glaube immer noch an den Erfolg. An einen
Riesenerfolg.
Der Mime ärgerte sich. Daß der Direktor
zerbrochen war, das wußte er; aber, daß er es
nicht zeigte, ärgerte ihn.
Schelten Sie Richard Strauß nicht! zischte er.
Der ist ein Riese gegen diesen Ehler. Das kann
ich Ihnen versichern. Der schlägt lachend ins
Volle, daß es nur so aufspritzt . . . Aber nehmen
Sie diesen Ehler! Zimperlich, fein, ästhetisch
meinetwegen, wie eine alte Jungfer, die über eine
Pfütze schreiten soll und sich geniert, den Rock
hochzuheben, und lieber um die Pfütze herum-
geht ... Es ist keine Kraft in Strauß, wird be-
hauptet . . . 11a, Johannes Ehler ist auch nicht mit
Ueberschwang gesegnet. Strauß hat doch mo-
derne Kraft; die äußert sich durch die Nerven.
Aber — Ehler? Ich glaube, der hat überhaupt
keine. Ich bitte Sie, meine Herren, olympische
Ruhe ließ man sich im 18. Jahrhundert gefallen.
Er sah sich stolz im Kreise um; er hatte seine
Ueberlegenheit wiedergefunden. Aber, als sein
Blick die Augen Mia Miranas traf, die am Tisch-
ende saß, erschrak er. So verächtlich lächelten
diese Augen. Schreckliches Frauenzimmer, die
ihre Kunst auch im Privatleben ernstnahm. Ein
moderner Mensch, der ganz in einer Sache auf-
geht, das gibt’s doch eigentlich nicht.
Sie hatte geschwiegen.
Sie sprach lässig; wie ein Mensch, der nicht
aus der Ruhe zu bringen ist:
Sie loben Strauß, Raimund. Ich auch. Und
warum Sie ihn nicht für voll nehmen, Direktor?
. . Er hat seine Berechtigung, sage ich Ihnen.
Richard Strauß ist das Zentrum aller filtrierten
Nervenschwäche unserer Zeit ein tragischer
Mensch. Die Krankheit der Zeit ist in ihm zum
Durchbruch gekommen. Er ist das Opfer und zu-
gleich der Opferpriester.
Es ging ein Strom der Stärke von ihr aus, der
alle beherrschte. Nur dem Mimen saß der Spott
in den Augenwinkeln.
Sie haben das Tumultuöse, das Stürmende
gelobt, Raimund. Deshalb preisen Sie Strauß.
Ich preise ihn auch. Aber aus einem anderen
Grunde. Sie sehen in ihm einen Aufgang, ich aber
einen Untergang. Unsere Elektra hat Nerven, die
des Altertums hatte keine. Das ist die Lösung . . .
Und wenn ich Strauß verteidigt habe, muß ich
auch Johannes Ehler verteidigen. Und das will ich
zehnmal freudiger tun.
Jetzt schwirrten alle Stimmen auf einmal. Der
schmächtige Redakteur sah aus großen Augen zu
der Künstlerin hinüber: diese Stärke, dieses
Selbstbewußtsein berauschten ihn.
Der Direktor aber spielte den Ueberlegenen:
Sie geben wenigstens zu, daß Strauß ein Un-
tergang ist. Der Ausdruck ist wohl aus Nietzsche,
wenn ich nicht irre. Nicht wahr? Ja . . . aber
wir brauchen gesunde Genies.
Massenkunst! Massenkunst! schrie Redakteur
Todt dazwischen.
Jawohl, sagte Raimund wütend, Sic haben wohl
Strauß verteidigt, Mia. Aber so gönnerhaft. Das
gefällt mir nicht.
Lassen Sie genug sein des grausamen Strau-
ßes, witzelte ein kleiner Reporter. Ich möchte
hören, was Fräulein Mirana von der Oper Ehlers
zu sagen hat . . .
Schießen Sie mal los, ermunterte sie der Di-
rektor. Hier war ein Mensch, der Hoffnung
hatte. Immer noch stand er vor ihr wie vor einem
Rätsel. Die zweite Saison war sie an seinem
Theater. Das Publikum betete sie an. Sie hatte
Erfolg auf Erfolg. Aber leichtfertig und nachlässig
war sie nicht geworden. Immer ernst und ver-
schlossen. Im Grunde ein unheimliches Weib.
Der Mime war blaß geworden und funkelte
alle aus zornigen Augen an. Sie langweilten ihn,
sie waren begeistert von dem Frauenzimmer.
Rasseweib, ohne Zweifel, aber kalt wie eine
Hundenase. Unnahbar, zimperlich. Die paßte
recht in die Oper dieses Johannes Ehler, als ob,
die zwei sich einmal gekannt hätten.
Mia Mirana erzählte von dem Werk ihres Ge-
liebten. Ihre Augen strahlten. Ganz regungslos
saß sie, in ihren Stuhl zurückgelehnt, die weißen
Hände im Schoß gefaltet. Ihr Mund stand, eine
rote Blüte, in dem bleichen Gesicht. Weich und
leise ging ihre Stimme; sie verkündete alle Süßig-
keiten des geliebten Werkes. Ihre Stimme sang
von einer Leidenschaft, die still geworden ist, wie
das blaue Halbdunkel eines Kirchenschiffs.
Schwere samtne Vorhänge hingen in diese Stille
herein. Und diese Vorhänge umschlossen die
große selige Welt. Es wuchs eine Insel aus dem
Meer. Zypressen zitterten, eine unermeßliche
Ruhe war . . . Aber in diese Ruhe kam der
Mensch. Er litt und lachte, er tanzte und grü-
belte, er war voll Ueberschwang und Reichtum.
Er klatschte in die Hände und scheuchte die Stille
davon. Mit ängstlichem Flügelschlag entwich sie.
Da wohnte aber ein finsterer Mann in dieser Stille,
einsam und unendlich verschlossen. Der kämpfte
mit dem Menschen und besiegte ihn. Still und
versonnen fuhr der Mensch davor,, um seinen
Brüdern und Schwestern auf Erden diesen tiefen
Frieden zu bringen . . . aber er dachte nicht dar-
an, daß er über diesem schweren Werk wohl zu-
grunde gehen würde . . .
Ihre Worte fielen, einzelne Tropfen, langsam
hintereinander in eine silberne Schale. Jetzt
brachen sie plötzlich ab.
Der Kritiker Hans Mohr blies schnaufend eine
schwere Tabakswolke über den Tisch. Sie fuhr
der Künstlerin mitten in das Gesicht. Ein scheues
Lachen gurgelte aus. Alle griffen nach den Glä-
sern und Tassen.
Dann erhoben sich einige und zogen die Män-
tel an. Alle fühlten, daß jetzt nicht mehr gestrit-
ten werden durfte. Dieses Weib hatte gesiegt.
Jetzt kam es auf die Aufführung an. Der Direk-
tor lächelte vor sich hin, sein Aerger war verweht.
Dieses Prachtmädel hatte alle Kritiker gewonnen.
Und das war ein ganz riesiger Schritt zu einem
guten Ende. Er drückte ihr mehrmals beide
Hände.
Der einzige, der sich von der Gefühlsduselei,
wie er es nannte, nicht lange beherrschen ließ,
war der Sozialistengewaltige.
Fortsetzung folgt
rbr — brr — r
Statt des verschiedenen Herrn rbr schreibt
jetzt im Vorwärts Herr —r. Dieser Herr
—r hat mit den früheren Herren rbr und
Robert Breuer eines gemeinsam: die Ahnungs-
losigkeit der Kunst gegenüber. Dieser Herr
—r schreibt über die Spätherbstausstellung
folgendes: „Wir haben nun zwei Herbstausstellun-
gen: eine, die von Blasebalg (-Sturm) nach Mari-
nellischen Rezepten arrangiert wurde und eine
zweite in der Sezession. Die e r s t e r e ist wenig-
stens im Ganzen einheitlich (wenn auch völlig ver-
fehlt).“ Ein Blasebalg, der erstere Ausstellungen
nach Rezepten arrangiert, ist eine Doktorfrage und
ein Bild, das höchstens Herrn Robert Breuer, den
Großvater des Herrn —r, befriedigt hätte. Klas-
sisch allerdings ist das Bild trotz Berufung auf
Marinelli, den Prinzen der Emilia Galotti nicht. Da
hatte doch der Vater des Herrn —r, Herr rbr, mehr
Phantasie. Als der am sechsten Mai 1913 die Aus-
stellung Der Sturm besuchte, rühmte er den Maler
Gimmi: „Der Gimmi hat ernste Augen; er sieht
das Pathos herbstreifer Sonnenblumen und die
schweigsame Größe eines Eisenbahnviadukts.“
Herr rbr sah die schweigsame Größe, obwohl das
Bild Eisenbahnviadukt von Gimmi niemals in der
Ausstellung hing. Nur der Titel des Bildes stand
im Katalog. Das Bild selbst war vor Eröffnung
der Ausstellung bereits in eine Sammlung überge-
gangen. Die schweigsame Größe hingegen nicht
auf Herrn rbr. Diese Familie hat immer Pech,
trotzdem ich ihr reichlich mit Schwefel diene.
Ii. W.
Prag
Schnellzug von Wien
wie ein verschlucktes Uhrwerk noch im Magen.
Der Bahnhof hat vielen Cognac es einzurosten.
Das Wunder hier: ich kenne diese Stadt und
war doch niemals hier.
Blauer Schnee. So gegen sechs Uhr morgens.
Ich stehe über der Moldau, und man nennt mich
Nepomuk.
Der dreißigjährige Krieg ist noch nicht all zu
lange aus,
trommeln die Eisschollen unter mir.
Mich fröstelt.
Das Haus da im Ghetto muß ich wieder finden.
Ueber alte Leuchter, Schlüssel, Ringe, Bücher
zieht sich zähes Licht.
Dieser weiße Mann, die Lupe vor den Augen,
Signatur auf staubigen Gemälden suchend,
nickt mir zu, Zichorienbrühe dampft.
Rotes Hemd und grünes Unterröckchen
hängen lose um ein zederbraunes Kind,
dem ein Kater um die nackten Beine knistert.
Ja, das sind die Schultern, die sich auf dem
Scheiterhaufen bogen
wie im Feuer deine doch zu dummen Briefe.
War es wirklich meine Hand, die einst dein
Urteil unterschrieb?
Steinern steh ich in der stickigen Stube,
fühle mich ganz Graf von Monte-Christo,
blech dem alten Itzig zwanzig Hundertkronen-
scheine
um die Gunst, sein Töchterchen sogleich zu
hymen
rect zu ehelichen, schnurks nach Villach abzu-
fahren
in mein Schloß.
134