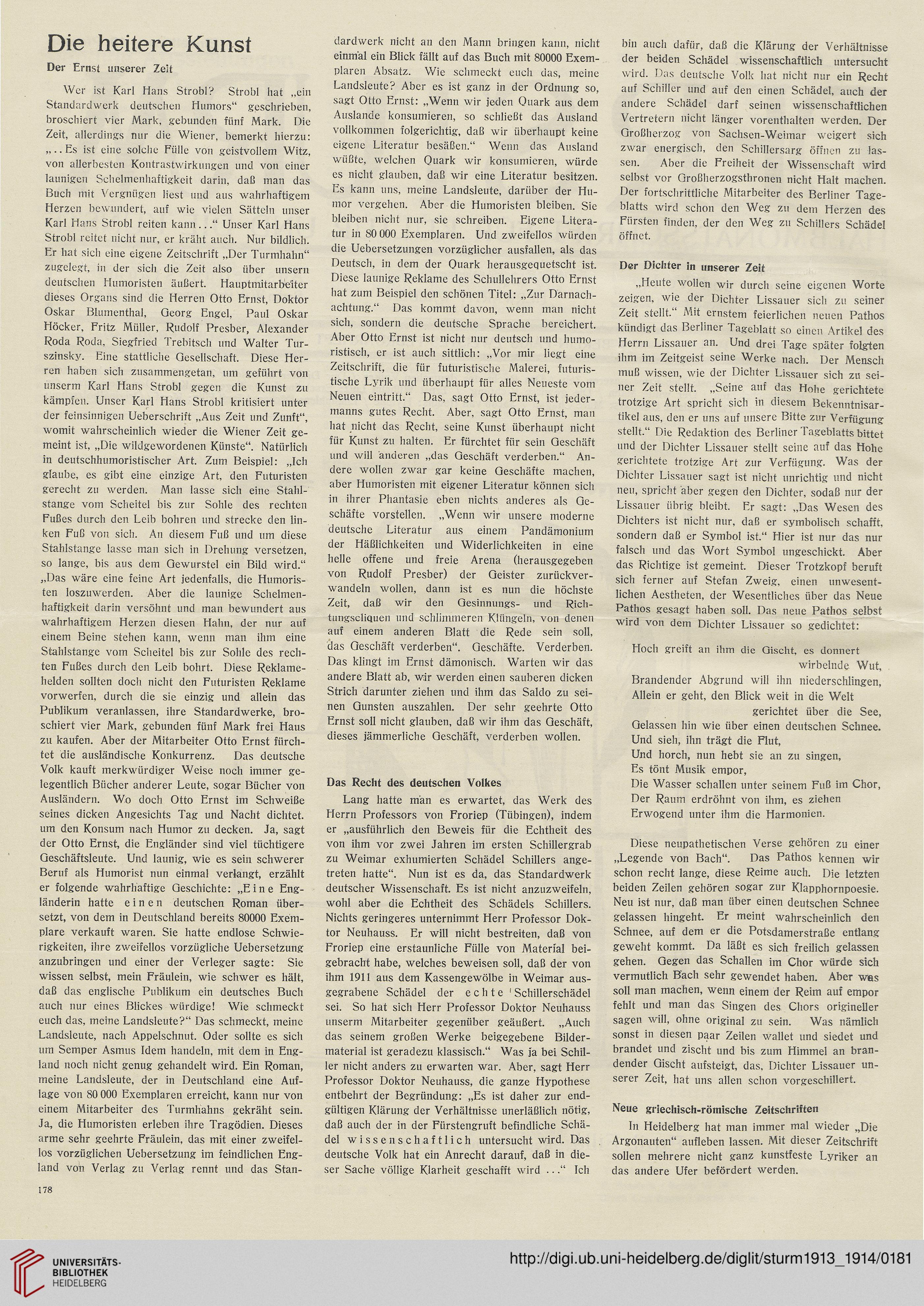Die heitere Kunst
Der Ernst unserer Zeit
Wer ist Karl Hans Strobl? Strobl hat „ein
Standardwerk deutschen Humors“ geschrieben,
broschiert vier Mark, gebunden fünf Mark. Die
Zeit, allerdings nur die Wiener, bemerkt hierzu:
„.. Es ist eine solche Fülle von geistvollem Witz,
von allerbesten Kontrastwirkungen und von einer
launigen Schelmenhaftigkeit darin, daß man das
Buch mit Vergnügen liest und aus wahrhaftigem
Herzen bewundert, auf wie vielen Sätteln unser
Karl Hans Strobl reiten kann..Unser Karl Hans
Strobl reitet nicht nur, er kräht auch. Nur bildlich.
Er hat sich eine eigene Zeitschrift „Der Turmhahn“
zugelegt, in der sich die Zeit also über unsern
deutschen Humoristen äußert. Hauptmitarbeiter
dieses Organs sind die Herren Otto Ernst, Doktor
Oskar Blumenthal, Georg Engel, Paul Oskar
Höcker, Fritz Müller, Rudolf Presber, Alexander
Roda Roda, Siegfried Trebitsch und Walter Tur-
szinsky. Eine stattliche Gesellschaft. Diese Her-
ren haben sich zusammengetan, um geführt von
unscrm Karl Hans Strobl gegen die Kunst zu
kämpfen. Unser Karl Hans Strobl kritisiert unter
der feinsinnigen Ueberschrift „Aus Zeit und Zunft“,
womit wahrscheinlich wieder die Wiener Zeit ge-
meint ist, „Die wildgewordenen Künste“. Natürlich
in deutschhumoristischer Art. Zum Beispiel: „Ich
glaube, es gibt eine einzige Art, den Futuristen
gerecht zu werden. Man lasse sich eine Stahl-
stange vom Scheitel bis zur Sohle des rechten
Fußes durch den Leib bohren und strecke den lin-
ken Fuß von sich. An diesem Fuß und um diese
Stahlstange lasse man sich in Drehung versetzen,
so lange, bis aus dem Gewurstel ein Bild wird.“
„Das wäre eine feine Art jedenfalls, die Humoris-
ten loszuwerden. Aber die launige Schelmen-
haftigkeit darin versöhnt und man bewundert aus
wahrhaftigem Herzen diesen Hahn, der nur auf
einem Beine stehen kann, wenn man ihm eine
Stahlstange vom Scheitel bis zur Sohle des rech-
ten Fußes durch den Leib bohrt. Diese Reklame-
helden sollten doch nicht den Futuristen Reklame
vorwerfen, durch die sie einzig und allein das
Publikum veranlassen, ihre Standardwerke, bro-
schiert vier Mark, gebunden fünf Mark frei Haus
zu kaufen. Aber der Mitarbeiter Otto Ernst fürch-
tet die ausländische Konkurrenz. Das deutsche
Volk kauft merkwürdiger Weise noch immer ge-
legentlich Bücher anderer Leute, sogar Bücher von
Ausländern. Wo doch Otto Ernst im Schweiße
seines dicken Angesichts Tag und Nacht dichtet,
um den Konsum nach Humor zu decken. Ja, sagt
der Otto Ernst, die Engländer sind viel tüchtigere
Geschäftsleute. Und launig, wie es sein schwerer
Beruf als Humorist mm einmal verlangt, erzählt
er folgende wahrhaftige Geschichte: „Eine Eng-
länderin hatte einen deutschen Roman über-
setzt, von dem in Deutschland bereits 80000 Exem-
plare verkauft waren. Sie hatte endlose Schwie-
rigkeiten, ihre zweifellos vorzügliche Uebersetzung
anzubringen und einer der Verleger sagte: Sie
wissen selbst, mein Fräulein, wie schwer es hält,
daß das englische Publikum ein deutsches Buch
auch nur eines Blickes würdige! Wie schmeckt
euch das, meine Landsleute?“ Das schmeckt, meine
Landsleute, nach Appelschnut. Oder sollte es sich
um Semper Asmus Idem handeln, mit dem in Eng-
land noch nicht genug gehandelt wird. Ein Roman,
meine Landsleute, der in Deutschland eine Auf-
lage von 80 000 Exemplaren erreicht, kann nur von
einem Mitarbeiter des Turmhahns gekräht sein.
Ja, die Humoristen erleben ihre Tragödien. Dieses
arme sehr geehrte Fräulein, das mit einer zweifel-
los vorzüglichen Uebersetzung im feindlichen Eng-
land von Verlag zu Verlag rennt und das Stan-
dardwerk nicht an den Mann bringen kann, nicht
einmal ein Blick fällt auf das Buch mit 80000 Exem-
plaren Absatz. V/ie schmeckt euch das, meine
Landsleute? Aber es ist ganz in der Ordnung so,
sagt Otto Ernst: „Wenn wir jeden Quark aus dem
Auslande konsumieren, so schließt das Ausland
vollkommen folgerichtig, daß wir überhaupt keine
eigene Literatur besäßen.“ Wenn das Ausland
wüßte, welchen Quark wir konsumieren, würde
es nicht glauben, daß wir eine Literatur besitzen.
Es kann uns, meine Landsleute, darüber der Hu-
mor vergehen. Aber die Humoristen bleiben. Sie
bleiben nicht nur, sie schreiben. Eigene Litera-
tur in 80 000 Exemplaren. Und zweifellos würden
die Uebersetzungen vorzüglicher ausfallen, als das
Deutsch, in dem der Quark herausgequetscht ist.
Diese launige Reklame des Schullehrers Otto Ernst
hat zum Beispiel den schönen Titel: „Zur Darnach-
achtung.“ Das kommt davon, wenn man nicht
sich, sondern die deutsche Sprache bereichert.
Aber Otto Ernst ist nicht nur deutsch und humo-
ristisch, er ist auch sittlich: „Vor mir liegt eine
Zeitschrift, die für futuristische Malerei, futuris-
tische Lyrik und überhaupt für alles Neueste vom
Neuen eintritt.“ Das, sagt Otto Ernst, ist jeder-
manns gutes Recht. Aber, sagt Otto Ernst, man
hat nicht das Recht, seine Kunst überhaupt nicht
für Kunst zu halten. Er fürchtet für sein Geschäft
und will änderen „das Geschäft verderben.“ An-
dere wollen zwar gar keine Geschäfte machen,
aber Humoristen mit eigener Literatur können sich
in ihrer Phantasie eben nichts anderes als Ge-
schäfte vorstellen. „Wenn wir unsere moderne
deutsche Literatur aus einem Pandämonium
der Häßlichkeiten und Widerlichkeiten in eine
helle offene und freie Arena (herausgegeben
von Rudolf Presber) der Geister zurückver-
wandeln wollen, dann ist es nun die höchste
Zeit, daß wir den Gesinnungs- und Rich-
tungscliquen und schlimmeren Klüngeln, von denen
auf einem anderen Blatt die Rede sein soll,
das Geschäft verderben“. Geschäfte. Verderben.
Das klingt im Ernst dämonisch. Warten wir das
andere Blatt ab, wir werden einen sauberen dicken
Strich darunter ziehen und ihm das Saldo zu sei-
nen Gunsten auszahlen. Der sehr geehrte Otto
Ernst soll nicht glauben, daß wir ihm das Geschäft,
dieses jämmerliche Geschäft, verderben wollen.
Das Recht des deutschen Volkes
Lang hatte man es erwartet, das Werk des
Herrn Professors von Froriep (Tübingen), indem
er „ausführlich den Beweis für die Echtheit des
von ihm vor zwei Jahren im ersten Schillergrab
zu Weimar exhumierten Schädel Schillers ange-
treten hatte“. Nun ist es da, das Standardwerk
deutscher Wissenschaft. Es ist nicht anzuzweifeln,
wohl aber die Echtheit des Schädels Schillers.
Nichts geringeres unternimmt Herr Professor Dok-
tor Neuhauss. Er will nicht bestreiten, daß von
Froriep eine erstaunliche Fülle von Material bei-
gebracht habe, welches beweisen soll, daß der von
ihm 1911 aus dem Kassengewölbe in Weimar aus-
gegrabene Schädel der echte 1 Schillerschädel
sei. So hat sich Herr Professor Doktor Neuhauss
unserm Mitarbeiter gegenüber geäußert. „Auch
das seinem großen Werke beigegebene Bilder-
material ist geradezu klassisch.“ Was ja bei Schil-
ler nicht anders zu erwarten war. Aber, sagt Herr
Professor Doktor Neuhauss, die ganze Hypothese
entbehrt der Begründung: „Es ist daher zur end-
gültigen Klärung der Verhältnisse unerläßlich nötig,
daß auch der in der Fürstengruft befindliche Schä-
del wissenschaftlich untersucht wird. Das
deutsche Volk hat ein Anrecht darauf, daß in die-
ser Sache völlige Klarheit geschafft wird ...“ Ich
bin auch dafür, daß die Klärung der Verhältnisse
der beiden Schädel wissenschaftlich untersucht
wird. Das deutsche Volk hat nicht nur ein Recht
auf Schiller und auf den einen Schädel, auch der
andere Schädel darf seinen wissenschaftlichen
Vertretern nicht länger vorenthalten werden. Der
Großherzog von Sachsen-Weimar weigert sich
zwar energisch, den Schillersarg öffnen zu las-
sen. Aber die Freiheit der Wissenschaft wird
selbst vor Großherzogsthronen nicht Halt machen.
Der fortschrittliche Mitarbeiter des Berliner Tage-
blatts wird schon den Weg zu dem Herzen des
Fürsten finden, der den Weg zu Schillers Schädel
öffnet.
Der Dichter in unserer Zeit
„Heute wollen wir durch seine eigenen Worte
zeigen, wie der Dichter Lissauer sich zu seiner
Zeit stellt.“ Mit ernstem feierlichen neuen Pathos
kündigt das Berliner Tageblatt so einen Artikel des
Herrn Lissauer an. Und drei Tage später folgten
ihm im Zeitgeist seine Werke nach. Der Mensch
muß wissen, wie der Dichter Lissauer sich zu sei-
ner Zeit stellt. „Seine auf das Hohe gerichtete
trotzige Art spricht sich in diesem Bekenntnisar-
tikel aus, den er uns auf unsere Bitte zur Verfügung
stellt.“ Die Redaktion des Berliner Tageblatts bittet
und der Dichter Lissauer stellt seine auf das Hohe
gerichtete trotzige Art zur Verfügung. Was der
Dichter Lissauer sagt ist nicht unrichtig und nicht
neu, spricht aber gegen den Dichter, sodaß nur der
Lissauer übrig bleibt. Er sagt: „Das Wesen des
Dichters ist nicht nur, daß er symbolisch schafft,
sondern daß er Symbol ist.“ Hier ist nur das nur
falsch und das Wort Symbol ungeschickt. Aber
das Richtige ist gemeint. Dieser Trotzkopf beruft
sich ferner auf Stefan Zweig, einen unwesent-
lichen Aestheten, der Wesentliches über das Neue
Pathos gesagt haben soll. Das neue Pathos selbst
wird von dem Dichter Lissauer so gedichtet:
Hoch greift an ihm die Gischt, es donnert
wirbelnde Wut,
Brandender Abgrund will ihn niederschlingen,
Allein er geht, den Blick weit in die Welt
gerichtet über die See,
Gelassen hin wie über einen deutschen Schnee.
Und sieh, ihn trägt die Flut,
Und horch, nun hebt sie an zu singen,
Es tönt Musik empor,
Die Wasser schallen unter seinem Fuß im Chor,
Der Raum erdröhnt von ihm, es ziehen
Erwogend unter ihm die Harmonien.
Diese neupathetischen Verse gehören zu einer
„Legende von Bach“. Das Pathos kennen wir
schon recht lange, diese Reime auch. Die letzten
beiden Zeilen gehören sogar zur Klapphornpoesie.
Neu ist nur, daß man über einen deutschen Schnee
gelassen hingeht. Er meint wahrscheinlich den
Schnee, auf dem er die Potsdamerstraße entlang
geweht kommt. Da läßt es sich freilich gelassen
gehen. Gegen das Schallen im Chor würde sich
vermutlich Bach sehr gewendet haben. Aber was
soll man machen, wenn einem der Reim auf empor
fehlt und man das Singen des Chors origineller
sagen will, ohne original zu sein. Was nämlich
sonst in diesen paar Zeilen wallet und siedet und
brandet und zischt und bis zum Himmel an bran-
dender Gischt aufsteigt, das. Dichter Lissauer un-
serer Zeit, hat uns allen schon vorgeschillert.
Neue griechisch-römische Zeitschriften
In Heidelberg hat man immer mal wieder „Die
Argonauten“ aufleben lassen. Mit dieser Zeitschrift
sollen mehrere nicht ganz kunstfeste Lyriker an
das andere Ufer befördert werden.
178
Der Ernst unserer Zeit
Wer ist Karl Hans Strobl? Strobl hat „ein
Standardwerk deutschen Humors“ geschrieben,
broschiert vier Mark, gebunden fünf Mark. Die
Zeit, allerdings nur die Wiener, bemerkt hierzu:
„.. Es ist eine solche Fülle von geistvollem Witz,
von allerbesten Kontrastwirkungen und von einer
launigen Schelmenhaftigkeit darin, daß man das
Buch mit Vergnügen liest und aus wahrhaftigem
Herzen bewundert, auf wie vielen Sätteln unser
Karl Hans Strobl reiten kann..Unser Karl Hans
Strobl reitet nicht nur, er kräht auch. Nur bildlich.
Er hat sich eine eigene Zeitschrift „Der Turmhahn“
zugelegt, in der sich die Zeit also über unsern
deutschen Humoristen äußert. Hauptmitarbeiter
dieses Organs sind die Herren Otto Ernst, Doktor
Oskar Blumenthal, Georg Engel, Paul Oskar
Höcker, Fritz Müller, Rudolf Presber, Alexander
Roda Roda, Siegfried Trebitsch und Walter Tur-
szinsky. Eine stattliche Gesellschaft. Diese Her-
ren haben sich zusammengetan, um geführt von
unscrm Karl Hans Strobl gegen die Kunst zu
kämpfen. Unser Karl Hans Strobl kritisiert unter
der feinsinnigen Ueberschrift „Aus Zeit und Zunft“,
womit wahrscheinlich wieder die Wiener Zeit ge-
meint ist, „Die wildgewordenen Künste“. Natürlich
in deutschhumoristischer Art. Zum Beispiel: „Ich
glaube, es gibt eine einzige Art, den Futuristen
gerecht zu werden. Man lasse sich eine Stahl-
stange vom Scheitel bis zur Sohle des rechten
Fußes durch den Leib bohren und strecke den lin-
ken Fuß von sich. An diesem Fuß und um diese
Stahlstange lasse man sich in Drehung versetzen,
so lange, bis aus dem Gewurstel ein Bild wird.“
„Das wäre eine feine Art jedenfalls, die Humoris-
ten loszuwerden. Aber die launige Schelmen-
haftigkeit darin versöhnt und man bewundert aus
wahrhaftigem Herzen diesen Hahn, der nur auf
einem Beine stehen kann, wenn man ihm eine
Stahlstange vom Scheitel bis zur Sohle des rech-
ten Fußes durch den Leib bohrt. Diese Reklame-
helden sollten doch nicht den Futuristen Reklame
vorwerfen, durch die sie einzig und allein das
Publikum veranlassen, ihre Standardwerke, bro-
schiert vier Mark, gebunden fünf Mark frei Haus
zu kaufen. Aber der Mitarbeiter Otto Ernst fürch-
tet die ausländische Konkurrenz. Das deutsche
Volk kauft merkwürdiger Weise noch immer ge-
legentlich Bücher anderer Leute, sogar Bücher von
Ausländern. Wo doch Otto Ernst im Schweiße
seines dicken Angesichts Tag und Nacht dichtet,
um den Konsum nach Humor zu decken. Ja, sagt
der Otto Ernst, die Engländer sind viel tüchtigere
Geschäftsleute. Und launig, wie es sein schwerer
Beruf als Humorist mm einmal verlangt, erzählt
er folgende wahrhaftige Geschichte: „Eine Eng-
länderin hatte einen deutschen Roman über-
setzt, von dem in Deutschland bereits 80000 Exem-
plare verkauft waren. Sie hatte endlose Schwie-
rigkeiten, ihre zweifellos vorzügliche Uebersetzung
anzubringen und einer der Verleger sagte: Sie
wissen selbst, mein Fräulein, wie schwer es hält,
daß das englische Publikum ein deutsches Buch
auch nur eines Blickes würdige! Wie schmeckt
euch das, meine Landsleute?“ Das schmeckt, meine
Landsleute, nach Appelschnut. Oder sollte es sich
um Semper Asmus Idem handeln, mit dem in Eng-
land noch nicht genug gehandelt wird. Ein Roman,
meine Landsleute, der in Deutschland eine Auf-
lage von 80 000 Exemplaren erreicht, kann nur von
einem Mitarbeiter des Turmhahns gekräht sein.
Ja, die Humoristen erleben ihre Tragödien. Dieses
arme sehr geehrte Fräulein, das mit einer zweifel-
los vorzüglichen Uebersetzung im feindlichen Eng-
land von Verlag zu Verlag rennt und das Stan-
dardwerk nicht an den Mann bringen kann, nicht
einmal ein Blick fällt auf das Buch mit 80000 Exem-
plaren Absatz. V/ie schmeckt euch das, meine
Landsleute? Aber es ist ganz in der Ordnung so,
sagt Otto Ernst: „Wenn wir jeden Quark aus dem
Auslande konsumieren, so schließt das Ausland
vollkommen folgerichtig, daß wir überhaupt keine
eigene Literatur besäßen.“ Wenn das Ausland
wüßte, welchen Quark wir konsumieren, würde
es nicht glauben, daß wir eine Literatur besitzen.
Es kann uns, meine Landsleute, darüber der Hu-
mor vergehen. Aber die Humoristen bleiben. Sie
bleiben nicht nur, sie schreiben. Eigene Litera-
tur in 80 000 Exemplaren. Und zweifellos würden
die Uebersetzungen vorzüglicher ausfallen, als das
Deutsch, in dem der Quark herausgequetscht ist.
Diese launige Reklame des Schullehrers Otto Ernst
hat zum Beispiel den schönen Titel: „Zur Darnach-
achtung.“ Das kommt davon, wenn man nicht
sich, sondern die deutsche Sprache bereichert.
Aber Otto Ernst ist nicht nur deutsch und humo-
ristisch, er ist auch sittlich: „Vor mir liegt eine
Zeitschrift, die für futuristische Malerei, futuris-
tische Lyrik und überhaupt für alles Neueste vom
Neuen eintritt.“ Das, sagt Otto Ernst, ist jeder-
manns gutes Recht. Aber, sagt Otto Ernst, man
hat nicht das Recht, seine Kunst überhaupt nicht
für Kunst zu halten. Er fürchtet für sein Geschäft
und will änderen „das Geschäft verderben.“ An-
dere wollen zwar gar keine Geschäfte machen,
aber Humoristen mit eigener Literatur können sich
in ihrer Phantasie eben nichts anderes als Ge-
schäfte vorstellen. „Wenn wir unsere moderne
deutsche Literatur aus einem Pandämonium
der Häßlichkeiten und Widerlichkeiten in eine
helle offene und freie Arena (herausgegeben
von Rudolf Presber) der Geister zurückver-
wandeln wollen, dann ist es nun die höchste
Zeit, daß wir den Gesinnungs- und Rich-
tungscliquen und schlimmeren Klüngeln, von denen
auf einem anderen Blatt die Rede sein soll,
das Geschäft verderben“. Geschäfte. Verderben.
Das klingt im Ernst dämonisch. Warten wir das
andere Blatt ab, wir werden einen sauberen dicken
Strich darunter ziehen und ihm das Saldo zu sei-
nen Gunsten auszahlen. Der sehr geehrte Otto
Ernst soll nicht glauben, daß wir ihm das Geschäft,
dieses jämmerliche Geschäft, verderben wollen.
Das Recht des deutschen Volkes
Lang hatte man es erwartet, das Werk des
Herrn Professors von Froriep (Tübingen), indem
er „ausführlich den Beweis für die Echtheit des
von ihm vor zwei Jahren im ersten Schillergrab
zu Weimar exhumierten Schädel Schillers ange-
treten hatte“. Nun ist es da, das Standardwerk
deutscher Wissenschaft. Es ist nicht anzuzweifeln,
wohl aber die Echtheit des Schädels Schillers.
Nichts geringeres unternimmt Herr Professor Dok-
tor Neuhauss. Er will nicht bestreiten, daß von
Froriep eine erstaunliche Fülle von Material bei-
gebracht habe, welches beweisen soll, daß der von
ihm 1911 aus dem Kassengewölbe in Weimar aus-
gegrabene Schädel der echte 1 Schillerschädel
sei. So hat sich Herr Professor Doktor Neuhauss
unserm Mitarbeiter gegenüber geäußert. „Auch
das seinem großen Werke beigegebene Bilder-
material ist geradezu klassisch.“ Was ja bei Schil-
ler nicht anders zu erwarten war. Aber, sagt Herr
Professor Doktor Neuhauss, die ganze Hypothese
entbehrt der Begründung: „Es ist daher zur end-
gültigen Klärung der Verhältnisse unerläßlich nötig,
daß auch der in der Fürstengruft befindliche Schä-
del wissenschaftlich untersucht wird. Das
deutsche Volk hat ein Anrecht darauf, daß in die-
ser Sache völlige Klarheit geschafft wird ...“ Ich
bin auch dafür, daß die Klärung der Verhältnisse
der beiden Schädel wissenschaftlich untersucht
wird. Das deutsche Volk hat nicht nur ein Recht
auf Schiller und auf den einen Schädel, auch der
andere Schädel darf seinen wissenschaftlichen
Vertretern nicht länger vorenthalten werden. Der
Großherzog von Sachsen-Weimar weigert sich
zwar energisch, den Schillersarg öffnen zu las-
sen. Aber die Freiheit der Wissenschaft wird
selbst vor Großherzogsthronen nicht Halt machen.
Der fortschrittliche Mitarbeiter des Berliner Tage-
blatts wird schon den Weg zu dem Herzen des
Fürsten finden, der den Weg zu Schillers Schädel
öffnet.
Der Dichter in unserer Zeit
„Heute wollen wir durch seine eigenen Worte
zeigen, wie der Dichter Lissauer sich zu seiner
Zeit stellt.“ Mit ernstem feierlichen neuen Pathos
kündigt das Berliner Tageblatt so einen Artikel des
Herrn Lissauer an. Und drei Tage später folgten
ihm im Zeitgeist seine Werke nach. Der Mensch
muß wissen, wie der Dichter Lissauer sich zu sei-
ner Zeit stellt. „Seine auf das Hohe gerichtete
trotzige Art spricht sich in diesem Bekenntnisar-
tikel aus, den er uns auf unsere Bitte zur Verfügung
stellt.“ Die Redaktion des Berliner Tageblatts bittet
und der Dichter Lissauer stellt seine auf das Hohe
gerichtete trotzige Art zur Verfügung. Was der
Dichter Lissauer sagt ist nicht unrichtig und nicht
neu, spricht aber gegen den Dichter, sodaß nur der
Lissauer übrig bleibt. Er sagt: „Das Wesen des
Dichters ist nicht nur, daß er symbolisch schafft,
sondern daß er Symbol ist.“ Hier ist nur das nur
falsch und das Wort Symbol ungeschickt. Aber
das Richtige ist gemeint. Dieser Trotzkopf beruft
sich ferner auf Stefan Zweig, einen unwesent-
lichen Aestheten, der Wesentliches über das Neue
Pathos gesagt haben soll. Das neue Pathos selbst
wird von dem Dichter Lissauer so gedichtet:
Hoch greift an ihm die Gischt, es donnert
wirbelnde Wut,
Brandender Abgrund will ihn niederschlingen,
Allein er geht, den Blick weit in die Welt
gerichtet über die See,
Gelassen hin wie über einen deutschen Schnee.
Und sieh, ihn trägt die Flut,
Und horch, nun hebt sie an zu singen,
Es tönt Musik empor,
Die Wasser schallen unter seinem Fuß im Chor,
Der Raum erdröhnt von ihm, es ziehen
Erwogend unter ihm die Harmonien.
Diese neupathetischen Verse gehören zu einer
„Legende von Bach“. Das Pathos kennen wir
schon recht lange, diese Reime auch. Die letzten
beiden Zeilen gehören sogar zur Klapphornpoesie.
Neu ist nur, daß man über einen deutschen Schnee
gelassen hingeht. Er meint wahrscheinlich den
Schnee, auf dem er die Potsdamerstraße entlang
geweht kommt. Da läßt es sich freilich gelassen
gehen. Gegen das Schallen im Chor würde sich
vermutlich Bach sehr gewendet haben. Aber was
soll man machen, wenn einem der Reim auf empor
fehlt und man das Singen des Chors origineller
sagen will, ohne original zu sein. Was nämlich
sonst in diesen paar Zeilen wallet und siedet und
brandet und zischt und bis zum Himmel an bran-
dender Gischt aufsteigt, das. Dichter Lissauer un-
serer Zeit, hat uns allen schon vorgeschillert.
Neue griechisch-römische Zeitschriften
In Heidelberg hat man immer mal wieder „Die
Argonauten“ aufleben lassen. Mit dieser Zeitschrift
sollen mehrere nicht ganz kunstfeste Lyriker an
das andere Ufer befördert werden.
178