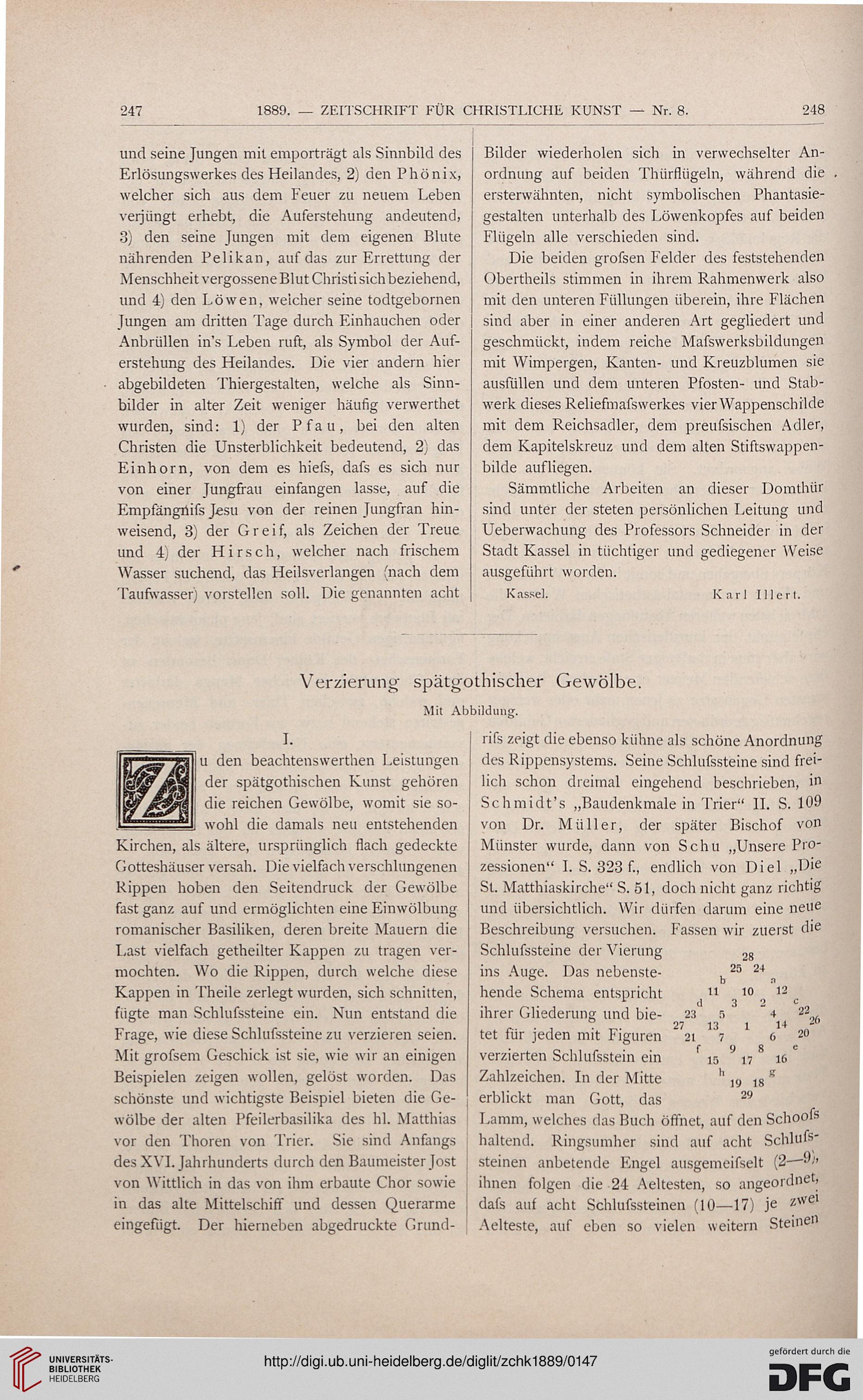247
1889.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 8.
248
und seine Jungen mit emporträgt als Sinnbild des
Erlösungswerkes des Heilandes, 2) den Phönix,
welcher sich aus dem Feuer zu neuem Leben
verjüngt erhebt, die Auferstehung andeutend,
3) den seine Jungen mit dem eigenen Blute
nährenden Pelikan, auf das zur Errettung der
Menschheit vergossene Blut Christi sich beziehend,
und 4) den Löwen, weicher seine todtgebornen
Jungen am dritten Tage durch Einhauchen oder
Anbrüllen in's Leben ruft, als Symbol der Auf-
erstehung des Heilandes. Die vier andern hier
abgebildeten Thiergestalten, welche als Sinn-
bilder in alter Zeit weniger häufig verwerthet
wurden, sind: 1) der Pfau, bei den alten
Christen die Unsterblichkeit bedeutend, 2) das
Einhorn, von dem es hiefs, dafs es sich nur
von einer Jungfrau einfangen lasse, auf die
Empfängilifs Jesu von der reinen Jungfran hin-
weisend, 3) der Greif, als Zeichen der Treue
und 4) der Hirsch, welcher nach frischem
Wasser suchend, das Heilsverlangen (nach dem
Taufwasser) vorstellen soll. Die genannten acht
Bilder wiederholen sich in verwechselter An-
ordnung auf beiden Thürflügeln, während die
ersterwähnten, nicht symbolischen Phantasie-
gestalten unterhalb des Löwenkopfes auf beiden
Flügeln alle verschieden sind.
Die beiden grofsen Felder des feststehenden
Obertheils stimmen in ihrem Rahmenwerk also
mit den unteren Füllungen überein, ihre Flächen
sind aber in einer anderen Art gegliedert und
geschmückt, indem reiche Mafswerksbildungen
mit Wimpergen, Kanten- und Kreuzblumen sie
ausfüllen und dem unteren Pfosten- und Stab-
werk dieses Reliefmafswerkes vier Wappenschilde
mit dem Reichsadler, dem preufsischen Adler,
dem Kapitelskreuz und dem alten Stiftswappen-
bilde aufliegen.
Sämmtliche Arbeiten an dieser Domthür
sind unter der steten persönlichen Leitung und
Ueberwachung des Professors Schneider in der
Stadt Kassel in tüchtiger und gediegener Weise
ausgeführt worden.
Kassel. Karl liiert.
Verzierung spätgothischer Gewölbe.
Mit Abbildung.
I.
u den beachtenswerthen Leistungen
der spätgothischen Kunst gehören
die reichen Gewölbe, womit sie so-
wohl die damals neu entstehenden
Kirchen, als ältere, ursprünglich flach gedeckte
Gotteshäuser versah. Die vielfach verschlungenen
Rippen hoben den Seitendruck der Gewölbe
fast ganz auf und ermöglichten eine Einwölbung
romanischer Basiliken, deren breite Mauern die
Last vielfach getheilter Kappen zu tragen ver-
mochten. Wo die Rippen, durch welche diese
Kappen in Theile zerlegt wurden, sich schnitten,
fügte man Schlufssteine ein. Nun entstand die
Frage, wie diese Schlufssteine zu verzieren seien.
Mit grofsem Geschick ist sie, wie wir an einigen
Beispielen zeigen wollen, gelöst worden. Das
schönste und wichtigste Beispiel bieten die Ge-
wölbe der alten Pfeilerbasilika des hl. Matthias
vor den Thoren von Trier. Sie sind Anfangs
des XVI. Jahrhunderts durch den Baumeister Jost
von Wittlich in das von ihm erbaute Chor sowie
in das alte Mittelschiff und dessen Querarme
eingefügt. Der hierneben abgedruckte Grund-
28
25 24
rifs zeigt die ebenso kühne als schöne Anordnung
des Rippensystems. Seine Schlufssteine sind frei-
lich schon dreimal eingehend beschrieben, in
Schmidt's „Baudenkmale in Trier" IL S. 109
von Dr. Müller, der später Bischof von
Münster wurde, dann von Schu „Unsere Pro-
zessionen" LS. 323 f., endlich von Diel „Die
St. Matthiaskirche" S. 51, doch nicht ganz richtig
und übersichtlich. Wir dürfen darum eine neue
Beschreibung versuchen. Fassen wir zuerst die
Schlufssteine der Vierung
ins Auge. Das nebenste-
hende Schema entspricht
ihrer Gliederung und bie- 23
tet für jeden mit Figuren
verzierten Schlufsstein ein
Zahlzeichen. In der Mitte
erblickt man Gott, das
Lamm, welches das Buch öffnet, auf den Schoofs
haltend. Ringsumher sind auf acht SchltliS"
steinen anbetende Engel ausgemeißelt (2—*>•
ihnen folgen die 24 Aeltesten, so angeordnet,
dafs auf acht Schlufssteinen (10—17) je zwel
Aelteste, auf eben so vielen weitern Steinen
10
12
22
13
14
9 8
15 17 Iß
h g
19 18
29
1889.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 8.
248
und seine Jungen mit emporträgt als Sinnbild des
Erlösungswerkes des Heilandes, 2) den Phönix,
welcher sich aus dem Feuer zu neuem Leben
verjüngt erhebt, die Auferstehung andeutend,
3) den seine Jungen mit dem eigenen Blute
nährenden Pelikan, auf das zur Errettung der
Menschheit vergossene Blut Christi sich beziehend,
und 4) den Löwen, weicher seine todtgebornen
Jungen am dritten Tage durch Einhauchen oder
Anbrüllen in's Leben ruft, als Symbol der Auf-
erstehung des Heilandes. Die vier andern hier
abgebildeten Thiergestalten, welche als Sinn-
bilder in alter Zeit weniger häufig verwerthet
wurden, sind: 1) der Pfau, bei den alten
Christen die Unsterblichkeit bedeutend, 2) das
Einhorn, von dem es hiefs, dafs es sich nur
von einer Jungfrau einfangen lasse, auf die
Empfängilifs Jesu von der reinen Jungfran hin-
weisend, 3) der Greif, als Zeichen der Treue
und 4) der Hirsch, welcher nach frischem
Wasser suchend, das Heilsverlangen (nach dem
Taufwasser) vorstellen soll. Die genannten acht
Bilder wiederholen sich in verwechselter An-
ordnung auf beiden Thürflügeln, während die
ersterwähnten, nicht symbolischen Phantasie-
gestalten unterhalb des Löwenkopfes auf beiden
Flügeln alle verschieden sind.
Die beiden grofsen Felder des feststehenden
Obertheils stimmen in ihrem Rahmenwerk also
mit den unteren Füllungen überein, ihre Flächen
sind aber in einer anderen Art gegliedert und
geschmückt, indem reiche Mafswerksbildungen
mit Wimpergen, Kanten- und Kreuzblumen sie
ausfüllen und dem unteren Pfosten- und Stab-
werk dieses Reliefmafswerkes vier Wappenschilde
mit dem Reichsadler, dem preufsischen Adler,
dem Kapitelskreuz und dem alten Stiftswappen-
bilde aufliegen.
Sämmtliche Arbeiten an dieser Domthür
sind unter der steten persönlichen Leitung und
Ueberwachung des Professors Schneider in der
Stadt Kassel in tüchtiger und gediegener Weise
ausgeführt worden.
Kassel. Karl liiert.
Verzierung spätgothischer Gewölbe.
Mit Abbildung.
I.
u den beachtenswerthen Leistungen
der spätgothischen Kunst gehören
die reichen Gewölbe, womit sie so-
wohl die damals neu entstehenden
Kirchen, als ältere, ursprünglich flach gedeckte
Gotteshäuser versah. Die vielfach verschlungenen
Rippen hoben den Seitendruck der Gewölbe
fast ganz auf und ermöglichten eine Einwölbung
romanischer Basiliken, deren breite Mauern die
Last vielfach getheilter Kappen zu tragen ver-
mochten. Wo die Rippen, durch welche diese
Kappen in Theile zerlegt wurden, sich schnitten,
fügte man Schlufssteine ein. Nun entstand die
Frage, wie diese Schlufssteine zu verzieren seien.
Mit grofsem Geschick ist sie, wie wir an einigen
Beispielen zeigen wollen, gelöst worden. Das
schönste und wichtigste Beispiel bieten die Ge-
wölbe der alten Pfeilerbasilika des hl. Matthias
vor den Thoren von Trier. Sie sind Anfangs
des XVI. Jahrhunderts durch den Baumeister Jost
von Wittlich in das von ihm erbaute Chor sowie
in das alte Mittelschiff und dessen Querarme
eingefügt. Der hierneben abgedruckte Grund-
28
25 24
rifs zeigt die ebenso kühne als schöne Anordnung
des Rippensystems. Seine Schlufssteine sind frei-
lich schon dreimal eingehend beschrieben, in
Schmidt's „Baudenkmale in Trier" IL S. 109
von Dr. Müller, der später Bischof von
Münster wurde, dann von Schu „Unsere Pro-
zessionen" LS. 323 f., endlich von Diel „Die
St. Matthiaskirche" S. 51, doch nicht ganz richtig
und übersichtlich. Wir dürfen darum eine neue
Beschreibung versuchen. Fassen wir zuerst die
Schlufssteine der Vierung
ins Auge. Das nebenste-
hende Schema entspricht
ihrer Gliederung und bie- 23
tet für jeden mit Figuren
verzierten Schlufsstein ein
Zahlzeichen. In der Mitte
erblickt man Gott, das
Lamm, welches das Buch öffnet, auf den Schoofs
haltend. Ringsumher sind auf acht SchltliS"
steinen anbetende Engel ausgemeißelt (2—*>•
ihnen folgen die 24 Aeltesten, so angeordnet,
dafs auf acht Schlufssteinen (10—17) je zwel
Aelteste, auf eben so vielen weitern Steinen
10
12
22
13
14
9 8
15 17 Iß
h g
19 18
29