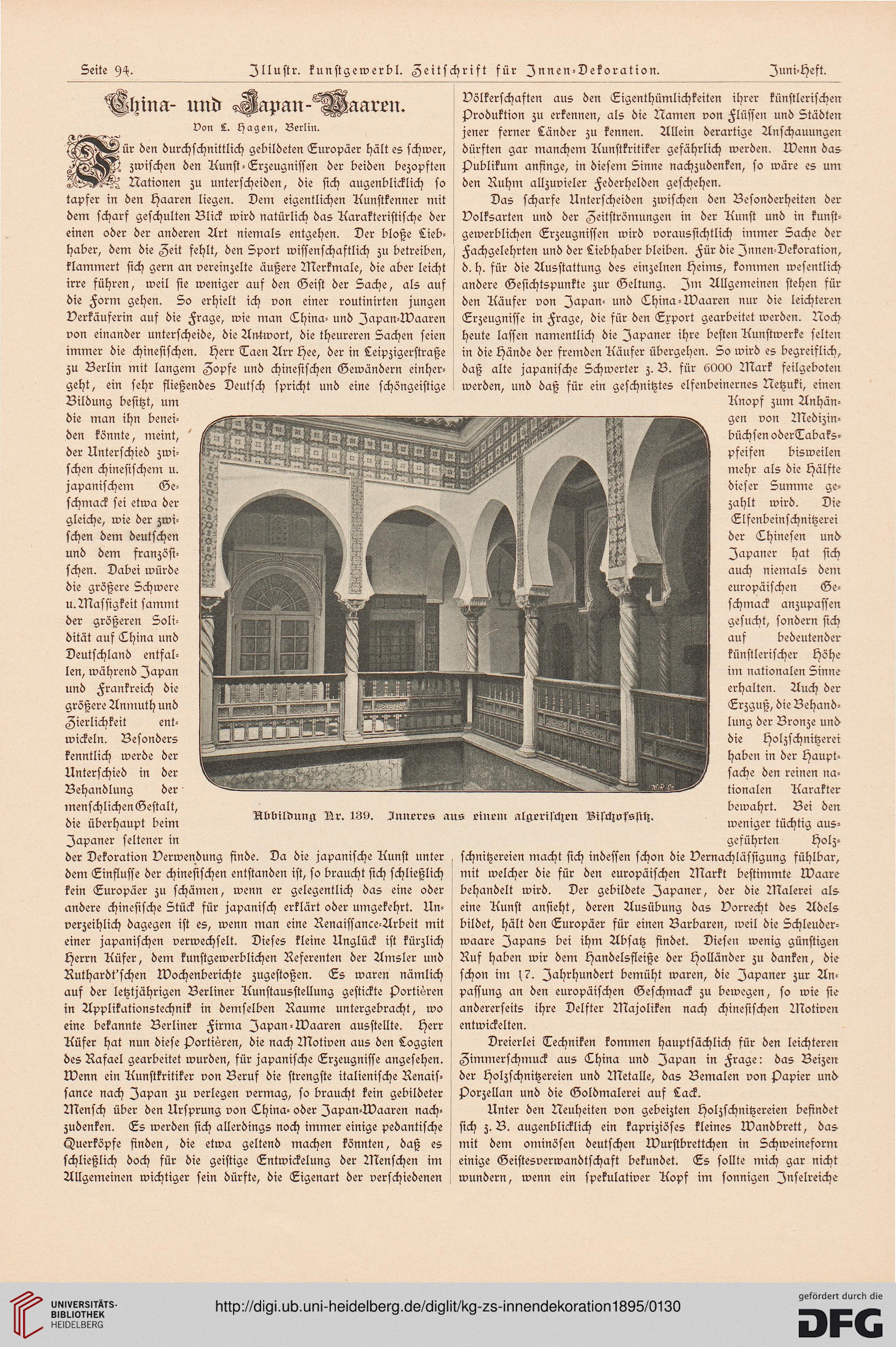Teile 9H.
Illustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Innen-Dekoration.
Juni-Heft.
Mhma- und
von L. klagen, Berlin.
ür den durchschnittlich gebildeten Europäer hält es schwer,
zwischen den Aunst-Erzeugnissen der beiden bezopften
Nationen zu unterscheiden, die sich augenblicklich so
tapfer in den Haaren liegen. Dem eigentlichen Aunstkenner mit
dem scharf geschulten Blick wird natürlich das Aarakteristische der
einen oder der anderen Art niemals entgehen. Der bloße Lieb-
haber, dem die Zeit fehlt, den Sport wissenschaftlich zu betreiben,
klammert sich gern an vereinzelte äußere Merkmale, die aber leicht
irre führen, weil sie weniger auf den Geist der Sache, als auf
die Horm gehen. To erhielt ich von einer routinirten jungen
Verkäuferin aus die Frage, wie man Ehina- und Iapan-Waaren
von einander unterscheide, die Antwort, die theureren Sachen seien
immer die chinesischen. Herr Taen Arr Hee, der in Leipzigerstraße
zu Berlin mit langem Zopfe und chinesischen Gewändern einher-
geht, ein sehr fließendes Deutsch spricht und eine schöngeistige
Bildung besitzt, um
die man ihn benei-
den könnte, meint,
der Unterschied zwi-
schen chinesischem u.
japanischem Ge-
schmack sei etwa der
gleiche, wie der zwi-
schen dem deutschen
und dem französi-
schen. Dabei würde
die größere Schwere
u. Massigkeit sammt
der größeren Soli-
dität auf Ehina und
Deutschland entfal-
len, während Japan
und Frankreich die
größere Anmuth und
Zierlichkeit ent-
wickeln. Besonders
kenntlich werde der
Unterschied in der
Behandlung der
menschlichenGestalt,
die überhaupt beim
Japaner seltener in
der Dekoration Verwendung finde. Da die japanische Aunst unter
dem Einflüsse der chinesischen entstanden ist, so braucht sich schließlich
kein Europäer zu schämen, wenn er gelegentlich das eine oder
andere chinesische Stück für japanisch erklärt oder umgekehrt. Un-
verzeihlich dagegen ist es, wenn man eine Renaissance-Arbeit mit
einer japanischen verwechselt. Dieses kleine Unglück ist kürzlich
Herrn Aüfer, dem kunstgewerblichen Referenten der Amsler und
Ruthardt'schen Wochenberichte zugestoßen. Es waren nämlich
auf der letztjährigen Berliner Aunstausstellung gestickte portisren
in Applikationstechnik in demselben Raume untergebracht, wo
eine bekannte Berliner Firma Japan-Maaren ausstellte. Herr
Aüfer hat nun diese Portieren, die nach Motiven aus den Loggien
des Rafael gearbeitet wurden, für japanische Erzeugnisse angesehen.
Wenn ein Aunstkritiker von Beruf die strengste italienische Renais-
sance nach Japan zu verlegen vermag, so braucht kein gebildeter
Mensch über den Ursprung von Ehina- oder Iapan-Waaren nach-
zudenken. Es werden sich allerdings noch immer einige pedantische
Auerköpfe finden, die etwa geltend machen könnten, daß es
schließlich doch für die geistige Entwickelung der Menschen im
Allgemeinen wichtiger sein dürfte, die Eigenart der verschiedenen
Völkerschaften aus den Eigentümlichkeiten ihrer künstlerischen
Produktion zu erkennen, als die Namen von Flüssen und Städten
jener ferner Länder zu kennen. Allein derartige Anschauungen
dürften gar manchem Aunstkritiker gefährlich werden. Wenn das
Publikum ansinge, in diesem Sinne nachzudenken, so wäre es um
den Ruhm allzuvieler Federhelden geschehen.
Das scharfe Unterscheiden zwischen den Besonderheiten dev
Volksarten und der Zeitströmungen in der Aunst und in kunst-
gewerblichen Erzeugnissen wird voraussichtlich immer Sache dev
Fachgelehrten und der Liebhaber bleiben. Für die Innen-Dekoration,
d. h. für die Ausstattung des einzelnen Heims, kommen wesentlich
andere Gesichtspunkte zur Geltung. Im Allgemeinen stehen für
den Aäufer von Japan- und Ehina-Waaren nur die leichteren
Erzeugnisse in Frage, die für den Export gearbeitet werden. Noch
heute lassen namentlich die Japaner ihre besten Aunstwerke selten
in die Hände der fremden Aäufer übergehen. So wird es begreiflich,
daß alte japanische Schwerter z. B. für 6000 Mark feilgeboten
werden, und daß für ein geschnitztes elfenbeinernes Netzuki, einen
Anopf zum Anhän-
gen von Medizin-
büchsen oderTabaks-
pfeifen bisweilen
mehr als die Hälfte
dieser Summe ge-
zahlt wird. Die
Elfenbeinschnitzerei
der Ehinesen und
Japaner hat sich
auch niemals dem
europäischen Ge-
schmack anzupassen
gesucht, sondern sich
auf bedeutender
künstlerischer Höhe
im nationalen Sinne
erhalten. Auch der
Erzguß, die Behand-
lung der Bronze und
die Holzschnitzerei
haben in der Haupt-
sache den reinen na-
tionalen Aarakter
bewahrt. Bei den
weniger tüchtig aus-
gesührten Holz-
schnitzereien macht sich indessen schon die Vernachlässigung fühlbar,
mit welcher die für den europäischen Markt bestimmte Waare
behandelt wird. Der gebildete Japaner, der die Malerei als
eine Aunst ansieht, deren Ausübung das Vorrecht des Adels
bildet, hält den Europäer für einen Barbaren, weil die Schleuder-
waare Japans bei ihm Absatz findet. Diesen wenig günstigen
Ruf haben wir dem Handelsfleiße der Holländer zu danken, die
schon im s7. Jahrhundert bemüht waren, die Japaner zur An-
passung an den europäischen Geschmack zu bewegen, so wie sie
andererseits ihre Delfter Majoliken nach chinesischen Motiven
entwickelten.
Dreierlei Techniken kommen hauptsächlich für den leichteren
Zimmerschmuck aus Ehina und Japan in Frage: das Beizen
der Holzschnitzereien und Metalle, das Bemalen von Papier und
Porzellan und die Goldmalerei auf Lack.
Unter den Neuheiten von gebeizten Holzschnitzereien befindet
sich z. B. augenblicklich ein kapriziöses kleines Wandbrett, das
mit dem ominösen deutschen Wurstbrettchen in Schweineform
einige Geistesverwandtschaft bekundet. Es sollte mich gar nicht
wundern, wenn ein spekulativer Aopf im sonnigen Inselreiche
Abbildung Nr. 139. Inneres ans einem algerischen Bischofssitz.
Illustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Innen-Dekoration.
Juni-Heft.
Mhma- und
von L. klagen, Berlin.
ür den durchschnittlich gebildeten Europäer hält es schwer,
zwischen den Aunst-Erzeugnissen der beiden bezopften
Nationen zu unterscheiden, die sich augenblicklich so
tapfer in den Haaren liegen. Dem eigentlichen Aunstkenner mit
dem scharf geschulten Blick wird natürlich das Aarakteristische der
einen oder der anderen Art niemals entgehen. Der bloße Lieb-
haber, dem die Zeit fehlt, den Sport wissenschaftlich zu betreiben,
klammert sich gern an vereinzelte äußere Merkmale, die aber leicht
irre führen, weil sie weniger auf den Geist der Sache, als auf
die Horm gehen. To erhielt ich von einer routinirten jungen
Verkäuferin aus die Frage, wie man Ehina- und Iapan-Waaren
von einander unterscheide, die Antwort, die theureren Sachen seien
immer die chinesischen. Herr Taen Arr Hee, der in Leipzigerstraße
zu Berlin mit langem Zopfe und chinesischen Gewändern einher-
geht, ein sehr fließendes Deutsch spricht und eine schöngeistige
Bildung besitzt, um
die man ihn benei-
den könnte, meint,
der Unterschied zwi-
schen chinesischem u.
japanischem Ge-
schmack sei etwa der
gleiche, wie der zwi-
schen dem deutschen
und dem französi-
schen. Dabei würde
die größere Schwere
u. Massigkeit sammt
der größeren Soli-
dität auf Ehina und
Deutschland entfal-
len, während Japan
und Frankreich die
größere Anmuth und
Zierlichkeit ent-
wickeln. Besonders
kenntlich werde der
Unterschied in der
Behandlung der
menschlichenGestalt,
die überhaupt beim
Japaner seltener in
der Dekoration Verwendung finde. Da die japanische Aunst unter
dem Einflüsse der chinesischen entstanden ist, so braucht sich schließlich
kein Europäer zu schämen, wenn er gelegentlich das eine oder
andere chinesische Stück für japanisch erklärt oder umgekehrt. Un-
verzeihlich dagegen ist es, wenn man eine Renaissance-Arbeit mit
einer japanischen verwechselt. Dieses kleine Unglück ist kürzlich
Herrn Aüfer, dem kunstgewerblichen Referenten der Amsler und
Ruthardt'schen Wochenberichte zugestoßen. Es waren nämlich
auf der letztjährigen Berliner Aunstausstellung gestickte portisren
in Applikationstechnik in demselben Raume untergebracht, wo
eine bekannte Berliner Firma Japan-Maaren ausstellte. Herr
Aüfer hat nun diese Portieren, die nach Motiven aus den Loggien
des Rafael gearbeitet wurden, für japanische Erzeugnisse angesehen.
Wenn ein Aunstkritiker von Beruf die strengste italienische Renais-
sance nach Japan zu verlegen vermag, so braucht kein gebildeter
Mensch über den Ursprung von Ehina- oder Iapan-Waaren nach-
zudenken. Es werden sich allerdings noch immer einige pedantische
Auerköpfe finden, die etwa geltend machen könnten, daß es
schließlich doch für die geistige Entwickelung der Menschen im
Allgemeinen wichtiger sein dürfte, die Eigenart der verschiedenen
Völkerschaften aus den Eigentümlichkeiten ihrer künstlerischen
Produktion zu erkennen, als die Namen von Flüssen und Städten
jener ferner Länder zu kennen. Allein derartige Anschauungen
dürften gar manchem Aunstkritiker gefährlich werden. Wenn das
Publikum ansinge, in diesem Sinne nachzudenken, so wäre es um
den Ruhm allzuvieler Federhelden geschehen.
Das scharfe Unterscheiden zwischen den Besonderheiten dev
Volksarten und der Zeitströmungen in der Aunst und in kunst-
gewerblichen Erzeugnissen wird voraussichtlich immer Sache dev
Fachgelehrten und der Liebhaber bleiben. Für die Innen-Dekoration,
d. h. für die Ausstattung des einzelnen Heims, kommen wesentlich
andere Gesichtspunkte zur Geltung. Im Allgemeinen stehen für
den Aäufer von Japan- und Ehina-Waaren nur die leichteren
Erzeugnisse in Frage, die für den Export gearbeitet werden. Noch
heute lassen namentlich die Japaner ihre besten Aunstwerke selten
in die Hände der fremden Aäufer übergehen. So wird es begreiflich,
daß alte japanische Schwerter z. B. für 6000 Mark feilgeboten
werden, und daß für ein geschnitztes elfenbeinernes Netzuki, einen
Anopf zum Anhän-
gen von Medizin-
büchsen oderTabaks-
pfeifen bisweilen
mehr als die Hälfte
dieser Summe ge-
zahlt wird. Die
Elfenbeinschnitzerei
der Ehinesen und
Japaner hat sich
auch niemals dem
europäischen Ge-
schmack anzupassen
gesucht, sondern sich
auf bedeutender
künstlerischer Höhe
im nationalen Sinne
erhalten. Auch der
Erzguß, die Behand-
lung der Bronze und
die Holzschnitzerei
haben in der Haupt-
sache den reinen na-
tionalen Aarakter
bewahrt. Bei den
weniger tüchtig aus-
gesührten Holz-
schnitzereien macht sich indessen schon die Vernachlässigung fühlbar,
mit welcher die für den europäischen Markt bestimmte Waare
behandelt wird. Der gebildete Japaner, der die Malerei als
eine Aunst ansieht, deren Ausübung das Vorrecht des Adels
bildet, hält den Europäer für einen Barbaren, weil die Schleuder-
waare Japans bei ihm Absatz findet. Diesen wenig günstigen
Ruf haben wir dem Handelsfleiße der Holländer zu danken, die
schon im s7. Jahrhundert bemüht waren, die Japaner zur An-
passung an den europäischen Geschmack zu bewegen, so wie sie
andererseits ihre Delfter Majoliken nach chinesischen Motiven
entwickelten.
Dreierlei Techniken kommen hauptsächlich für den leichteren
Zimmerschmuck aus Ehina und Japan in Frage: das Beizen
der Holzschnitzereien und Metalle, das Bemalen von Papier und
Porzellan und die Goldmalerei auf Lack.
Unter den Neuheiten von gebeizten Holzschnitzereien befindet
sich z. B. augenblicklich ein kapriziöses kleines Wandbrett, das
mit dem ominösen deutschen Wurstbrettchen in Schweineform
einige Geistesverwandtschaft bekundet. Es sollte mich gar nicht
wundern, wenn ein spekulativer Aopf im sonnigen Inselreiche
Abbildung Nr. 139. Inneres ans einem algerischen Bischofssitz.