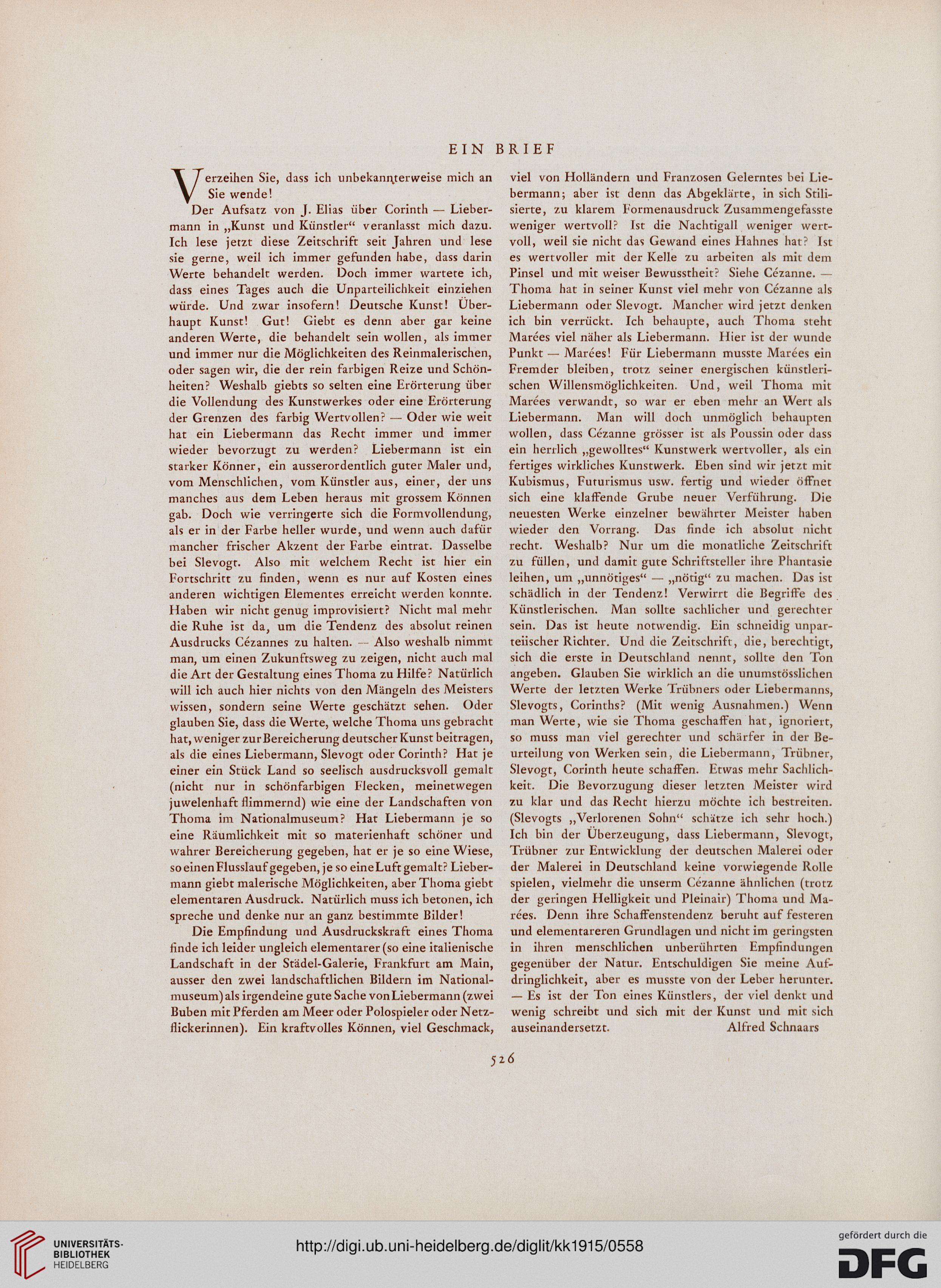EIN BRIEF
Verzeihen Sie, dass ich unbekannterweise mich an
Sie wende!
Der Aufsatz von J. Elias über Corinth — Lieber-
mann in „Kunst und Künstler" veranlasst mich dazu.
Ich lese jetzt diese Zeitschrift seit Jahren und lese
sie gerne, weil ich immer gefunden habe, dass darin
Werte behandelt werden. Doch immer wartete ich,
dass eines Tages auch die Unparteilichkeit einziehen
würde. Und zwar insofern! Deutsche Kunst! Über-
haupt Kunst! Gut! Giebt es denn aber gar keine
anderen Werte, die behandelt sein wollen, als immer
und immer nur die Möglichkeiten des Reinmalerischen,
oder sagen wir, die der rein farbigen Reize und Schön-
heiten? Weshalb giebts so selten eine Erörterung über
die Vollendung des Kunstwerkes oder eine Erörterung
der Grenzen des farbig Wertvollen? — Oder wie weit
hat ein Liebermann das Recht immer und immer
wieder bevorzugt zu werden? Liebermann ist ein
starker Könner, ein ausserordentlich guter Maler und,
vom Menschlichen, vom Künstler aus, einer, der uns
manches aus dem Leben heraus mit grossem Können
gab. Doch wie verringerte sich die Formvollendung,
als er in der Farbe heller wurde, und wenn auch dafür
mancher frischer Akzent der Farbe eintrat. Dasselbe
bei Slevogt. Also mit welchem Recht ist hier ein
Fortschritt zu linden, wenn es nur auf Kosten eines
anderen wichtigen Elementes erreicht werden konnte.
Haben wir nicht genug improvisiert? Nicht mal mehr
die Ruhe ist da, um die Tendenz des absolut reinen
Ausdrucks Cezannes zu halten. — Also weshalb nimmt
man, um einen Zukunftsweg zu zeigen, nicht auch mal
die Art der Gestaltung eines Thoma zu Hilfe? Natürlich
will ich auch hier nichts von den Mängeln des Meisters
wissen, sondern seine Werte geschätzt sehen. Oder
glauben Sie, dass die Werte, welche Thoma uns gebracht
hat, weniger zur Bereicherung deutscher Kunst beitragen,
als die eines Liebermann, Slevogt oder Corinth? Hat je
einer ein Stück Land so seelisch ausdrucksvoll gemalt
(nicht nur in schönfarbigen Flecken, meinetwegen
juwelenhaft flimmernd) wie eine der Landschaften von
Thoma im Nationalmuseum? Hat Liebermann je so
eine Räumlichkeit mit so materienhaft schöner und
wahrer Bereicherung gegeben, hat er je so eine Wiese,
so einen Flusslauf gegeben, je so eineLuft gemalt? Lieber-
mann giebt malerische Möglichkeiten, aber Thoma giebt
elementaren Ausdruck. Natürlich muss ich betonen, ich
spreche und denke nur an ganz bestimmte Bilder!
Die Empfindung und Ausdruckskraft eines Thoma
finde ich leider ungleich elementarer (so eine italienische
Landschaft in der Städel-Galerie, Frankfurt am Main,
ausser den zwei landschaftlichen Bildern im National-
museum) als irgendeine gute Sache von Liebermann (zwei
Buben mit Pferden am Meer oder Polospieler oder Netz-
flickerinnen). Ein kraftvolles Können, viel Geschmack,
viel von Holländern und Franzosen Gelerntes bei Lie-
bermann; aber ist denn das Abgeklärte, in sich Stili-
sierte, zu klarem Formenausdruck Zusammengefasste
weniger wertvoll? Ist die Nachtigall weniger wert-
voll, weil sie nicht das Gewand eines Hahnes hat? Ist
es wertvoller mit der Kelle zu arbeiten als mit dem
Pinsel und mit weiser Bewusstheit? Siehe Cezanne. —
Thoma hat in seiner Kunst viel mehr von Cezanne als
Liebermann oder Slevogt. Mancher wird jetzt denken
ich bin verrückt. Ich behaupte, auch Thoma steht
Marees viel näher als Liebermann. Hier ist der wunde
Punkt — Marees! Für Liebermann musste Marees ein
Fremder bleiben, trotz seiner energischen künstleri-
schen Willensmöglichkeiten. Und, weil Thoma mit
Marees verwandt, so war er eben mehr an Wert als
Liebermann. Man will doch unmöglich behaupten
wollen, dass Cezanne grösser ist als Poussin oder dass
ein herrlich „gewolltes" Kunstwerk wertvoller, als ein
fertiges wirkliches Kunstwerk. Eben sind wir jetzt mit
Kubismus, Futurismus usw. fertig und wieder öffnet
sich eine klaffende Grube neuer Verführung. Die
neuesten Werke einzelner bewährter Meister haben
wieder den Vorrang. Das finde ich absolut nicht
recht. Weshalb? Nur um die monatliche Zeitschrift
zu füllen, und damit gute Schriftsteller ihre Phantasie
leihen, um „unnötiges" — „nötig" zu machen. Das ist
schädlich in der Tendenz! Verwirrt die Begriffe des
Künstlerischen. Man sollte sachlicher und gerechter
sein. Das ist heute notwendig. Ein schneidig unpar-
teiischer Richter. Und die Zeitschrift, die, berechtigt,
sich die erste in Deutschland nennt, sollte den Ton
angeben. Glauben Sie wirklich an die unumstösslichen
Werte der letzten Werke Trübners oder Liebermanns,
Slevogts, Corinths? (Mit wenig Ausnahmen.) Wenn
man Werte, wie sie Thoma geschaffen hat, ignoriert,
so muss man viel gerechter und schärfer in der Be-
urteilung von Werken sein, die Liebermann, Trübner,
Slevogt, Corinth heute schaffen. Etwas mehr Sachlich-
keit. Die Bevorzugung dieser letzten Meister wird
zu klar und das Recht hierzu möchte ich bestreiten.
(Slevogts „Verlorenen Sohn" schätze ich sehr hoch.)
Ich bin der Überzeugung, dass Liebermann, Slevogt,
Trübner zur Entwicklung der deutschen Malerei oder
der Malerei in Deutschland keine vorwiegende Rolle
spielen, vielmehr die unserm Cezanne ähnlichen (trotz
der geringen Helligkeit und Pleinair) Thoma und Ma-
rees. Denn ihre Schaffenstendenz beruht auf festeren
und elementareren Grundlagen und nicht im geringsten
in ihren menschlichen unberührten Empfindungen
gegenüber der Natur. Entschuldigen Sie meine Auf-
dringlichkeit, aber es musste von der Leber herunter.
— Es ist der Ton eines Künstlers, der viel denkt und
wenig schreibt und sich mit der Kunst und mit sich
auseinandersetzt. Alfred Schnaars
526"
Verzeihen Sie, dass ich unbekannterweise mich an
Sie wende!
Der Aufsatz von J. Elias über Corinth — Lieber-
mann in „Kunst und Künstler" veranlasst mich dazu.
Ich lese jetzt diese Zeitschrift seit Jahren und lese
sie gerne, weil ich immer gefunden habe, dass darin
Werte behandelt werden. Doch immer wartete ich,
dass eines Tages auch die Unparteilichkeit einziehen
würde. Und zwar insofern! Deutsche Kunst! Über-
haupt Kunst! Gut! Giebt es denn aber gar keine
anderen Werte, die behandelt sein wollen, als immer
und immer nur die Möglichkeiten des Reinmalerischen,
oder sagen wir, die der rein farbigen Reize und Schön-
heiten? Weshalb giebts so selten eine Erörterung über
die Vollendung des Kunstwerkes oder eine Erörterung
der Grenzen des farbig Wertvollen? — Oder wie weit
hat ein Liebermann das Recht immer und immer
wieder bevorzugt zu werden? Liebermann ist ein
starker Könner, ein ausserordentlich guter Maler und,
vom Menschlichen, vom Künstler aus, einer, der uns
manches aus dem Leben heraus mit grossem Können
gab. Doch wie verringerte sich die Formvollendung,
als er in der Farbe heller wurde, und wenn auch dafür
mancher frischer Akzent der Farbe eintrat. Dasselbe
bei Slevogt. Also mit welchem Recht ist hier ein
Fortschritt zu linden, wenn es nur auf Kosten eines
anderen wichtigen Elementes erreicht werden konnte.
Haben wir nicht genug improvisiert? Nicht mal mehr
die Ruhe ist da, um die Tendenz des absolut reinen
Ausdrucks Cezannes zu halten. — Also weshalb nimmt
man, um einen Zukunftsweg zu zeigen, nicht auch mal
die Art der Gestaltung eines Thoma zu Hilfe? Natürlich
will ich auch hier nichts von den Mängeln des Meisters
wissen, sondern seine Werte geschätzt sehen. Oder
glauben Sie, dass die Werte, welche Thoma uns gebracht
hat, weniger zur Bereicherung deutscher Kunst beitragen,
als die eines Liebermann, Slevogt oder Corinth? Hat je
einer ein Stück Land so seelisch ausdrucksvoll gemalt
(nicht nur in schönfarbigen Flecken, meinetwegen
juwelenhaft flimmernd) wie eine der Landschaften von
Thoma im Nationalmuseum? Hat Liebermann je so
eine Räumlichkeit mit so materienhaft schöner und
wahrer Bereicherung gegeben, hat er je so eine Wiese,
so einen Flusslauf gegeben, je so eineLuft gemalt? Lieber-
mann giebt malerische Möglichkeiten, aber Thoma giebt
elementaren Ausdruck. Natürlich muss ich betonen, ich
spreche und denke nur an ganz bestimmte Bilder!
Die Empfindung und Ausdruckskraft eines Thoma
finde ich leider ungleich elementarer (so eine italienische
Landschaft in der Städel-Galerie, Frankfurt am Main,
ausser den zwei landschaftlichen Bildern im National-
museum) als irgendeine gute Sache von Liebermann (zwei
Buben mit Pferden am Meer oder Polospieler oder Netz-
flickerinnen). Ein kraftvolles Können, viel Geschmack,
viel von Holländern und Franzosen Gelerntes bei Lie-
bermann; aber ist denn das Abgeklärte, in sich Stili-
sierte, zu klarem Formenausdruck Zusammengefasste
weniger wertvoll? Ist die Nachtigall weniger wert-
voll, weil sie nicht das Gewand eines Hahnes hat? Ist
es wertvoller mit der Kelle zu arbeiten als mit dem
Pinsel und mit weiser Bewusstheit? Siehe Cezanne. —
Thoma hat in seiner Kunst viel mehr von Cezanne als
Liebermann oder Slevogt. Mancher wird jetzt denken
ich bin verrückt. Ich behaupte, auch Thoma steht
Marees viel näher als Liebermann. Hier ist der wunde
Punkt — Marees! Für Liebermann musste Marees ein
Fremder bleiben, trotz seiner energischen künstleri-
schen Willensmöglichkeiten. Und, weil Thoma mit
Marees verwandt, so war er eben mehr an Wert als
Liebermann. Man will doch unmöglich behaupten
wollen, dass Cezanne grösser ist als Poussin oder dass
ein herrlich „gewolltes" Kunstwerk wertvoller, als ein
fertiges wirkliches Kunstwerk. Eben sind wir jetzt mit
Kubismus, Futurismus usw. fertig und wieder öffnet
sich eine klaffende Grube neuer Verführung. Die
neuesten Werke einzelner bewährter Meister haben
wieder den Vorrang. Das finde ich absolut nicht
recht. Weshalb? Nur um die monatliche Zeitschrift
zu füllen, und damit gute Schriftsteller ihre Phantasie
leihen, um „unnötiges" — „nötig" zu machen. Das ist
schädlich in der Tendenz! Verwirrt die Begriffe des
Künstlerischen. Man sollte sachlicher und gerechter
sein. Das ist heute notwendig. Ein schneidig unpar-
teiischer Richter. Und die Zeitschrift, die, berechtigt,
sich die erste in Deutschland nennt, sollte den Ton
angeben. Glauben Sie wirklich an die unumstösslichen
Werte der letzten Werke Trübners oder Liebermanns,
Slevogts, Corinths? (Mit wenig Ausnahmen.) Wenn
man Werte, wie sie Thoma geschaffen hat, ignoriert,
so muss man viel gerechter und schärfer in der Be-
urteilung von Werken sein, die Liebermann, Trübner,
Slevogt, Corinth heute schaffen. Etwas mehr Sachlich-
keit. Die Bevorzugung dieser letzten Meister wird
zu klar und das Recht hierzu möchte ich bestreiten.
(Slevogts „Verlorenen Sohn" schätze ich sehr hoch.)
Ich bin der Überzeugung, dass Liebermann, Slevogt,
Trübner zur Entwicklung der deutschen Malerei oder
der Malerei in Deutschland keine vorwiegende Rolle
spielen, vielmehr die unserm Cezanne ähnlichen (trotz
der geringen Helligkeit und Pleinair) Thoma und Ma-
rees. Denn ihre Schaffenstendenz beruht auf festeren
und elementareren Grundlagen und nicht im geringsten
in ihren menschlichen unberührten Empfindungen
gegenüber der Natur. Entschuldigen Sie meine Auf-
dringlichkeit, aber es musste von der Leber herunter.
— Es ist der Ton eines Künstlers, der viel denkt und
wenig schreibt und sich mit der Kunst und mit sich
auseinandersetzt. Alfred Schnaars
526"