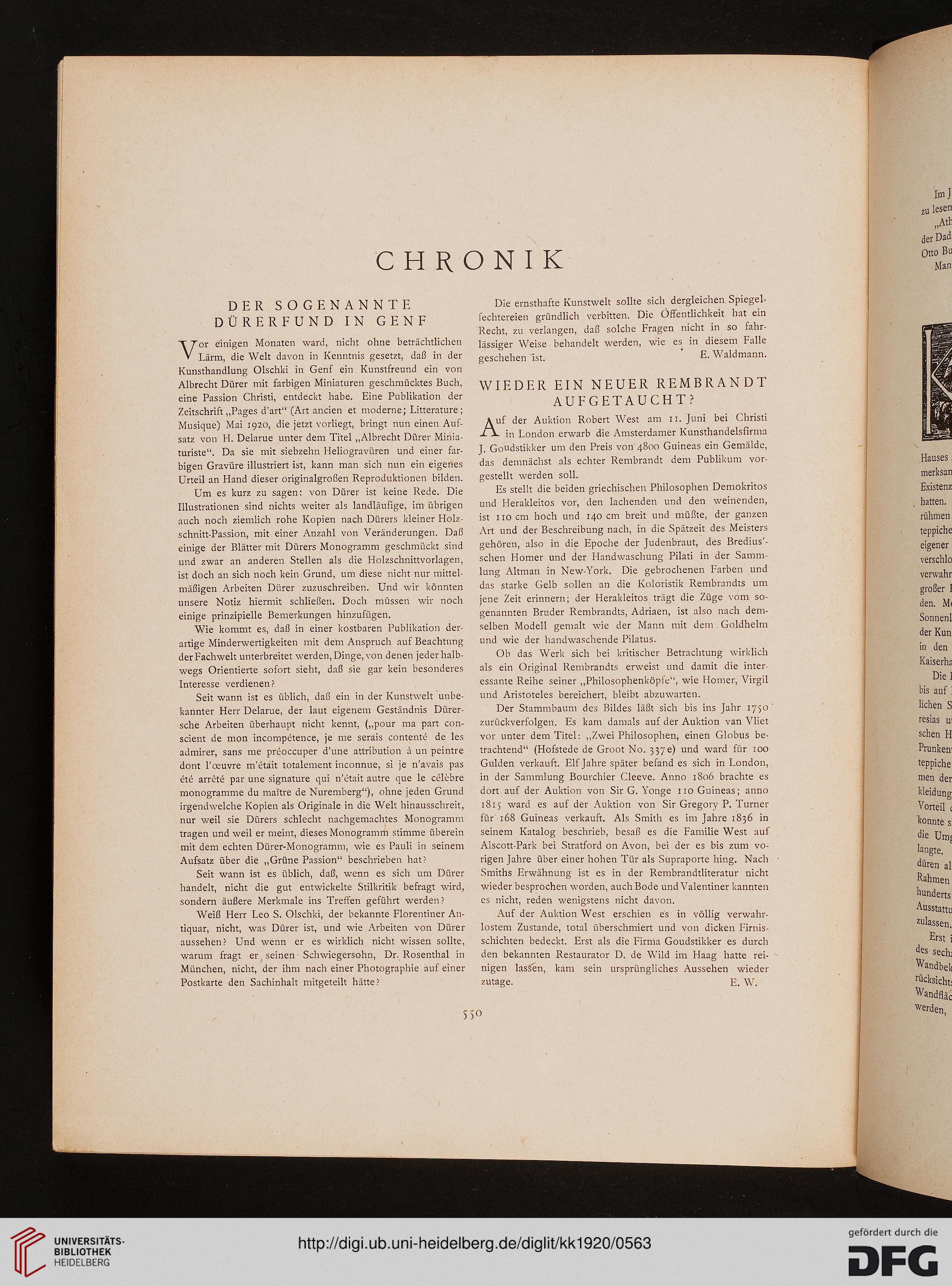CHRONIK
DER SOGENANNTE
DÜREREUND IN GENF
Vor einigen Monaten ward, nicht ohne beträchtlichen
Lärm, die Welt davon in Kenntnis gesetzt, daß in der
Kunsthandlung Olschki in Genf ein Kunstfreund ein von
Albrecht Dürer mit farbigen Miniaturen geschmücktes Buch,
eine Passion Christi, entdeckt habe. Eine Publikation der
Zeitschrift „Pages d'art" (Art ancien et moderne; Litterature ;
Musique) Mai 1920, die jetzt vorliegt, bringt nun einen Auf-
satz von H. Delarue unter dem Titel „Albrecht Dürer Minia-
turiste". Da sie mit siebzehn Heliogravüren und einer far-
bigen Gravüre illustriert ist, kann man sich nun ein eigenes
Urteil an Hand dieser originalgroßen Reproduktionen bilden.
Um es kurz zu sagen: von Dürer ist keine Rede. Die
Illustrationen sind nichts weiter als landläufige, im übrigen
auch noch ziemlich rohe Kopien nach Dürers kleiner Holz-
schnitt-Passion, mit einer Anzahl von Veränderungen. Daß
einige der Blätter mit Dürers Monogramm geschmückt sind
und zwar an anderen Stellen als die Holzschnittvorlagen,
ist doch an sich noch kein Grund, um diese nicht nur mittel-
mäßigen Arbeiten Dürer zuzuschreiben. Und wir könnten
unsere Notiz hiermit schließen. Doch müssen wir noch
einige prinzipielle Bemerkungen hinzufügen.
Wie kommt es, daß in einer kostbaren Publikation der-
artige Minderwertigkeiten mit dem Anspruch auf Beachtung
der Fachwelt unterbreitet werden, Dinge, von denen jeder halb-
wegs Orientierte sofort sieht, daß sie gar kein besonderes
Interesse verdienen?
Seit wann ist es üblich, daß ein in der Kunstwelt unbe-
kannter Herr Delarue, der laut eigenem Geständnis Dürer-
sche Arbeiten überhaupt nicht kennt, („pour ma part con-
scient de mon incompetence, je me serais contente de les
admirer, sans me preoccuper d'une attribution ä un peintre
dont l'ajuvre m'etait totalement inconnue, si je n'avais pas
ete arrete par une signature qui n'etait autre que le ciilebre
monogramme du maitre de Nuremberg"), ohne jeden Grund
irgendwelche Kopien als Originale in die Welt hinausschreit,
nur weil sie Dürers schlecht nachgemachtes Monogramm
tragen und weil er meint, dieses Monogramm stimme überein
mit dem echten Dürer-Monogramm, wie es Pauli in seinem
Aufsatz über die „Grüne Passion" beschrieben hat3
Seit wann ist es üblich, daß, wenn es sich um Dürer
handelt, nicht die gut entwickelte Stilkritik befragt wird,
sondern äußere Merkmale ins Treffen geführt werden?
Weiß Herr Leo S. Olschki, der bekannte Florentiner An-
tiquar, nicht, was Dürer ist, und wie Arbeiten von Dürer
aussehen? Und wenn er es wirklich nicht wissen sollte,
warum fragt er seinen Schwiegersohn, Dr. Rosenthal in
München, nicht, der ihm nach einer Photographie auf einer
Postkarte den Sachinhalt mitgeteilt hätte?
Die ernsthafte Kunstwelt sollte sich dergleichen Spiegel-
fechtereien gründlich verbitten. Die Öffentlichkeit hat ein
Recht, zu verlangen, daß solche Fragen nicht in so fahr-
lässiger Weise behandelt werden, wie es in diesem Falle
geschehen ist. ' E. Waldmann.
WIEDER EIN NEUER REMBRANDT
AUFGETAUCHT?
Auf der Auktion Robert West am 11. Juni bei Christi
- in London erwarb die Amsterdamer Kunsthandelsfirma
J. Goüdstikker um den Preis von 4800 Guineas ein Gemälde,
das demnächst als echter Rembrandt dem Publikum vor-
gestellt werden soll.
Es stellt die beiden griechischen Philosophen Demokritos
und Herakleitos vor, den lachenden und den weinenden,
ist 110 cm hoch und 140 cm breit und müßte, der ganzen
Art und der Beschreibung nach, in die Spätzeit des Meisters
gehören, also in die Epoche der Judenbraut, des Bredius'-
schen Homer und der Handwaschung Pilati in der Samm-
lung Altman in New-York. Die gebrochenen Farben und
das starke Gelb sollen an die Koloristik Rembrandts um
jene Zeit erinnern; der Herakleitos trägt die Züge vom so-
genannten Bruder Rembrandts, Adriaen, ist also nach dem-
selben Modell gemalt wie der Mann mit dem Goldhelm
und wie der handwaschende Pilatus.
Ob das Werk sich bei kritischer Betrachtung wirklich
als ein Original Rembrandts erweist und damit die inter
essante Reihe seiner „Philosophenköpfe", wie Homer, Virgil
und Aristoteles bereichert, bleibt abzuwarten.
Der Stammbaum des Bildes läßt sich bis ins Jahr 1750'
zurückverfolgen. Es kam damals auf der Auktion van Vliet
vor unter dem Titel: „Zwei Philosophen, einen Globus be-
trachtend" (Hofstede de Groot No. 337e) und ward für 100
Gulden verkauft. Elf Jahre später befand es sich in London,
in der Sammlung Bourchier Cleeve. Anno 1806 brachte es
dort auf der Auktion von Sir G. Yonge 110 Guineas; anno
1815 ward es auf der Auktion von Sir Gregory P. Turner
für' 168 Guineas verkauft. Als Smith es im Jahre 1836 in
seinem Katalog beschrieb, besaß es die Familie West auf
Alscott-Park bei Stratford on Avon, bei der es bis zum vo-
rigen Jahre über einer hohen Tür als Supraporte hing. Nach
Smiths Erwähnung ist es in der Rembrandtliteratur nicht
wieder besprochen worden, auch Bode und Valentiner kannten
es nicht, reden wenigstens nicht davon.
Auf der Auktion West erschien es in völlig verwahr-
lostem Zustande, total überschmiert und von dicken Firnis-
schichten bedeckt. Erst als die Firma Goüdstikker es durch
den bekannten Restaurator D. de Wild im Haag hatte rei-
nigen las§en, kam sein ursprüngliches Aussehen wieder
zutage. E. W.
DER SOGENANNTE
DÜREREUND IN GENF
Vor einigen Monaten ward, nicht ohne beträchtlichen
Lärm, die Welt davon in Kenntnis gesetzt, daß in der
Kunsthandlung Olschki in Genf ein Kunstfreund ein von
Albrecht Dürer mit farbigen Miniaturen geschmücktes Buch,
eine Passion Christi, entdeckt habe. Eine Publikation der
Zeitschrift „Pages d'art" (Art ancien et moderne; Litterature ;
Musique) Mai 1920, die jetzt vorliegt, bringt nun einen Auf-
satz von H. Delarue unter dem Titel „Albrecht Dürer Minia-
turiste". Da sie mit siebzehn Heliogravüren und einer far-
bigen Gravüre illustriert ist, kann man sich nun ein eigenes
Urteil an Hand dieser originalgroßen Reproduktionen bilden.
Um es kurz zu sagen: von Dürer ist keine Rede. Die
Illustrationen sind nichts weiter als landläufige, im übrigen
auch noch ziemlich rohe Kopien nach Dürers kleiner Holz-
schnitt-Passion, mit einer Anzahl von Veränderungen. Daß
einige der Blätter mit Dürers Monogramm geschmückt sind
und zwar an anderen Stellen als die Holzschnittvorlagen,
ist doch an sich noch kein Grund, um diese nicht nur mittel-
mäßigen Arbeiten Dürer zuzuschreiben. Und wir könnten
unsere Notiz hiermit schließen. Doch müssen wir noch
einige prinzipielle Bemerkungen hinzufügen.
Wie kommt es, daß in einer kostbaren Publikation der-
artige Minderwertigkeiten mit dem Anspruch auf Beachtung
der Fachwelt unterbreitet werden, Dinge, von denen jeder halb-
wegs Orientierte sofort sieht, daß sie gar kein besonderes
Interesse verdienen?
Seit wann ist es üblich, daß ein in der Kunstwelt unbe-
kannter Herr Delarue, der laut eigenem Geständnis Dürer-
sche Arbeiten überhaupt nicht kennt, („pour ma part con-
scient de mon incompetence, je me serais contente de les
admirer, sans me preoccuper d'une attribution ä un peintre
dont l'ajuvre m'etait totalement inconnue, si je n'avais pas
ete arrete par une signature qui n'etait autre que le ciilebre
monogramme du maitre de Nuremberg"), ohne jeden Grund
irgendwelche Kopien als Originale in die Welt hinausschreit,
nur weil sie Dürers schlecht nachgemachtes Monogramm
tragen und weil er meint, dieses Monogramm stimme überein
mit dem echten Dürer-Monogramm, wie es Pauli in seinem
Aufsatz über die „Grüne Passion" beschrieben hat3
Seit wann ist es üblich, daß, wenn es sich um Dürer
handelt, nicht die gut entwickelte Stilkritik befragt wird,
sondern äußere Merkmale ins Treffen geführt werden?
Weiß Herr Leo S. Olschki, der bekannte Florentiner An-
tiquar, nicht, was Dürer ist, und wie Arbeiten von Dürer
aussehen? Und wenn er es wirklich nicht wissen sollte,
warum fragt er seinen Schwiegersohn, Dr. Rosenthal in
München, nicht, der ihm nach einer Photographie auf einer
Postkarte den Sachinhalt mitgeteilt hätte?
Die ernsthafte Kunstwelt sollte sich dergleichen Spiegel-
fechtereien gründlich verbitten. Die Öffentlichkeit hat ein
Recht, zu verlangen, daß solche Fragen nicht in so fahr-
lässiger Weise behandelt werden, wie es in diesem Falle
geschehen ist. ' E. Waldmann.
WIEDER EIN NEUER REMBRANDT
AUFGETAUCHT?
Auf der Auktion Robert West am 11. Juni bei Christi
- in London erwarb die Amsterdamer Kunsthandelsfirma
J. Goüdstikker um den Preis von 4800 Guineas ein Gemälde,
das demnächst als echter Rembrandt dem Publikum vor-
gestellt werden soll.
Es stellt die beiden griechischen Philosophen Demokritos
und Herakleitos vor, den lachenden und den weinenden,
ist 110 cm hoch und 140 cm breit und müßte, der ganzen
Art und der Beschreibung nach, in die Spätzeit des Meisters
gehören, also in die Epoche der Judenbraut, des Bredius'-
schen Homer und der Handwaschung Pilati in der Samm-
lung Altman in New-York. Die gebrochenen Farben und
das starke Gelb sollen an die Koloristik Rembrandts um
jene Zeit erinnern; der Herakleitos trägt die Züge vom so-
genannten Bruder Rembrandts, Adriaen, ist also nach dem-
selben Modell gemalt wie der Mann mit dem Goldhelm
und wie der handwaschende Pilatus.
Ob das Werk sich bei kritischer Betrachtung wirklich
als ein Original Rembrandts erweist und damit die inter
essante Reihe seiner „Philosophenköpfe", wie Homer, Virgil
und Aristoteles bereichert, bleibt abzuwarten.
Der Stammbaum des Bildes läßt sich bis ins Jahr 1750'
zurückverfolgen. Es kam damals auf der Auktion van Vliet
vor unter dem Titel: „Zwei Philosophen, einen Globus be-
trachtend" (Hofstede de Groot No. 337e) und ward für 100
Gulden verkauft. Elf Jahre später befand es sich in London,
in der Sammlung Bourchier Cleeve. Anno 1806 brachte es
dort auf der Auktion von Sir G. Yonge 110 Guineas; anno
1815 ward es auf der Auktion von Sir Gregory P. Turner
für' 168 Guineas verkauft. Als Smith es im Jahre 1836 in
seinem Katalog beschrieb, besaß es die Familie West auf
Alscott-Park bei Stratford on Avon, bei der es bis zum vo-
rigen Jahre über einer hohen Tür als Supraporte hing. Nach
Smiths Erwähnung ist es in der Rembrandtliteratur nicht
wieder besprochen worden, auch Bode und Valentiner kannten
es nicht, reden wenigstens nicht davon.
Auf der Auktion West erschien es in völlig verwahr-
lostem Zustande, total überschmiert und von dicken Firnis-
schichten bedeckt. Erst als die Firma Goüdstikker es durch
den bekannten Restaurator D. de Wild im Haag hatte rei-
nigen las§en, kam sein ursprüngliches Aussehen wieder
zutage. E. W.