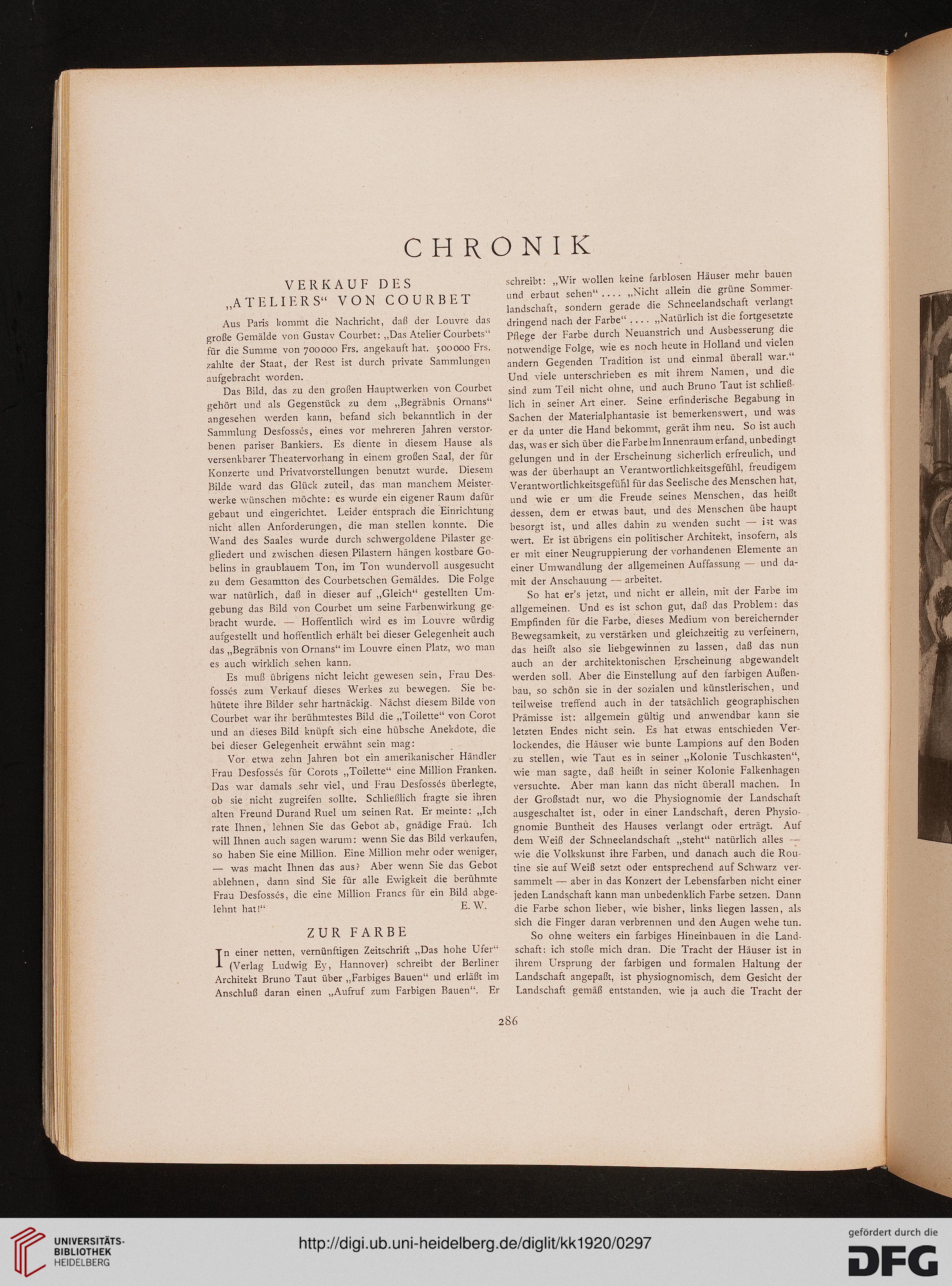CHRONIK
VERKAUF DES
„ATELIERS" VON COURBET
Aus Paris kommt die Nachricht, daß der Louvrc das
große Gemälde von Gustav Courbet: „Das Atelier Courbets"
für die Summe von 700000 Frs. angekauft hat. 500000 Frs.
zahlte der Staat, der Rest ist durch private Sammlungen
aufgebracht worden.
Das Bild, das zu den großen Hauptwerken von Courbet
gehört und als Gegenstück zu dem „Begräbnis Omans"
angesehen werden kann, befand sich bekanntlich in der
Sammlung Desfosscs, eines vor mehreren Jahren verstor-
benen pariser Bankiers. Es diente in diesem Hause als
versenkbarer Theatervorhang in einem großen Saal, der für
Konzerte und Privatvorstellungen benutzt wurde. Diesem
Bilde ward das Glück zuteil, das man manchem Meister-
werke wünschen möchte: es wurde ein eigener Raum dafür
gebaut und eingerichtet. Leider entsprach die Einrichtung
nicht allen Anforderungen, die man stellen konnte. Die
Wand des Saales wurde durch schwergoldene Pilaster ge-
gliedert und zwischen diesen Pilastern hängen kostbare Go-
belins in graublauem Ton, im Ton wundervoll ausgesucht
zu dem Gesamtton des Courbetschen Gemäldes. Die Folge
war natürlich, daß in dieser auf „Gleich" gestellten Um-
gebung das Bild von Courbet um seine Farbenwirkung ge-
bracht wurde. — Hoffentlich wird es im Louvre würdig
aufgestellt und hoffentlich erhält bei dieser Gelegenheit auch
das „Begräbnis von Omans" im Louvre einen Platz, wo man
es auch wirklich sehen kann.
Es muß übrigens nicht leicht gewesen sein, Frau Des-
fosscs zum Verkauf dieses Werkes zu bewegen. Sie be-
hütete ihre Bilder sehr hartnäckig. Nächst diesem Bilde von
Courbet war ihr berühmtestes Bild die „Toilette" von Corot
und an dieses Bild knüpft sich eine hübsche Anekdote, die
bei dieser Gelegenheit erwähnt sein mag:
Vor etwa zehn Jahren bot ein amerikanischer Händler
Frau Desfosscs für Corots „Toilette" eine Million Franken.
Das war damals sehr viel, und Frau Desfossc'S überlegte,
ob sie nicht zugreifen sollte. Schließlich fragte sie ihren
alten Freund Durand Ruel um seinen Rat. Er meinte: „Ich
rate Ihnen, lehnen Sie das Gebot ab, gnädige Frau. Ich
will Ihnen auch sagen warum: wenn Sie das Bild verkaufen,
so haben Sie eine Million. Eine Million mehr oder weniger,
— was macht Ihnen das aus? Aber wenn Sie das Gebot
ablehnen, dann sind Sie für alle Ewigkeit die berühmte
Frau Desfosscs, die eine Million Francs für ein Bild abge-
lehnt hat!" E. W.
ZUR FARBE
In einer netten, vernünftigen Zeitschrift „Das hohe Ufer"
(Verlag Ludwig Ey, Hannover) schreibt der Berliner
Architekt Bruno Taut über „Farbiges Bauen" und erläßt im
Anschluß daran einen „Aufruf zum Farbigen Bauen". Er
schreibt: „Wir wollen keine farblosen Häuser mehr bauen
und erbaut sehen" .... „Nicht allein die grüne Sommer-
landschaft, sondern gerade die Schneelandschaft verlangt
dringend nach der Farbe" .... „Natürlich ist die fortgesetzte
Pflege der Farbe durch Neuanstrich und Ausbesserung die
notwendige Folge, wie es noch heute in Holland und vielen
andern Gegenden Tradition ist und einmal überall war."
Und viele unterschrieben es mit ihrem Namen, und die
sind zum Teil nicht ohne, und auch Bruno Taut ist schließ-
lich in seiner Art einer. Seine erfinderische Begabung in
Sachen der Materialphantasie ist bemerkenswert, und was
er da unter die Hand bekommt, gerät ihm neu. So ist auch
das, was er sich über die Farbe im Innenraum erfand, unbedingt
gelungen und in der Erscheinung sicherlich erfreulich, und
was der überhaupt an Verantwortlichkeitsgefühl, freudigem
Verantwortlichkeitsgefülil für das Seelische des Menschen hat,
und wie er um die Freude seines Menschen, das heißt
dessen, dem er etwas baut, und des Menschen übe haupt
besorgt ist, und alles dahin zu wenden sucht — i;t was
wert. Er ist übrigens ein politischer Architekt, insofern, als
er mit einer Neugruppierung der vorhandenen Elemente an
einer Umwandlung der allgemeinen Auffassung — und da-
mit der Anschauung — arbeitet.
So hat er's jetzt, und nicht er allein, mit der Farbe im
allgemeinen. Und es ist schon gut, daß das Problem: das
Empfinden für die Farbe, dieses Medium von bereichernder
Bewegsamkeit, zu verstärken und gleichzeitig zu verfeinern,
das heißt also sie liebgewinnen zu lassen, daß das nun
auch an der architektonischen Erscheinung abgewandelt
werden soll. Aber die Einstellung auf den farbigen Außen-
bau, so schön sie in der sozialen und künstlerischen, und
teilweise treffend auch in der tatsächlich geographischen
Prämisse ist: allgemein gültig und anwendbar kann sie
letzten Endes nicht sein. Es hat etwas entschieden Ver-
lockendes, die Häuser wie bunte Lampions auf den Boden
zu stellen, wie Taut es in seiner „Kolonie Tuschkasten",
wie man sagte, daß heißt in seiner Kolonie Falkenhagen
versuchte. Aber man kann das nicht überall machen. In
der Großstadt nur, wo die Physiognomie der Landschaft
ausgeschaltet ist, oder in einer Landschaft, deren Physio-
gnomie Buntheit des Hauses verlangt oder erträgt. Auf
dem Weiß der Schneelandschaft „steht" natürlich alles —
wie die Volkskunst ihre Farben, und danach auch die Rou-
tine sie auf Weiß setzt oder entsprechend auf Schwarz ver-
sammelt — aber in das Konzert der Lebensfarben nicht einer
jeden Landschaft kann man unbedenklich Farbe setzen. Dann
die Farbe schon lieber, wie bisher, links liegen lassen, als
sich die Finger daran verbrennen und den Augen wehe tun.
So ohne weiters ein farbiges Hineinbauen in die Land-
schaft: ich stoße mich dran. Die Tracht der Häuser ist in
ihrem Ursprung der farbigen und formalen Haltung der
Landschaft angepaßt, ist physiognomisch, dem Gesicht der
Landschaft gemäß entstanden, wie ja auch die Tracht der
286
VERKAUF DES
„ATELIERS" VON COURBET
Aus Paris kommt die Nachricht, daß der Louvrc das
große Gemälde von Gustav Courbet: „Das Atelier Courbets"
für die Summe von 700000 Frs. angekauft hat. 500000 Frs.
zahlte der Staat, der Rest ist durch private Sammlungen
aufgebracht worden.
Das Bild, das zu den großen Hauptwerken von Courbet
gehört und als Gegenstück zu dem „Begräbnis Omans"
angesehen werden kann, befand sich bekanntlich in der
Sammlung Desfosscs, eines vor mehreren Jahren verstor-
benen pariser Bankiers. Es diente in diesem Hause als
versenkbarer Theatervorhang in einem großen Saal, der für
Konzerte und Privatvorstellungen benutzt wurde. Diesem
Bilde ward das Glück zuteil, das man manchem Meister-
werke wünschen möchte: es wurde ein eigener Raum dafür
gebaut und eingerichtet. Leider entsprach die Einrichtung
nicht allen Anforderungen, die man stellen konnte. Die
Wand des Saales wurde durch schwergoldene Pilaster ge-
gliedert und zwischen diesen Pilastern hängen kostbare Go-
belins in graublauem Ton, im Ton wundervoll ausgesucht
zu dem Gesamtton des Courbetschen Gemäldes. Die Folge
war natürlich, daß in dieser auf „Gleich" gestellten Um-
gebung das Bild von Courbet um seine Farbenwirkung ge-
bracht wurde. — Hoffentlich wird es im Louvre würdig
aufgestellt und hoffentlich erhält bei dieser Gelegenheit auch
das „Begräbnis von Omans" im Louvre einen Platz, wo man
es auch wirklich sehen kann.
Es muß übrigens nicht leicht gewesen sein, Frau Des-
fosscs zum Verkauf dieses Werkes zu bewegen. Sie be-
hütete ihre Bilder sehr hartnäckig. Nächst diesem Bilde von
Courbet war ihr berühmtestes Bild die „Toilette" von Corot
und an dieses Bild knüpft sich eine hübsche Anekdote, die
bei dieser Gelegenheit erwähnt sein mag:
Vor etwa zehn Jahren bot ein amerikanischer Händler
Frau Desfosscs für Corots „Toilette" eine Million Franken.
Das war damals sehr viel, und Frau Desfossc'S überlegte,
ob sie nicht zugreifen sollte. Schließlich fragte sie ihren
alten Freund Durand Ruel um seinen Rat. Er meinte: „Ich
rate Ihnen, lehnen Sie das Gebot ab, gnädige Frau. Ich
will Ihnen auch sagen warum: wenn Sie das Bild verkaufen,
so haben Sie eine Million. Eine Million mehr oder weniger,
— was macht Ihnen das aus? Aber wenn Sie das Gebot
ablehnen, dann sind Sie für alle Ewigkeit die berühmte
Frau Desfosscs, die eine Million Francs für ein Bild abge-
lehnt hat!" E. W.
ZUR FARBE
In einer netten, vernünftigen Zeitschrift „Das hohe Ufer"
(Verlag Ludwig Ey, Hannover) schreibt der Berliner
Architekt Bruno Taut über „Farbiges Bauen" und erläßt im
Anschluß daran einen „Aufruf zum Farbigen Bauen". Er
schreibt: „Wir wollen keine farblosen Häuser mehr bauen
und erbaut sehen" .... „Nicht allein die grüne Sommer-
landschaft, sondern gerade die Schneelandschaft verlangt
dringend nach der Farbe" .... „Natürlich ist die fortgesetzte
Pflege der Farbe durch Neuanstrich und Ausbesserung die
notwendige Folge, wie es noch heute in Holland und vielen
andern Gegenden Tradition ist und einmal überall war."
Und viele unterschrieben es mit ihrem Namen, und die
sind zum Teil nicht ohne, und auch Bruno Taut ist schließ-
lich in seiner Art einer. Seine erfinderische Begabung in
Sachen der Materialphantasie ist bemerkenswert, und was
er da unter die Hand bekommt, gerät ihm neu. So ist auch
das, was er sich über die Farbe im Innenraum erfand, unbedingt
gelungen und in der Erscheinung sicherlich erfreulich, und
was der überhaupt an Verantwortlichkeitsgefühl, freudigem
Verantwortlichkeitsgefülil für das Seelische des Menschen hat,
und wie er um die Freude seines Menschen, das heißt
dessen, dem er etwas baut, und des Menschen übe haupt
besorgt ist, und alles dahin zu wenden sucht — i;t was
wert. Er ist übrigens ein politischer Architekt, insofern, als
er mit einer Neugruppierung der vorhandenen Elemente an
einer Umwandlung der allgemeinen Auffassung — und da-
mit der Anschauung — arbeitet.
So hat er's jetzt, und nicht er allein, mit der Farbe im
allgemeinen. Und es ist schon gut, daß das Problem: das
Empfinden für die Farbe, dieses Medium von bereichernder
Bewegsamkeit, zu verstärken und gleichzeitig zu verfeinern,
das heißt also sie liebgewinnen zu lassen, daß das nun
auch an der architektonischen Erscheinung abgewandelt
werden soll. Aber die Einstellung auf den farbigen Außen-
bau, so schön sie in der sozialen und künstlerischen, und
teilweise treffend auch in der tatsächlich geographischen
Prämisse ist: allgemein gültig und anwendbar kann sie
letzten Endes nicht sein. Es hat etwas entschieden Ver-
lockendes, die Häuser wie bunte Lampions auf den Boden
zu stellen, wie Taut es in seiner „Kolonie Tuschkasten",
wie man sagte, daß heißt in seiner Kolonie Falkenhagen
versuchte. Aber man kann das nicht überall machen. In
der Großstadt nur, wo die Physiognomie der Landschaft
ausgeschaltet ist, oder in einer Landschaft, deren Physio-
gnomie Buntheit des Hauses verlangt oder erträgt. Auf
dem Weiß der Schneelandschaft „steht" natürlich alles —
wie die Volkskunst ihre Farben, und danach auch die Rou-
tine sie auf Weiß setzt oder entsprechend auf Schwarz ver-
sammelt — aber in das Konzert der Lebensfarben nicht einer
jeden Landschaft kann man unbedenklich Farbe setzen. Dann
die Farbe schon lieber, wie bisher, links liegen lassen, als
sich die Finger daran verbrennen und den Augen wehe tun.
So ohne weiters ein farbiges Hineinbauen in die Land-
schaft: ich stoße mich dran. Die Tracht der Häuser ist in
ihrem Ursprung der farbigen und formalen Haltung der
Landschaft angepaßt, ist physiognomisch, dem Gesicht der
Landschaft gemäß entstanden, wie ja auch die Tracht der
286