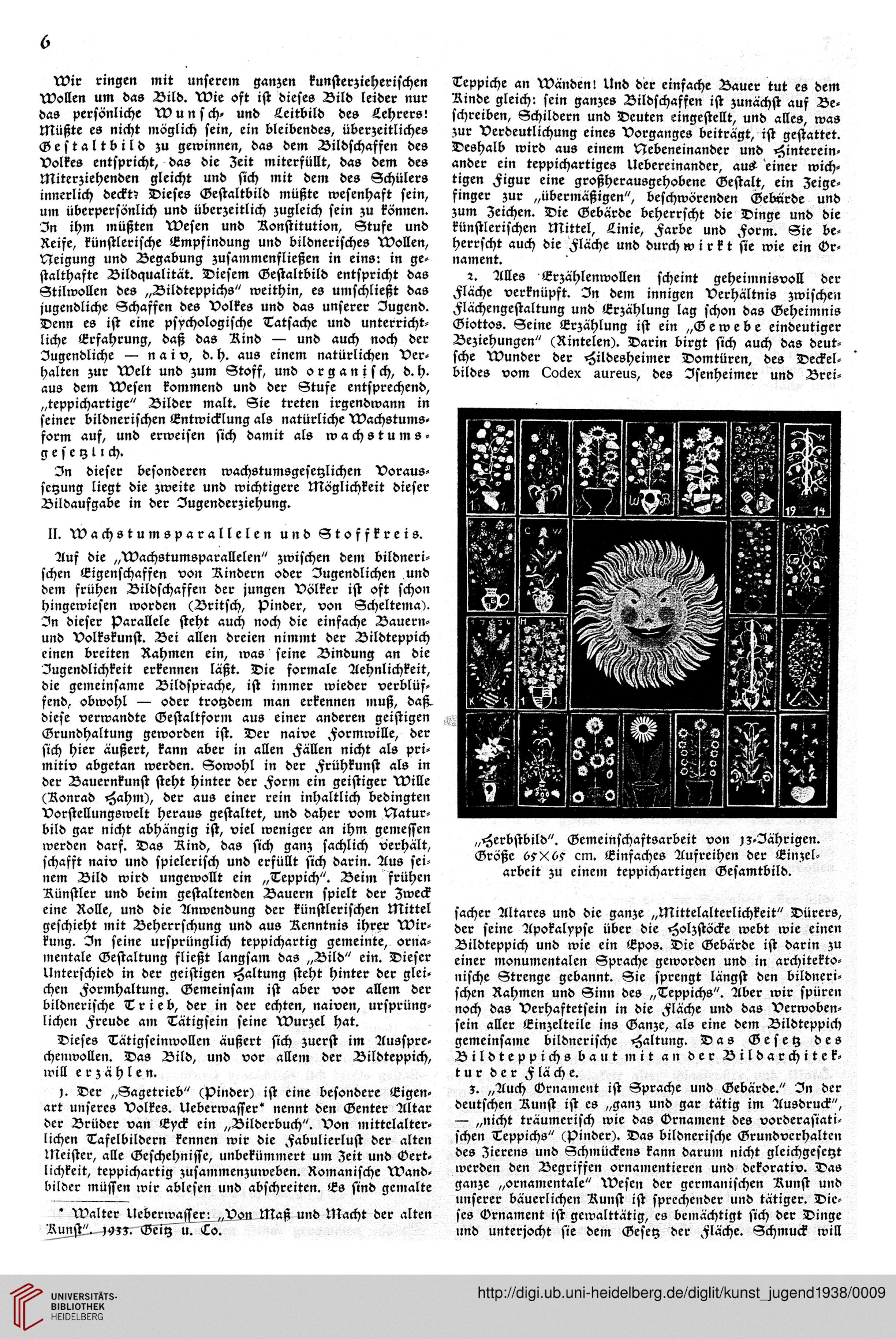6
wir ringen mit unserem ganzen kunsterzieherischen
Wollen um das Bild. wie oft ist dieses Bild leider nur
das persönliche wunsch. und Leitbild des Lehrers!
Müßte es nicht müglich sein, ein bleibendes, überzeitliches
Gestaltbild ;u gewinnen, das dem Bildschaffen des
Volkes entspricht, das die Zeit miterfüllt, das dem des
Miterziehenden gleicht und sich mit dem des Schülers
innerlich deckt; Dieses Gestaltbild müßte wesenhaft sein,
um überpersönlich und Uberzeitlich zugleich sein zu können.
In ihm müßten wesen und Ronstitution, Stufe und
Reife, künstlerische Empfindung und bildnerisches wollen,
Neigung und Begabung zusammenfließen in eins: in ge-
stalthafte Bildqualität. Diesem Gestaltbild entspricht das
Stilwollen des „Bildteppichs" weithin, es umschließt das
jugendliche Schaffen des Volkes und das unserer Iugend.
Denn es ist eine psychologische Tatsache und unterricht-
liche Erfahrung, daß das Rind — und auch noch der
Iugendliche — naiv, d.h. aus einem natürlichen Ver-
halten zur welt und zum Stoff, und organisch, d.h.
aus dem wesen kommend und der Stuse entsprechend,
„teppichartige" Bilder malt. Sie treten irgendwann in
seiner bildnerischen Entwicklung als natürliche wachstums-
form auf, und erweisen sich damit als wachstums-
g e s e y l i ch.
In dieser besonderen wachstumsgesetzlichen Voraus-
seyung liegt die zweite und wichtigere Möglichkeit dieser
Bildaufgabe in der Iugenderziehung.
II. wachstumsparallelen und Stoffkreis.
Auf die „wachstumsparallelen" zwischen dem bildneri-
schen Eigenschaffen von Rindern oder Iugendlichen und
dem frühen Bildschaffen der jungen Völker ist oft schon
hingewiesen worden (Britsch, pinder, von Scheltema).
In dieser parallele steht auch noch die einfache Bauern-
und Volkskunst. Bei allen dreien nimmt der Dildteppich
einen breiten Rahmen ein, was seine Bindung an die
Iugcndlichkeit erkennen läßt. Die formale Aehnlichkeit,
die gemeinsame Bildsprache, ist immer wieder verblüf-
fend, obwohl — oder trotzdem man erkennen muß, daß.
diese verwandte Gestaltform aus einer anderen geistigen
Grundhaltung geworden ist. Der naive Formwille, der
sich hier äußert, kann aber in allen Fällen nicht als pri-
mitiv abgetan werden. Sowohl in der Frühkunst als in
der Bauernkunst steht hinter der Form ein geistiger wille
(Ronrad Hahm), der aus einer rein inhaltlich bedingten
Vorstellungswelt heraus gestaltet, und daher vom Natur-
bild gar nicht abhängig ist, viel weniger an ihm gemeffen
werden darf. Das Rind, das sich gan; sachlich verhält,
schafft naiv und spielerisch und erfüllt sich darin. Aus sei-
nem Bild wird ungewollt ein „Teppich". Beim frühen
Rünstler und beim gestaltenden Bauern spielt der Zweck
eine Rolle, und die Anwendung der künstlerischen Mittel
geschieht mit Beherrschung und aus Renntnis ihrer wir-
kung. In seine ursprünglich teppichartig gemeinte, orna-
mentale Gestaltung fließt langsam das „Bild" ein. Dieser
Unterschied in der geistigen Haltung steht hinter der glei-
chen Formhaltung. Gemeinsam ist aber vor allem der
bildnerische Drieb, der in der echten, naiven, ursprüng-
lichen Freude am Tätigsein seine wurzel hat.
Dieses Tätigseinwollen äußert sich zuerst im Ausspre-
chenwollen. Das Bild, und vor allem der Bildteppich,
will erzählen.
1. Der „Sagetrieb" (pinder) ist eine besondere Eigen-
art unscres Volkes. Ueberwaffer* nennt den Genter Altar
der Drüder van Eyck ein „Bilderbuch". Von mittclalter-
lichen Tafelbildern kennen wir die Fabulierlust der alten
Meister, alle Gcschehniffe, unbekümmert um Zeit und Gert-
lichkeit, teppichartig zusammenzuweben. Romanische wand-
bilder müffen wir ablesen und abschreiten. Es sind gemalte
walter Uebecwaffer: „Von-Maß und Macht der alten
Runsi^io;;. Geitz u. Lo.
Tcppiche an wänden! Und der einfache Bauer tut es dem
Rinde gleich: sein ganzes Bildschaffen isi zunächst auf Be-
schreiben, Schildern und Deuten eingestellt, und alles, was
zur Verdeutlichung eines Vorganges beiträgt, ist gestattet.
Deshalb wird aus einem Nebeneinander und Hinterein-
ander ein teppichartiges Uebereinander, auet 'einer wich-
tigen Figur eine großherausgehobene Gestalt, ein Zeige-
finger zur „übermäßigen", beschwörenden Gebürde und
zum Zeichen. Die Gebärde beherrscht die Dinge und die
künstlerischen Mittel, Linie, Farbe und Form. Sie be-
herrscht auch die Fläche und durch wirkt sie wie ein <l>r-
nament.
r. Alles Erzählenwollen scheint geheimnisvoll dcr
Fläche verknüpft. In dem innigen Verhältnis zwischen
Flächengestaltung und Erzählung lag schon das Geheimnis
Giottos. Seine Erzählung ist ein „Gewebe eindeutiger
Beziehungen" (Rintelen). Darin birgt sich auch das deut-
sche wunder der Hildesheimer Domtüren, des Deckel-
bildes vom Loclex aureus, des Isenheimer und Brei-
„Herbstbild". Gemeinschaftsarbeit von i;-Iährigen.
Größc dyXdy cm. Einfaches Aufreihen der Einzel-
arbeit ;u einem teppichartigen Gesamtbild.
sacher Altares und die ganze „Mittelalterlichkeit" Dürers,
der seine Apokalypse über die Holzstöcke webt wie einen
Bildteppich und wie ein Epos. Die Gebärde ist darin ;»
einer monumentalen Sprache geworden und in architekto-
nische Strenge gebannt. Sie sprengt längst den bildneri-
schen Rahmen und Sinn des „Teppichs". Aber wir spüren
noch das Verhaftetsein in die Fläche und das Verwoben-
sein aller Einzelteile ins Ganze, als eine dem Bildteppich
gemeinsame bildnerische Haltung. Das Gesetz des
Bildteppichs baut mit an der Bildarchitek-
tur der Fläche.
;. „Auch Grnament ist Sprache und Gcbärde." In dcr
deutschen Runst ist es „gan; und gar tätig im Ausdruck",
— „nicht träumerisch wie das Grnament des vorderasiati-
schen Teppichs" (pinder). Das bildnerische Grundvcrhalten
des Zierens und Schmückens kann darum nicht gleichgescyt
werden den Degriffen ornamentieren und dckorativ. Das
ganze „ornamentale" wesen der gcrmanischen Runst und
unserer bäuerlichen Runst ist sprechender und tätiger. Dic-
ses Grnament ist gewalttätig, cs bemächtigt sich der Dingc
und unterjocht sie dem Gesetz der Fläche. Schmuck will
wir ringen mit unserem ganzen kunsterzieherischen
Wollen um das Bild. wie oft ist dieses Bild leider nur
das persönliche wunsch. und Leitbild des Lehrers!
Müßte es nicht müglich sein, ein bleibendes, überzeitliches
Gestaltbild ;u gewinnen, das dem Bildschaffen des
Volkes entspricht, das die Zeit miterfüllt, das dem des
Miterziehenden gleicht und sich mit dem des Schülers
innerlich deckt; Dieses Gestaltbild müßte wesenhaft sein,
um überpersönlich und Uberzeitlich zugleich sein zu können.
In ihm müßten wesen und Ronstitution, Stufe und
Reife, künstlerische Empfindung und bildnerisches wollen,
Neigung und Begabung zusammenfließen in eins: in ge-
stalthafte Bildqualität. Diesem Gestaltbild entspricht das
Stilwollen des „Bildteppichs" weithin, es umschließt das
jugendliche Schaffen des Volkes und das unserer Iugend.
Denn es ist eine psychologische Tatsache und unterricht-
liche Erfahrung, daß das Rind — und auch noch der
Iugendliche — naiv, d.h. aus einem natürlichen Ver-
halten zur welt und zum Stoff, und organisch, d.h.
aus dem wesen kommend und der Stuse entsprechend,
„teppichartige" Bilder malt. Sie treten irgendwann in
seiner bildnerischen Entwicklung als natürliche wachstums-
form auf, und erweisen sich damit als wachstums-
g e s e y l i ch.
In dieser besonderen wachstumsgesetzlichen Voraus-
seyung liegt die zweite und wichtigere Möglichkeit dieser
Bildaufgabe in der Iugenderziehung.
II. wachstumsparallelen und Stoffkreis.
Auf die „wachstumsparallelen" zwischen dem bildneri-
schen Eigenschaffen von Rindern oder Iugendlichen und
dem frühen Bildschaffen der jungen Völker ist oft schon
hingewiesen worden (Britsch, pinder, von Scheltema).
In dieser parallele steht auch noch die einfache Bauern-
und Volkskunst. Bei allen dreien nimmt der Dildteppich
einen breiten Rahmen ein, was seine Bindung an die
Iugcndlichkeit erkennen läßt. Die formale Aehnlichkeit,
die gemeinsame Bildsprache, ist immer wieder verblüf-
fend, obwohl — oder trotzdem man erkennen muß, daß.
diese verwandte Gestaltform aus einer anderen geistigen
Grundhaltung geworden ist. Der naive Formwille, der
sich hier äußert, kann aber in allen Fällen nicht als pri-
mitiv abgetan werden. Sowohl in der Frühkunst als in
der Bauernkunst steht hinter der Form ein geistiger wille
(Ronrad Hahm), der aus einer rein inhaltlich bedingten
Vorstellungswelt heraus gestaltet, und daher vom Natur-
bild gar nicht abhängig ist, viel weniger an ihm gemeffen
werden darf. Das Rind, das sich gan; sachlich verhält,
schafft naiv und spielerisch und erfüllt sich darin. Aus sei-
nem Bild wird ungewollt ein „Teppich". Beim frühen
Rünstler und beim gestaltenden Bauern spielt der Zweck
eine Rolle, und die Anwendung der künstlerischen Mittel
geschieht mit Beherrschung und aus Renntnis ihrer wir-
kung. In seine ursprünglich teppichartig gemeinte, orna-
mentale Gestaltung fließt langsam das „Bild" ein. Dieser
Unterschied in der geistigen Haltung steht hinter der glei-
chen Formhaltung. Gemeinsam ist aber vor allem der
bildnerische Drieb, der in der echten, naiven, ursprüng-
lichen Freude am Tätigsein seine wurzel hat.
Dieses Tätigseinwollen äußert sich zuerst im Ausspre-
chenwollen. Das Bild, und vor allem der Bildteppich,
will erzählen.
1. Der „Sagetrieb" (pinder) ist eine besondere Eigen-
art unscres Volkes. Ueberwaffer* nennt den Genter Altar
der Drüder van Eyck ein „Bilderbuch". Von mittclalter-
lichen Tafelbildern kennen wir die Fabulierlust der alten
Meister, alle Gcschehniffe, unbekümmert um Zeit und Gert-
lichkeit, teppichartig zusammenzuweben. Romanische wand-
bilder müffen wir ablesen und abschreiten. Es sind gemalte
walter Uebecwaffer: „Von-Maß und Macht der alten
Runsi^io;;. Geitz u. Lo.
Tcppiche an wänden! Und der einfache Bauer tut es dem
Rinde gleich: sein ganzes Bildschaffen isi zunächst auf Be-
schreiben, Schildern und Deuten eingestellt, und alles, was
zur Verdeutlichung eines Vorganges beiträgt, ist gestattet.
Deshalb wird aus einem Nebeneinander und Hinterein-
ander ein teppichartiges Uebereinander, auet 'einer wich-
tigen Figur eine großherausgehobene Gestalt, ein Zeige-
finger zur „übermäßigen", beschwörenden Gebürde und
zum Zeichen. Die Gebärde beherrscht die Dinge und die
künstlerischen Mittel, Linie, Farbe und Form. Sie be-
herrscht auch die Fläche und durch wirkt sie wie ein <l>r-
nament.
r. Alles Erzählenwollen scheint geheimnisvoll dcr
Fläche verknüpft. In dem innigen Verhältnis zwischen
Flächengestaltung und Erzählung lag schon das Geheimnis
Giottos. Seine Erzählung ist ein „Gewebe eindeutiger
Beziehungen" (Rintelen). Darin birgt sich auch das deut-
sche wunder der Hildesheimer Domtüren, des Deckel-
bildes vom Loclex aureus, des Isenheimer und Brei-
„Herbstbild". Gemeinschaftsarbeit von i;-Iährigen.
Größc dyXdy cm. Einfaches Aufreihen der Einzel-
arbeit ;u einem teppichartigen Gesamtbild.
sacher Altares und die ganze „Mittelalterlichkeit" Dürers,
der seine Apokalypse über die Holzstöcke webt wie einen
Bildteppich und wie ein Epos. Die Gebärde ist darin ;»
einer monumentalen Sprache geworden und in architekto-
nische Strenge gebannt. Sie sprengt längst den bildneri-
schen Rahmen und Sinn des „Teppichs". Aber wir spüren
noch das Verhaftetsein in die Fläche und das Verwoben-
sein aller Einzelteile ins Ganze, als eine dem Bildteppich
gemeinsame bildnerische Haltung. Das Gesetz des
Bildteppichs baut mit an der Bildarchitek-
tur der Fläche.
;. „Auch Grnament ist Sprache und Gcbärde." In dcr
deutschen Runst ist es „gan; und gar tätig im Ausdruck",
— „nicht träumerisch wie das Grnament des vorderasiati-
schen Teppichs" (pinder). Das bildnerische Grundvcrhalten
des Zierens und Schmückens kann darum nicht gleichgescyt
werden den Degriffen ornamentieren und dckorativ. Das
ganze „ornamentale" wesen der gcrmanischen Runst und
unserer bäuerlichen Runst ist sprechender und tätiger. Dic-
ses Grnament ist gewalttätig, cs bemächtigt sich der Dingc
und unterjocht sie dem Gesetz der Fläche. Schmuck will