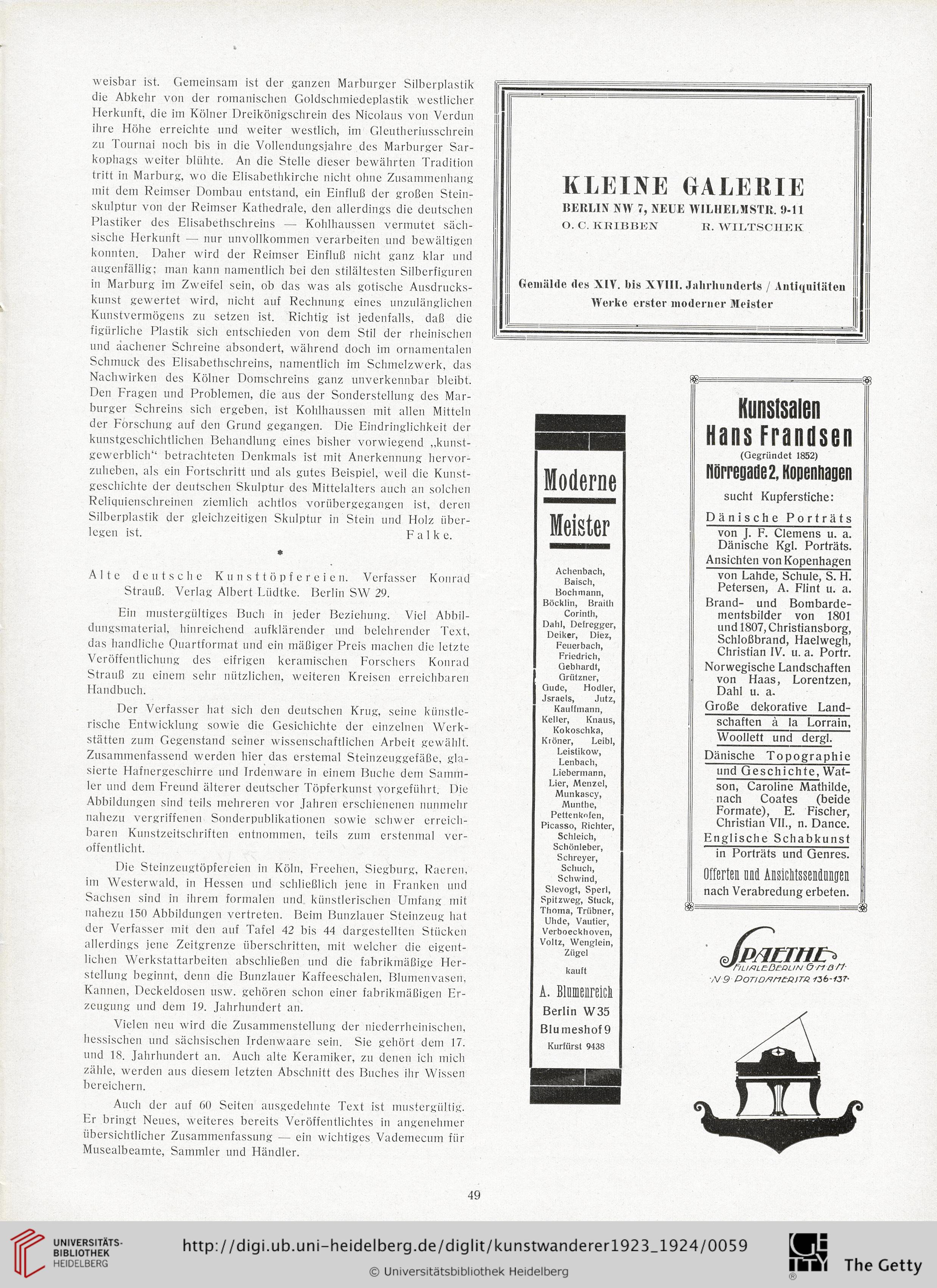weisbar ist. Gemeinsam ist der ganzen Marburger Silberplastik
die Abkelir von der romanischen Goldschmiedeplastik westlicher
Herkunft, die im Kölner Dreikönigschrein des Nicolaus von Verdun
ihre Höhe erreichte und weiter westlich, im Gleutheriusschrein
zu Tournai noch bis in die Vollendungsjahre des Marburger Sar-
kophags weiter blühte. An die Stelle dieser bewährten Tradition
tritt in Marburg, wo die Elisabethkirche nicht ohne Zusammenhang
mit dem Reimser Dombau entstand, ein Einfluß der großen Stein-
skulptur von der Reimser Kathedrale, den allerdings die deutschen
Plastiker des Elisabethschreins — Kohlhaussen vermutet säch-
sische Herkunft — nur unvollkommen verarbeiten und bewältigen
konnten. Daher wird der Reimser Einfluß niclit ganz klar und
augenfällig; man kann namentlich bei den stilältesten Silberfiguren
in Marburg im Zweifel sein, ob das was als gotische Ausdrucks-
kunst gewertet wird, nicht auf Rechnung eines unzulänglichen
Kunstvermögens zu setzen ist. Richtig ist jedenfalls, daß die
figürliche Plastik sich entschieden von dem Stil der rheinischen
und äachener Schreine absondert, während doch im ornamentalen
Schmuck des Elisabethschreins, namentlich im Schmelzwerk, das
Nachwirken des Kölner Domschreins ganz unverkennbar bleibt.
Den Fragen und Problemen, die aus der Sonderstellung des Mar-
burger Schreins sich ergeben, ist Kohlhaussen mit allen Mitteln
der Forschung auf den Grund gegangen. Die Eindringlichkeit der
kunstgeschichtlichen Behandlung eines bisher vorwiegend „kunst-
gewerblich“ betrachteten Denkmals ist mit Anerkennung hervor-
zuheben, als ein Fortschritt und als gutes Beispiel, weil die Kunst-
geschichte der deutschen Skulptur des Mittelalters auch an soichen
Reliquienschreinen ziemlich achtlos vorübergegangen ist, dcren
Silberplastik der gleichzeitigen Skulptur in Stein und Holz über-
legen ist. F a 1 k e.
*
Alte deutsche Kunsttöpfereien. Verfasser Konrad
Strauß. Verlag Albert Liidtke. Berlin SW 29.
Ein mustergültiges Buch in jeder Beziehung. Viel Abbil-
dungsmaterial, hinreichend aufklärender und belehrender Text,
das handliche Ouartformat und ein mäßiger Preis machen die letzte
Veröffentlichung des eifrigen keramischen Forschers Konrad
Strauß zu einem sehr nützlichen, weiteren Kreisen erreichbaren
Handbuch.
Der Verfasser hat sich den deutschen Krug, seine künstle-
rische Entwicklung sowie die Gesichichte der einzelnen Werk-
stätten zum Gegenstand seiner wissenschaftlichen Arbeit gewählt.
Zusammenfassend werden hier das erstemal Steinzeuggefäße, gla-
sierte Hafnergeschirre und Irdenware in einem Buche dem Samm-
Ier und dem Freund älterer deutscher Töpferkunst vorgeführt. Die
Abbildungen sind teils mehreren vor Jahren erschienenen nunmehr
nahezu vergriffenen Sonderpublikationen sowie schwer erreich-
baren Kunstzeitschriften entnommen, teils zum erstenmal ver-
offentlicht.
Die Steinzeugtöpfereien in Köln, Freehen, Siegburg, Raeren,
im Westerwald, in Hessen und schließlich jene in Franken und
Sachsen sind in ihrem formalen und künstlerischen Umfang mit
nahezu 150 Abbildungen vertreten. Beim Bunzlauer Steinzeug hat
der Verfasser mit den auf Tafel 42 bis 44 dargestellten Stücken
allerdings jene Zeitgrenze überschritten, mit welcher die eigent-
lichen Werkstattarbeiten abschließen und die fabrikmäßige Her-
stellung beginnt, denn die Bunzlauer Kaffeeschälen, Blumenvasen,
Kannen, Deckeldosen usw. gehören schon einer fabrikmäßigen Er-
zeugung und dem 19. Jahrhundert an.
Vielen neu wird die Zusammenstellung der niederrheinischen,
hessischen und sächsischen Irdenwaare sein. Sie gehört dem 17.
und 18. Jahrhundert an. Auch alte Keramiker, zu denen ich mich
zähle, werden aus diesem letzten Abschnitt des Buches ihr Wissen
bereichern.
Auch der auf 60 Seiten ausgedehnte Text ist mustergültig.
Er bringt Neues, weiteres bereits Veröffentlichtes in angenehmer
übersichtlicher Zusammenfassung — ein wichtiges Vademecum für
Musealbeamte, Sammler und Händler.
KLEINE (IALERIE
BERLIN NW 7, NEUE WILHELMSTR. 9-11
O. C. KRIBBBN K. WILTSCHEK
Geniiiltle <Ies XIV. bis XVIII. Jahrliunderts / Antiquitäten
Werke erster moderncr Meister
Moderne
Achenbach,
Baisch,
Bochmann,
Böcklin, Braith
Corinth,
Dahl, Defregger,
Deiker, Diez,
Feuerbach,
Friedrich,
Gebhardt,
Grützner,
Gude, Hodler,
Jsraels, Jutz,
Kauffmann,
Keller, Knaus,
Kokoschka,
Kröner, Leibl,
Leistikow,
Lenbach,
Liebermann,
Lier, Menzel,
Munkascy,
Munthe,
Pettenkofen,
Picasso, Richter,
Schleich,
Schönleber,
Schreyer,
Schuch,
Schwind,
Slevogt, Sperl,
Spitzweg, Stuck,
Thoma, Trübner,
Uhde, Vautier,
Verboeckhoven,
Voltz, Wenglein,
Zügel
kauft
A. Blumeiireicli
Berlin W35
Blumeshof 9
Kurfürst 9438
3g -■..—.gg
Kunstsaien
Hans Frandsen
(Gegriindet 1852)
nörregade2, Kopenliagen
sucht Kupferstiche;
Dänische Porträts
von J. F. Clemens u. a.
Dänische Kgl. Porträts.
Ansichten vonKopenhagen
von Lahde, Schule, S. H.
Petersen, A. Flint u. a.
Brand- und Bombarde-
mentsbilder von 1801
und 1807, Christiansborg,
Schloßbrand, Haelwegh,
Christian IV. u. a. Portr.
Norwegische Landschaften
von Haas, Lorentzen,
Dahl u. a.
Große dekorative Land-
schaften ä la Lorrain,
Woollett und dergl.
Dänische Topographie
und Geschichte, Wat-
son, Caroline Mathilde,
nach Coates (beide
Formate), E. Fischer,
Christian VII., n. Dance.
Englische Schabkunst
in Porträts und Genres.
Offerten ona Ansichtsseniunffen
nach Verabredung erbeten.
§8' 38
Jj>u
V-^7/ /X7/ F-ßF
jp/IETHEr*
ialelDedun ö rr b n-
/V9 POTIDFinEQlTR IZb-IZI-
49
die Abkelir von der romanischen Goldschmiedeplastik westlicher
Herkunft, die im Kölner Dreikönigschrein des Nicolaus von Verdun
ihre Höhe erreichte und weiter westlich, im Gleutheriusschrein
zu Tournai noch bis in die Vollendungsjahre des Marburger Sar-
kophags weiter blühte. An die Stelle dieser bewährten Tradition
tritt in Marburg, wo die Elisabethkirche nicht ohne Zusammenhang
mit dem Reimser Dombau entstand, ein Einfluß der großen Stein-
skulptur von der Reimser Kathedrale, den allerdings die deutschen
Plastiker des Elisabethschreins — Kohlhaussen vermutet säch-
sische Herkunft — nur unvollkommen verarbeiten und bewältigen
konnten. Daher wird der Reimser Einfluß niclit ganz klar und
augenfällig; man kann namentlich bei den stilältesten Silberfiguren
in Marburg im Zweifel sein, ob das was als gotische Ausdrucks-
kunst gewertet wird, nicht auf Rechnung eines unzulänglichen
Kunstvermögens zu setzen ist. Richtig ist jedenfalls, daß die
figürliche Plastik sich entschieden von dem Stil der rheinischen
und äachener Schreine absondert, während doch im ornamentalen
Schmuck des Elisabethschreins, namentlich im Schmelzwerk, das
Nachwirken des Kölner Domschreins ganz unverkennbar bleibt.
Den Fragen und Problemen, die aus der Sonderstellung des Mar-
burger Schreins sich ergeben, ist Kohlhaussen mit allen Mitteln
der Forschung auf den Grund gegangen. Die Eindringlichkeit der
kunstgeschichtlichen Behandlung eines bisher vorwiegend „kunst-
gewerblich“ betrachteten Denkmals ist mit Anerkennung hervor-
zuheben, als ein Fortschritt und als gutes Beispiel, weil die Kunst-
geschichte der deutschen Skulptur des Mittelalters auch an soichen
Reliquienschreinen ziemlich achtlos vorübergegangen ist, dcren
Silberplastik der gleichzeitigen Skulptur in Stein und Holz über-
legen ist. F a 1 k e.
*
Alte deutsche Kunsttöpfereien. Verfasser Konrad
Strauß. Verlag Albert Liidtke. Berlin SW 29.
Ein mustergültiges Buch in jeder Beziehung. Viel Abbil-
dungsmaterial, hinreichend aufklärender und belehrender Text,
das handliche Ouartformat und ein mäßiger Preis machen die letzte
Veröffentlichung des eifrigen keramischen Forschers Konrad
Strauß zu einem sehr nützlichen, weiteren Kreisen erreichbaren
Handbuch.
Der Verfasser hat sich den deutschen Krug, seine künstle-
rische Entwicklung sowie die Gesichichte der einzelnen Werk-
stätten zum Gegenstand seiner wissenschaftlichen Arbeit gewählt.
Zusammenfassend werden hier das erstemal Steinzeuggefäße, gla-
sierte Hafnergeschirre und Irdenware in einem Buche dem Samm-
Ier und dem Freund älterer deutscher Töpferkunst vorgeführt. Die
Abbildungen sind teils mehreren vor Jahren erschienenen nunmehr
nahezu vergriffenen Sonderpublikationen sowie schwer erreich-
baren Kunstzeitschriften entnommen, teils zum erstenmal ver-
offentlicht.
Die Steinzeugtöpfereien in Köln, Freehen, Siegburg, Raeren,
im Westerwald, in Hessen und schließlich jene in Franken und
Sachsen sind in ihrem formalen und künstlerischen Umfang mit
nahezu 150 Abbildungen vertreten. Beim Bunzlauer Steinzeug hat
der Verfasser mit den auf Tafel 42 bis 44 dargestellten Stücken
allerdings jene Zeitgrenze überschritten, mit welcher die eigent-
lichen Werkstattarbeiten abschließen und die fabrikmäßige Her-
stellung beginnt, denn die Bunzlauer Kaffeeschälen, Blumenvasen,
Kannen, Deckeldosen usw. gehören schon einer fabrikmäßigen Er-
zeugung und dem 19. Jahrhundert an.
Vielen neu wird die Zusammenstellung der niederrheinischen,
hessischen und sächsischen Irdenwaare sein. Sie gehört dem 17.
und 18. Jahrhundert an. Auch alte Keramiker, zu denen ich mich
zähle, werden aus diesem letzten Abschnitt des Buches ihr Wissen
bereichern.
Auch der auf 60 Seiten ausgedehnte Text ist mustergültig.
Er bringt Neues, weiteres bereits Veröffentlichtes in angenehmer
übersichtlicher Zusammenfassung — ein wichtiges Vademecum für
Musealbeamte, Sammler und Händler.
KLEINE (IALERIE
BERLIN NW 7, NEUE WILHELMSTR. 9-11
O. C. KRIBBBN K. WILTSCHEK
Geniiiltle <Ies XIV. bis XVIII. Jahrliunderts / Antiquitäten
Werke erster moderncr Meister
Moderne
Achenbach,
Baisch,
Bochmann,
Böcklin, Braith
Corinth,
Dahl, Defregger,
Deiker, Diez,
Feuerbach,
Friedrich,
Gebhardt,
Grützner,
Gude, Hodler,
Jsraels, Jutz,
Kauffmann,
Keller, Knaus,
Kokoschka,
Kröner, Leibl,
Leistikow,
Lenbach,
Liebermann,
Lier, Menzel,
Munkascy,
Munthe,
Pettenkofen,
Picasso, Richter,
Schleich,
Schönleber,
Schreyer,
Schuch,
Schwind,
Slevogt, Sperl,
Spitzweg, Stuck,
Thoma, Trübner,
Uhde, Vautier,
Verboeckhoven,
Voltz, Wenglein,
Zügel
kauft
A. Blumeiireicli
Berlin W35
Blumeshof 9
Kurfürst 9438
3g -■..—.gg
Kunstsaien
Hans Frandsen
(Gegriindet 1852)
nörregade2, Kopenliagen
sucht Kupferstiche;
Dänische Porträts
von J. F. Clemens u. a.
Dänische Kgl. Porträts.
Ansichten vonKopenhagen
von Lahde, Schule, S. H.
Petersen, A. Flint u. a.
Brand- und Bombarde-
mentsbilder von 1801
und 1807, Christiansborg,
Schloßbrand, Haelwegh,
Christian IV. u. a. Portr.
Norwegische Landschaften
von Haas, Lorentzen,
Dahl u. a.
Große dekorative Land-
schaften ä la Lorrain,
Woollett und dergl.
Dänische Topographie
und Geschichte, Wat-
son, Caroline Mathilde,
nach Coates (beide
Formate), E. Fischer,
Christian VII., n. Dance.
Englische Schabkunst
in Porträts und Genres.
Offerten ona Ansichtsseniunffen
nach Verabredung erbeten.
§8' 38
Jj>u
V-^7/ /X7/ F-ßF
jp/IETHEr*
ialelDedun ö rr b n-
/V9 POTIDFinEQlTR IZb-IZI-
49