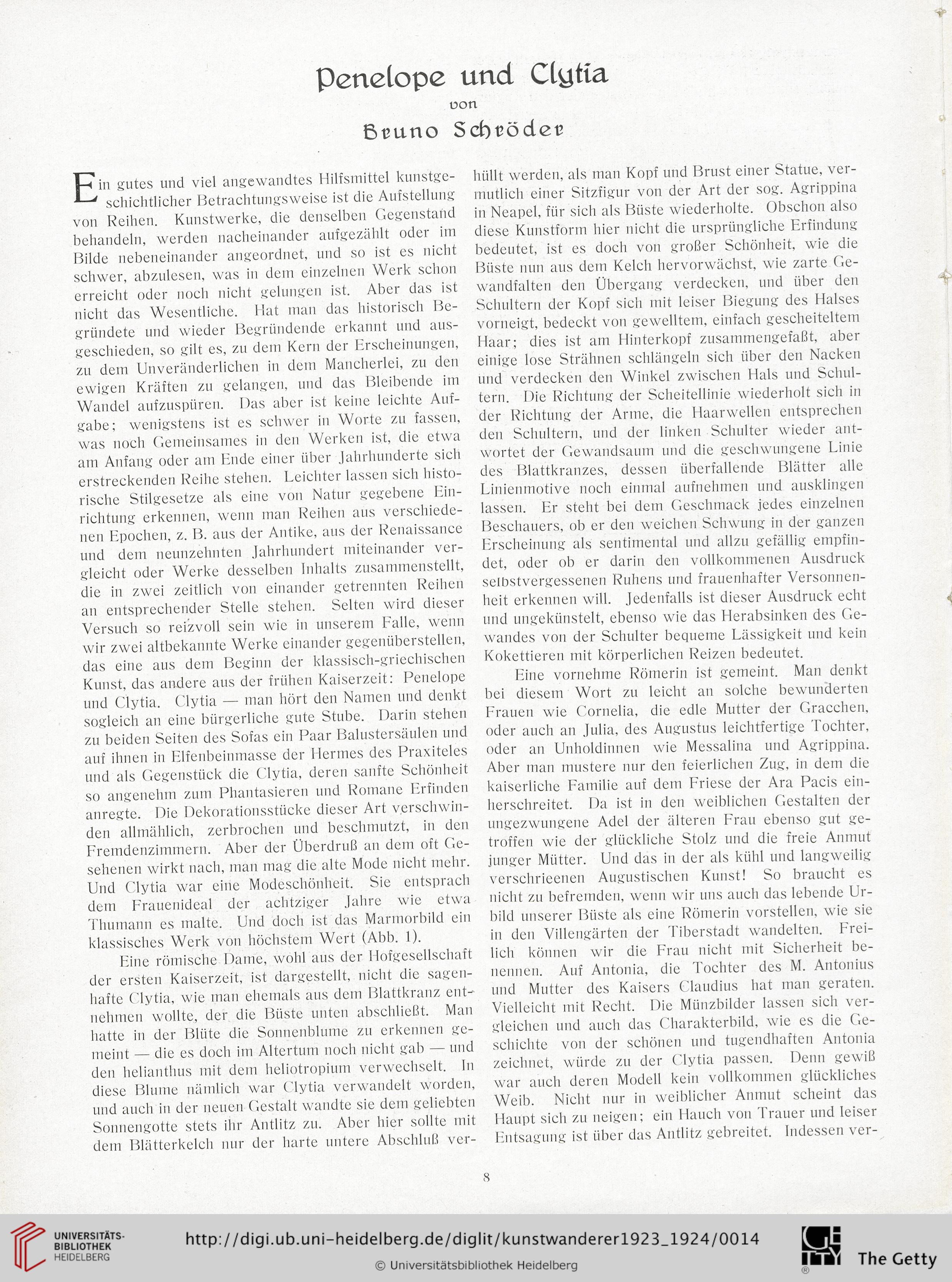Penelope und Ctytia
oon
Bi’ttno ScbtödcE
1-h1 in gutes und viel angewandtes Hilfsniittel kunstge-
■U' schichtlicher Betrachtungsweise ist die Aufstellung
von Reihen. Kunstwerke, die denselben Gegenstand
behandeln, werden naclieinander aufgezählt oder im
Bilde nebeneinander angeordnet, und so ist es nicht
schwer, abzulesen, was in dem einzelnen Werk schon
erreicht oder noch nicht gelungen ist. Aber das ist
nicht das Wesentliche. Hat man das historisch Be-
gründete und wieder Begründende erkannt und aus-
geschieden, so gilt es, zu dem Kern der Erscheinungen,
zu dem Unveränderlichen in dem Mancherlei, zu den
ewigen Kräften zu gelangen, uud das Bleibende im
Wandel aufzuspüren. Das aber ist keine leiclite Auf-
gabe; wenigstens ist es schwer in Worte zu fassen,
was noch Gemeinsames in den Werken ist, die etwa
atn Anfang oder am Ende einer iiber Jahrhunderte siclt
erstreckenden Reihe stehen. Leichter lassen sich histo-
rische Stilgesetze als eine von Natur gegebene Ein-
richtung erkennen, wenn man Reihen aus verschiede-
nen Epochen, z. B. aus der Antike, aus der Renaissance
und dem neunzehnten Jahrhundert miteinander ver-
gleicht oder Werke desselben Inhalts zusammenstellt,
die in zwei zeitlich von einander getrennten Reihen
an entsprechender Stelle stehen. Selten wird dieser
Versuch so reizvoll sein wie in unserem Falle, wenn
wir zwei altbekannte Wcrke einander gegenüberstellen,
das eine aus dem Beginn der klassisch-griechischen
Kunst, das andere aus der frühen Kaiserzeit; Penelope
und Clytia. Clytia — man hört den Namen und denkt
sogleich an eine bürgerliche gute Stube. Darin stehen
zu beiden Seiten des Sofas ein Paar Balustersäulen und
auf ihnen in Elfenbeinmasse der Hermes des Praxiteles
und als Gegenstück die Clytia, deren sanfte Schönheit
so angenehm zum Phantasieren und Romane Erfinden
anregte. Die Dekorationsstücke dieser Art v.erschwin-
den allmälilich, zerbrochen und beschmutzt, in den
Fremdenzimmern. Aber der Überdruß an dem oft Ge-
sehenen wirkt nach, man mag die alte Mode nicht mehr.
Und Clytia war eine Modeschönheit. Sie entsprach
detn Frauenideal der achtziger Jahre wie etwa
Thumann es malte. Und doclt ist das Marmorbild ein
klassisches Werk von höchstem Wert (Abb. 1).
Eine römische Darrie, wohl aus der Hofgesellschaft
der ersten Kaiserzeit, ist dargestellt, nicht die sagen-
hafte Clytia, wie man ehemals aus dcm Blattkranz ent-
nehmen wollte, der die Büste unten abschließt. Man
hatte in der Blüte die Sonnenblume zu erkennen ge-
meint — die es doch im Altertum noch nicht gab — und
den helianthus mit dem heliotropium verwechselt. lu
diese Blume nämlich war Clytia verwandelt worden,
und auch iu der neuen Gestalt wandte sie dem geliebten
Sonnengotte stets ihr Antlitz zu. Aber hier sollte mit
dem Idätterkclch nur der harte untere Abschlnß ver-
hüllt werden, als man Kopf und Brust einer Statue, ver-
mutlich einer Sitzfigur von der Art der sog. Agrippina
in Neapel, für sich als Büste wiederholte. Obschon also
diese Kunstform hier nicht die ursprüngliche Erfindung
bedeutet, ist es doch von großer Schönheit, wie die
Büste nun aus dem Kelch hervorwächst, wie zarte Ge-
wandfalten den Übergang verdecken, und tiber den
Sehultern der Kopf sicli mit leiser Biegung des Halses
vorneigt, bedeckt von gewelltem, einfach gescheiteltem
Haar; dies ist am Hinterkopf zusammengefaßt, aber
einige lose Strähnen schlängeln sich über den Nacken
und verdecken den Winkel zwischen Hals und Schul-
tern. Die Richtung der Scheitellinie wiederholt sich in
der Richtung der Arme, die Haarwellen entsprechen
den Schultern, und der linken Schulter wieder arit-
wortet der Gewandsaum und die geschwungene Linie
des Blattkranzes, dessen überfallende Blätter alle
Linienmotive noch einmal aufnehmen und ausklingen
lassen. Er steht bei dem Geschmack jedes einzelnen
Beschauers, ob er den weichen Schwung in der ganzen
Erscheinung als sentimental und allzu gefällig empfin-
det, oder ob er darin den vollkommenen Ausdruck
selöstvergessenen Ruhens und frauenhafter Versonnen-
hcit erkennen will. Jedenfalls ist dieser Ausdruck echt
und ungekünstelt, ebenso wie das Herabsinken des Ge-
wandes von der Schulter bequeme Lässigkeit und kein
Kokettieren mit körperlichen Reizen bedeutet.
Eine vornehme Römerin ist gemeint. Man denkt
bei diesem Wort zu leicht an solche bewunderten
Frauen wie Gornelia, die edle Mutter der Gracchen,
oder auch an Julia, des Augustus leichtfertige Tochter,
oder an Unholdinnen wie Messalina und Agrippina.
Aber man mustere nur den feierlichen Zug, in dem die
kaiserliche Familie auf dem Friese der Ara Pacis ein-
herschreitet. Da ist in den weiblichen Gestalten der
ungezwungene Adel der älteren Frau ebeuso gut ge-
troffen wie der glückliche Stolz und die freie Anmut
junger Mütter. Und das in der als kühl und langweilig
verschrieenen Augustischen Kunst! So braucht es
nicht zu befremden, wenn wir uns aucli das lebende Ur-
bild unserer Büste als eine Römerin vorstellen, wie sie
in den Villengärten der Tiberstadt wandelten. Frei-
lich können wir die Frau nicht mit Sicherheit be-
nennen. Auf Antonia, die Tochter des M. Antonius
und Mutter des Kaisers Claudius hat man geraten.
Vielleicht mit Recht. Die Münzbilder lassen sich ver-
gleichen und auch das Charakterbild, wie es die Ge-
schichte von der schönen und tugendhaften Antonia
zeichnet, wiirde zu der Clytia passen. Denn gewiß
war auch deren Modell kein vollkommen glückliches
Weib. Nicht nur in weiblicher Anmut scheint das
Haupt sich zu neigen; ein Hauch von Trauer und Ieiser
Entsagung ist über das Antlitz gebreitet. Indessen ver-
8
oon
Bi’ttno ScbtödcE
1-h1 in gutes und viel angewandtes Hilfsniittel kunstge-
■U' schichtlicher Betrachtungsweise ist die Aufstellung
von Reihen. Kunstwerke, die denselben Gegenstand
behandeln, werden naclieinander aufgezählt oder im
Bilde nebeneinander angeordnet, und so ist es nicht
schwer, abzulesen, was in dem einzelnen Werk schon
erreicht oder noch nicht gelungen ist. Aber das ist
nicht das Wesentliche. Hat man das historisch Be-
gründete und wieder Begründende erkannt und aus-
geschieden, so gilt es, zu dem Kern der Erscheinungen,
zu dem Unveränderlichen in dem Mancherlei, zu den
ewigen Kräften zu gelangen, uud das Bleibende im
Wandel aufzuspüren. Das aber ist keine leiclite Auf-
gabe; wenigstens ist es schwer in Worte zu fassen,
was noch Gemeinsames in den Werken ist, die etwa
atn Anfang oder am Ende einer iiber Jahrhunderte siclt
erstreckenden Reihe stehen. Leichter lassen sich histo-
rische Stilgesetze als eine von Natur gegebene Ein-
richtung erkennen, wenn man Reihen aus verschiede-
nen Epochen, z. B. aus der Antike, aus der Renaissance
und dem neunzehnten Jahrhundert miteinander ver-
gleicht oder Werke desselben Inhalts zusammenstellt,
die in zwei zeitlich von einander getrennten Reihen
an entsprechender Stelle stehen. Selten wird dieser
Versuch so reizvoll sein wie in unserem Falle, wenn
wir zwei altbekannte Wcrke einander gegenüberstellen,
das eine aus dem Beginn der klassisch-griechischen
Kunst, das andere aus der frühen Kaiserzeit; Penelope
und Clytia. Clytia — man hört den Namen und denkt
sogleich an eine bürgerliche gute Stube. Darin stehen
zu beiden Seiten des Sofas ein Paar Balustersäulen und
auf ihnen in Elfenbeinmasse der Hermes des Praxiteles
und als Gegenstück die Clytia, deren sanfte Schönheit
so angenehm zum Phantasieren und Romane Erfinden
anregte. Die Dekorationsstücke dieser Art v.erschwin-
den allmälilich, zerbrochen und beschmutzt, in den
Fremdenzimmern. Aber der Überdruß an dem oft Ge-
sehenen wirkt nach, man mag die alte Mode nicht mehr.
Und Clytia war eine Modeschönheit. Sie entsprach
detn Frauenideal der achtziger Jahre wie etwa
Thumann es malte. Und doclt ist das Marmorbild ein
klassisches Werk von höchstem Wert (Abb. 1).
Eine römische Darrie, wohl aus der Hofgesellschaft
der ersten Kaiserzeit, ist dargestellt, nicht die sagen-
hafte Clytia, wie man ehemals aus dcm Blattkranz ent-
nehmen wollte, der die Büste unten abschließt. Man
hatte in der Blüte die Sonnenblume zu erkennen ge-
meint — die es doch im Altertum noch nicht gab — und
den helianthus mit dem heliotropium verwechselt. lu
diese Blume nämlich war Clytia verwandelt worden,
und auch iu der neuen Gestalt wandte sie dem geliebten
Sonnengotte stets ihr Antlitz zu. Aber hier sollte mit
dem Idätterkclch nur der harte untere Abschlnß ver-
hüllt werden, als man Kopf und Brust einer Statue, ver-
mutlich einer Sitzfigur von der Art der sog. Agrippina
in Neapel, für sich als Büste wiederholte. Obschon also
diese Kunstform hier nicht die ursprüngliche Erfindung
bedeutet, ist es doch von großer Schönheit, wie die
Büste nun aus dem Kelch hervorwächst, wie zarte Ge-
wandfalten den Übergang verdecken, und tiber den
Sehultern der Kopf sicli mit leiser Biegung des Halses
vorneigt, bedeckt von gewelltem, einfach gescheiteltem
Haar; dies ist am Hinterkopf zusammengefaßt, aber
einige lose Strähnen schlängeln sich über den Nacken
und verdecken den Winkel zwischen Hals und Schul-
tern. Die Richtung der Scheitellinie wiederholt sich in
der Richtung der Arme, die Haarwellen entsprechen
den Schultern, und der linken Schulter wieder arit-
wortet der Gewandsaum und die geschwungene Linie
des Blattkranzes, dessen überfallende Blätter alle
Linienmotive noch einmal aufnehmen und ausklingen
lassen. Er steht bei dem Geschmack jedes einzelnen
Beschauers, ob er den weichen Schwung in der ganzen
Erscheinung als sentimental und allzu gefällig empfin-
det, oder ob er darin den vollkommenen Ausdruck
selöstvergessenen Ruhens und frauenhafter Versonnen-
hcit erkennen will. Jedenfalls ist dieser Ausdruck echt
und ungekünstelt, ebenso wie das Herabsinken des Ge-
wandes von der Schulter bequeme Lässigkeit und kein
Kokettieren mit körperlichen Reizen bedeutet.
Eine vornehme Römerin ist gemeint. Man denkt
bei diesem Wort zu leicht an solche bewunderten
Frauen wie Gornelia, die edle Mutter der Gracchen,
oder auch an Julia, des Augustus leichtfertige Tochter,
oder an Unholdinnen wie Messalina und Agrippina.
Aber man mustere nur den feierlichen Zug, in dem die
kaiserliche Familie auf dem Friese der Ara Pacis ein-
herschreitet. Da ist in den weiblichen Gestalten der
ungezwungene Adel der älteren Frau ebeuso gut ge-
troffen wie der glückliche Stolz und die freie Anmut
junger Mütter. Und das in der als kühl und langweilig
verschrieenen Augustischen Kunst! So braucht es
nicht zu befremden, wenn wir uns aucli das lebende Ur-
bild unserer Büste als eine Römerin vorstellen, wie sie
in den Villengärten der Tiberstadt wandelten. Frei-
lich können wir die Frau nicht mit Sicherheit be-
nennen. Auf Antonia, die Tochter des M. Antonius
und Mutter des Kaisers Claudius hat man geraten.
Vielleicht mit Recht. Die Münzbilder lassen sich ver-
gleichen und auch das Charakterbild, wie es die Ge-
schichte von der schönen und tugendhaften Antonia
zeichnet, wiirde zu der Clytia passen. Denn gewiß
war auch deren Modell kein vollkommen glückliches
Weib. Nicht nur in weiblicher Anmut scheint das
Haupt sich zu neigen; ein Hauch von Trauer und Ieiser
Entsagung ist über das Antlitz gebreitet. Indessen ver-
8