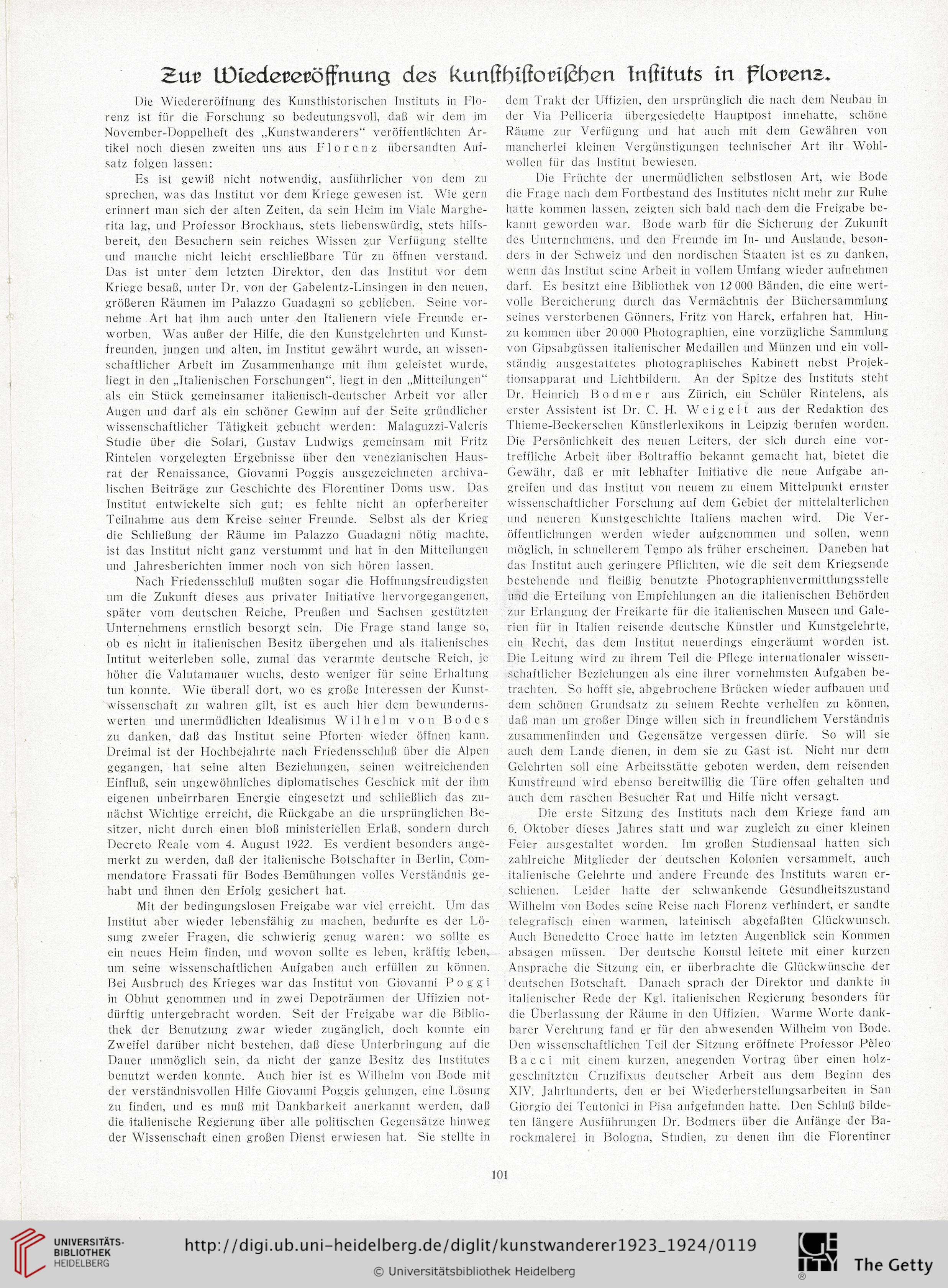But? lÜtedecct’öffnung dcs kunffbtffotn(cben Inffituts in ff(ot?ens.
Die Wiedereröffnung des Kunsthistorischen Instituts in Flo-
renz ist für die Forschung so bedeutungsvoll, daß wir dem im
November-Doppelheft des „Kunstwanderers“ veröffentlichten Ar-
tikel noch diesen zweiten uns aus Florenz übersandten Auf-
satz folgen lassen:
Es ist gewiß nicht notwendig, ausführlicher von dem zu
sprechen, was das Institut vor dem Kriege gewesen ist. Wie gern
erinnert man sich der alten Zeiten, da sein Heim im Viale Marghe-
rita lag, und Professor Brockhaus, stets liebenswürdig, stets hilfs-
bereit, den Besuchern sein reiches Wissen zur Verfügung stellte
und manche nicht leicht erschließbare Tür zu öffnen verstand.
Das ist unter dem letzten Direktor, den das Institut vor dem
Kriege besaß, unter Dr. von der Gabelentz-Linsingen in den neuen,
größeren Räumen im Palazzo Guadagni so geblieben. Seine vor-
nehme Art hat ihm auch unter den Italienern viele Freunde er-
worben. Was außer der Hilfe, die den Kunstgelehrten und Kunst-
freunden, jungen und alten, im Institut gewährt wurde, an wissen-
schaftlicher Arbeit im Zusammenhange mit ihm geleistet wurde,
Iiegt in den „Italienischen Forschungen“, liegt in den „Mitteilungen“
als ein Stück gemeinsamer italienisch-deutscher Arbeit vor aller
Augen und darf als ein schöner Gewinn auf der Seite gründlicher
wissenschaftlicher Tätigkeit gebucht werden: Malaguzzi-Valeris
Studie über die Solari, Gustav Ludwigs gemeinsam mit Fritz
Rintelen vorgelegten Ergebnisse iiber den venezianischen Haus-
rat der Renaissance, Giovanni Poggis ausgezeichneten archiva-
Iischen Beiträge zur Geschichte des Florentiner Doms usw. Das
Institut entwickelte sich gut; es fehlte nicht an opferbereiter
Teilnahme aus dem Kreise seiner Freunde. Selbst als der Krieg
die Schließung der Räume irn Palazzo Guadagni nötig machte,
ist das Institut nicht ganz verstummt und hat in den Mitteilungen
und Jahresberichten immer noch von sich hören lassen.
Nach Friedensschluß mußten sogar die Hoffnungsfreudigsten
um die Zukunft dieses aus privater Initiative hervorgegangenen,
später vom deutschen Reiche, Preußen und Sachsen gestützten
Unternehmens ernstlich besorgt sein. Die Frage stand lange so,
ob es nicht in italienischen Besitz übergehen und als italjenisches
Intitut weiterleben solle, zumal das verarmte deutsche Reich, je
höher die Valutamauer wuchs, desto weniger ftir seine Erhaltung
tun konnte. Wie überall dort, wo es große Interessen der Kunst-
wissenschaft zu wahren gilt, ist es auch hier dem bewunderns-
werten und unermüdlichen Idealismus Wilhelm von Bodes
zu danken, daß das Institut seine Pforten wieder öffnen kann.
Dreimal ist der Hochbejahrte nach Friedensschluß über die Alpen
gegangen, hat seine alten Beziehungen, seinen weitreichenden
Einfluß, sein ungewöhnliches diplomatisches Geschick mit der ihm
eigenen unbeirrbaren Energie eingesetzt und schließlich das zu-
nächst Wichtige erreicht, die Rückgabe an die ursprünglichen Be-
sitzer, nicht durch einen bloß ministeriellen Erlaß, sondern durcli
Decreto Reale vom 4. August 1922. Es verdient besonders ange-
merkt zu werden, daß der italienische Botschafter in Berlin, Com-
mendatore Frassati für Bodes Bemühungen volles Verständnis ge-
habt und ihnen den Erfolg gesichert hat.
Mit der bedingungslosen Freigabe war viel erreicht. Um das
Institut aber wieder lebensfähig zu machen, bedurfte es der Lö-
sung zweier Fragen, die schwierig genug waren: wo sollte es
ein neues Heim finden, und wovon sollte es leben, kräftig leben,
um seine wissenschaftlichen Aufgaben aucli erfüllen zu können.
Bei Ausbruch des Krieges war das Institut von Giovanni P o g g i
in Obhut genommen und in zwei Depoträumen der Uffizien not-
dürftig untergebracht worden. Seit der Freigabe war die Biblio-
thek der Benutzung zwar wieder zugänglich, doch konnte ein
Zweifel darüber nicht bestehen, daß diese Unterbringung auf die
Dauer unmöglich sein, da nicht der ganze Besitz des Institutes
benutzt werden konnte. Auch hier ist es Wilhelm von Bodc mit
der verständnisvollen Hilfe Giovanni Poggis gelungen, eine Lösung
zu finden, und es muß mit Dankbarkeit anerkannt werden, daß
die italienische Regierung über alle politischen Gegensätze hinweg
der Wissenscha-ft einen großen Dienst erwiesen hat. Sie stellte in
dem Trakt der Uffizien, den ursprünglich die nach dem Neubau in
der Via Pelliceria übergesiedelte Hauptpost innehatte, schöne
Räume zur Verfügung und hat auch mit dem Gewähren von
mancherlei kleinen Vergünstigungen technischer Art ihr Wohl-
wollen für das Institut bewiesen.
Die Früchte der unermüdlichen selbstlosen Art,. wie Bode
die Frage nach dem Fortbestand des Institutes nicht mehr zur Ruhe
hatte kommen lassen, zeigten sich bald nach dem die Freigabe be-
kannt geworden war. Bode warb für die Sicherung der Zukunft
des Unternehmens, und den Freunde im In- und Auslande, beson-
ders in der Schweiz und den nordischen Staaten ist es zu danken,
wenn das Institut seine Arbeit in vollem Umfang wieder aufnehmen
darf. Es besitzt eine Bibliothek von 12 000 Bänden, die eine wert-
volle Bereicherung durch das Vermächtnis der Büchersammlung
seines verstcrbenen Gönners, Fritz von Harck, erfahren hat. Hin-
zu kommen über 20 000 Photographien, eine vorzügliche Sammlung
von Gipsabgüssen italienischer Medaillen und Münzen und ein voll-
ständig ausgestattetes photographisches Kabinett nebst Projek-
tionsapparat und Lichtbildern. An der Spitze des Instituts steht
Dr. Heinrich Bodmer aus Zürich, ein Schüler Rintelens, als
erster Assistent ist Dr. C. H. Weigel t aus der Redaktion des
Thieme-Beckerschen Kiinstlerlexikons in Leipzig berufen worden.
Die Persönlichkeit des neuen Leiters, der sich durch eine vor-
treffliche Arbeit iiber Boltraffio bekannt gemacht hat, bietet die
Gewähr, daß er mit lebhafter Initiative die neue Aufgabe an-
greifen und das Institut von neuem zu einem Mittelpunkt ernster
wissenschaftlicher Forschung auf dem Gebiet der mittelalterlichen
und neueren Kunstgeschichte Italiens machen wird. Die Ver-
öffentlichungen werden wieder aufgenommen und sollen, wenn
möglich, in schnellerem Tempo als früher erscheinen. Daneben hat
das Institut auch geringere Pflichten, wie die seit dem Kriegsende
bestehende und fleißig benutzte Photographienvermittlungsstelle
uhd die Erteilung von Empfehlungen an die italienischen Behörden
zur Erlangung der Freikarte für die italienischen Museen und Gale-
rien für in Italien reisende deutsche Künstler und Kunstgelehrte,
ein Recht, das dem Institut neuerdings eingeräumt worden ist.
Die Leitung wird zu ihrem Teil die Pflege internationaler wissen-
schaftlicher Beziehungen als eine ihrer vornehmsten Aufgaben be-
trachten. So hofft sie, abgebrochene Brücken wieder aufbauen und
dem schönen Grundsatz zu seinem Rechte verhelfen zu können,
daß man um großer Dinge willen sich in freundlichem Verständnis
zusammenfinden und Gegensätze vergessen dürfe. So will sie
auch dem Lande dienen, in dem sie zu Gast ist. Nicht nur dem
Gelehrten soll eine Arbeitsstätte geboten werden, dem reisenden
Kunstfreund wird ebenso bereitwillig die Türe offen gehalten und
auch dem raschen Besucher Rat und Hilfe nicht versagt.
Die erste Sitzung des Instituts nach dem Kriege fand am
6. Oktober dieses Jahres statt und war zugleich zu einer kleinen
Feier ausgestaltet worden. Im großen Studiensaal hatten sich
zahlreiche Mitglieder der deutschen Kolonien versammelt, auch
italienische Gelehrte und andere Freunde des Instituts waren er-
schienen. Leider hatte der schwankende Gesundheitszustand
Wilhelm von Bodes seine Reise nach Florenz vefhindert, er sandte
telegrafisch einen warmen, lateinisch abgefaßten Glückwunsch.
Auch Benedetto Croce liatte im letzteri Augenblick sein Kommen
absagen müssen. Der deutsche Konsul leitete mit einer kurzen
Ansprache die Sitzung ein, er überbrachte die Glückwünsche der
deutschen Botschaft. Danach sprach der Direktor und dankte in
italienischer Rede der Kgl. Italienischen Regierung besonders für
die überlassung der Räume in den Uffizien. Warme Worte dank-
barer Verehrung fand er für den abwesenden Wilhelm von Bode.
Den wissenschaftlichen Teil der Sitzung eröffnete Professor Peleo
Bacci mit einem kurzen, anegenden Vortrag über einen holz-
geschnitzten Cruzifixus deutscher Arbeit aus dem Beginn des
XIV. Jahrhunderts, den er bei Wiederherstellungsarbeiten in San
Giorgio dei Teutonici in Pisa aufgefunden hatte. Den Schluß bilde-
ten längere Ausführungen Dr. Bodmers über die Anfänge der Ba-
rockmalerei in Bologna, Studien, zu denen ihn die Florentiner
101
Die Wiedereröffnung des Kunsthistorischen Instituts in Flo-
renz ist für die Forschung so bedeutungsvoll, daß wir dem im
November-Doppelheft des „Kunstwanderers“ veröffentlichten Ar-
tikel noch diesen zweiten uns aus Florenz übersandten Auf-
satz folgen lassen:
Es ist gewiß nicht notwendig, ausführlicher von dem zu
sprechen, was das Institut vor dem Kriege gewesen ist. Wie gern
erinnert man sich der alten Zeiten, da sein Heim im Viale Marghe-
rita lag, und Professor Brockhaus, stets liebenswürdig, stets hilfs-
bereit, den Besuchern sein reiches Wissen zur Verfügung stellte
und manche nicht leicht erschließbare Tür zu öffnen verstand.
Das ist unter dem letzten Direktor, den das Institut vor dem
Kriege besaß, unter Dr. von der Gabelentz-Linsingen in den neuen,
größeren Räumen im Palazzo Guadagni so geblieben. Seine vor-
nehme Art hat ihm auch unter den Italienern viele Freunde er-
worben. Was außer der Hilfe, die den Kunstgelehrten und Kunst-
freunden, jungen und alten, im Institut gewährt wurde, an wissen-
schaftlicher Arbeit im Zusammenhange mit ihm geleistet wurde,
Iiegt in den „Italienischen Forschungen“, liegt in den „Mitteilungen“
als ein Stück gemeinsamer italienisch-deutscher Arbeit vor aller
Augen und darf als ein schöner Gewinn auf der Seite gründlicher
wissenschaftlicher Tätigkeit gebucht werden: Malaguzzi-Valeris
Studie über die Solari, Gustav Ludwigs gemeinsam mit Fritz
Rintelen vorgelegten Ergebnisse iiber den venezianischen Haus-
rat der Renaissance, Giovanni Poggis ausgezeichneten archiva-
Iischen Beiträge zur Geschichte des Florentiner Doms usw. Das
Institut entwickelte sich gut; es fehlte nicht an opferbereiter
Teilnahme aus dem Kreise seiner Freunde. Selbst als der Krieg
die Schließung der Räume irn Palazzo Guadagni nötig machte,
ist das Institut nicht ganz verstummt und hat in den Mitteilungen
und Jahresberichten immer noch von sich hören lassen.
Nach Friedensschluß mußten sogar die Hoffnungsfreudigsten
um die Zukunft dieses aus privater Initiative hervorgegangenen,
später vom deutschen Reiche, Preußen und Sachsen gestützten
Unternehmens ernstlich besorgt sein. Die Frage stand lange so,
ob es nicht in italienischen Besitz übergehen und als italjenisches
Intitut weiterleben solle, zumal das verarmte deutsche Reich, je
höher die Valutamauer wuchs, desto weniger ftir seine Erhaltung
tun konnte. Wie überall dort, wo es große Interessen der Kunst-
wissenschaft zu wahren gilt, ist es auch hier dem bewunderns-
werten und unermüdlichen Idealismus Wilhelm von Bodes
zu danken, daß das Institut seine Pforten wieder öffnen kann.
Dreimal ist der Hochbejahrte nach Friedensschluß über die Alpen
gegangen, hat seine alten Beziehungen, seinen weitreichenden
Einfluß, sein ungewöhnliches diplomatisches Geschick mit der ihm
eigenen unbeirrbaren Energie eingesetzt und schließlich das zu-
nächst Wichtige erreicht, die Rückgabe an die ursprünglichen Be-
sitzer, nicht durch einen bloß ministeriellen Erlaß, sondern durcli
Decreto Reale vom 4. August 1922. Es verdient besonders ange-
merkt zu werden, daß der italienische Botschafter in Berlin, Com-
mendatore Frassati für Bodes Bemühungen volles Verständnis ge-
habt und ihnen den Erfolg gesichert hat.
Mit der bedingungslosen Freigabe war viel erreicht. Um das
Institut aber wieder lebensfähig zu machen, bedurfte es der Lö-
sung zweier Fragen, die schwierig genug waren: wo sollte es
ein neues Heim finden, und wovon sollte es leben, kräftig leben,
um seine wissenschaftlichen Aufgaben aucli erfüllen zu können.
Bei Ausbruch des Krieges war das Institut von Giovanni P o g g i
in Obhut genommen und in zwei Depoträumen der Uffizien not-
dürftig untergebracht worden. Seit der Freigabe war die Biblio-
thek der Benutzung zwar wieder zugänglich, doch konnte ein
Zweifel darüber nicht bestehen, daß diese Unterbringung auf die
Dauer unmöglich sein, da nicht der ganze Besitz des Institutes
benutzt werden konnte. Auch hier ist es Wilhelm von Bodc mit
der verständnisvollen Hilfe Giovanni Poggis gelungen, eine Lösung
zu finden, und es muß mit Dankbarkeit anerkannt werden, daß
die italienische Regierung über alle politischen Gegensätze hinweg
der Wissenscha-ft einen großen Dienst erwiesen hat. Sie stellte in
dem Trakt der Uffizien, den ursprünglich die nach dem Neubau in
der Via Pelliceria übergesiedelte Hauptpost innehatte, schöne
Räume zur Verfügung und hat auch mit dem Gewähren von
mancherlei kleinen Vergünstigungen technischer Art ihr Wohl-
wollen für das Institut bewiesen.
Die Früchte der unermüdlichen selbstlosen Art,. wie Bode
die Frage nach dem Fortbestand des Institutes nicht mehr zur Ruhe
hatte kommen lassen, zeigten sich bald nach dem die Freigabe be-
kannt geworden war. Bode warb für die Sicherung der Zukunft
des Unternehmens, und den Freunde im In- und Auslande, beson-
ders in der Schweiz und den nordischen Staaten ist es zu danken,
wenn das Institut seine Arbeit in vollem Umfang wieder aufnehmen
darf. Es besitzt eine Bibliothek von 12 000 Bänden, die eine wert-
volle Bereicherung durch das Vermächtnis der Büchersammlung
seines verstcrbenen Gönners, Fritz von Harck, erfahren hat. Hin-
zu kommen über 20 000 Photographien, eine vorzügliche Sammlung
von Gipsabgüssen italienischer Medaillen und Münzen und ein voll-
ständig ausgestattetes photographisches Kabinett nebst Projek-
tionsapparat und Lichtbildern. An der Spitze des Instituts steht
Dr. Heinrich Bodmer aus Zürich, ein Schüler Rintelens, als
erster Assistent ist Dr. C. H. Weigel t aus der Redaktion des
Thieme-Beckerschen Kiinstlerlexikons in Leipzig berufen worden.
Die Persönlichkeit des neuen Leiters, der sich durch eine vor-
treffliche Arbeit iiber Boltraffio bekannt gemacht hat, bietet die
Gewähr, daß er mit lebhafter Initiative die neue Aufgabe an-
greifen und das Institut von neuem zu einem Mittelpunkt ernster
wissenschaftlicher Forschung auf dem Gebiet der mittelalterlichen
und neueren Kunstgeschichte Italiens machen wird. Die Ver-
öffentlichungen werden wieder aufgenommen und sollen, wenn
möglich, in schnellerem Tempo als früher erscheinen. Daneben hat
das Institut auch geringere Pflichten, wie die seit dem Kriegsende
bestehende und fleißig benutzte Photographienvermittlungsstelle
uhd die Erteilung von Empfehlungen an die italienischen Behörden
zur Erlangung der Freikarte für die italienischen Museen und Gale-
rien für in Italien reisende deutsche Künstler und Kunstgelehrte,
ein Recht, das dem Institut neuerdings eingeräumt worden ist.
Die Leitung wird zu ihrem Teil die Pflege internationaler wissen-
schaftlicher Beziehungen als eine ihrer vornehmsten Aufgaben be-
trachten. So hofft sie, abgebrochene Brücken wieder aufbauen und
dem schönen Grundsatz zu seinem Rechte verhelfen zu können,
daß man um großer Dinge willen sich in freundlichem Verständnis
zusammenfinden und Gegensätze vergessen dürfe. So will sie
auch dem Lande dienen, in dem sie zu Gast ist. Nicht nur dem
Gelehrten soll eine Arbeitsstätte geboten werden, dem reisenden
Kunstfreund wird ebenso bereitwillig die Türe offen gehalten und
auch dem raschen Besucher Rat und Hilfe nicht versagt.
Die erste Sitzung des Instituts nach dem Kriege fand am
6. Oktober dieses Jahres statt und war zugleich zu einer kleinen
Feier ausgestaltet worden. Im großen Studiensaal hatten sich
zahlreiche Mitglieder der deutschen Kolonien versammelt, auch
italienische Gelehrte und andere Freunde des Instituts waren er-
schienen. Leider hatte der schwankende Gesundheitszustand
Wilhelm von Bodes seine Reise nach Florenz vefhindert, er sandte
telegrafisch einen warmen, lateinisch abgefaßten Glückwunsch.
Auch Benedetto Croce liatte im letzteri Augenblick sein Kommen
absagen müssen. Der deutsche Konsul leitete mit einer kurzen
Ansprache die Sitzung ein, er überbrachte die Glückwünsche der
deutschen Botschaft. Danach sprach der Direktor und dankte in
italienischer Rede der Kgl. Italienischen Regierung besonders für
die überlassung der Räume in den Uffizien. Warme Worte dank-
barer Verehrung fand er für den abwesenden Wilhelm von Bode.
Den wissenschaftlichen Teil der Sitzung eröffnete Professor Peleo
Bacci mit einem kurzen, anegenden Vortrag über einen holz-
geschnitzten Cruzifixus deutscher Arbeit aus dem Beginn des
XIV. Jahrhunderts, den er bei Wiederherstellungsarbeiten in San
Giorgio dei Teutonici in Pisa aufgefunden hatte. Den Schluß bilde-
ten längere Ausführungen Dr. Bodmers über die Anfänge der Ba-
rockmalerei in Bologna, Studien, zu denen ihn die Florentiner
101