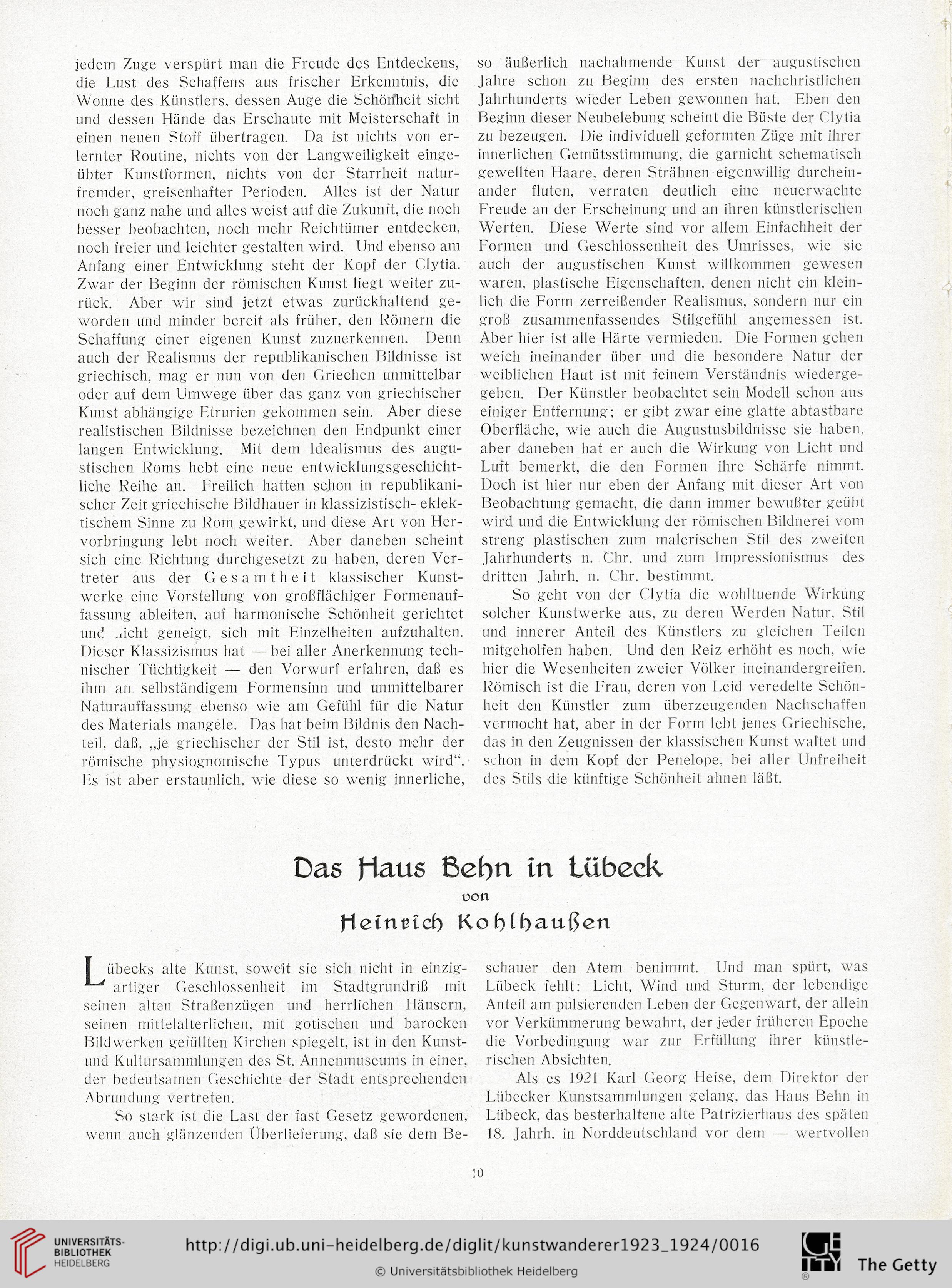jedem Zuge verspürt man die Freude des Entdeckens,
die Lust des Schaffens aus frischer Erkenntnis, die
Wonne des Künstlers, dessen Auge die Schörfheit sieht
und dessen Hände das Erschaute mit Meisterschaft in
einen neuen Stoff übertragen. Da ist nichts von er-
lernter Routine, nichts von der Langweiligkeit einge-
iibter Kunstformen, nichts von der Starrheit natur-
fremder, greisenhafter Perioden. Alles ist der Natur
noch ganz nahe und alles weist auf die Zukunft, die noch
besser beobachten, noch mehr Reichtümer entdecken,
noch t'reier und leichter gestalten wird. Und ebenso am
Anfang einer Entwicklung steht der Kopf der Clytia.
Zwar der Beginn der römischen Kunst liegt weiter zu-
rück. Aber wir sind jetzt etwas zuriickhaltend ge-
worden und minder bereit als früher, den Römern die
Schaffung einer eigenen Kunst zuzuerkennen. Denn
auch der Realismus der republikanischen Bildnisse ist
griecliisch, mag er nun von den Griechen unmittelbar
oder auf dem Umwege iiber das ganz von griechischer
Kunst abhängige Etrurien gekommen sein. Aber diese
realistischen Bildnisse bezeichnen den Endpunkt einer
langen Entwicklung. Mit dem ldealismus des augu-
stischen Roms hebt eine neue entwicklungsgeschicht-
liche Reihe an. Freilich hatten schon in republikani-
scher Zeit griechische Bildhauer in klassizistisch- eklek-
tischem Sinne zu Rom gewirkt, und diese Art von Her-
vorbringung lebt noch weiter. Aber daneben scheint
sich eine Richtung durchgesetzt zu haben, deren Ver-
treter aus der Gesamtheit klassischer Kunst-
werke eine Vorstellung von großflächiger Formenauf-
fassung ableiten, auf harmonische Schönheit gerichtet
und .licht geneigt, sich mit Einzelheiten aufzuhalten.
Dieser Klassizismus hat — bei aller Anerkennung tech-
nischer Tüchtigkeit — den Vorwurf erfahren, daß es
ihm an selbständigem Formensinn und unmittelbarer
Naturauffassung ebenso wie am Gefühl fiir die Natur
des Materials mangele. Das hat beim Bildnis den Nach-
teil, daß, „je griechischer der Stil ist, desto mehr der
römische physiognomische 'J'ypus unterdriickt wird“.
Es ist aber erstaunlich, wie diese so wenig innerliche,
so äußerlich nachahmende Kunst der augustischen
Jahre schon zu Beginn des ersten nachchristlichen
Jahrhunderts wieder Leben gewonnen hat. Eben den
Beginn dieser Neubelebung scheint die Biiste der Clytia
zu bezeugen. Die individuell geformten Ziige mit ihrer
innerlichen Gemiitsstimmung, die garnicht schematisch
gewellten Haare, deren Strähnen eigenwillig durchein-
ander fluten, verraten deutlich eine neuerwachte
Freude an der Erscheinung und an ihren kiinstlerischen
Werten. Diese Werte sind vor allem Einfachheit der
Formen und Geschlossenheit des Umrisses, wie sie
auch der augustischen Kunst willkommen gewesen
waren, plastische Eigenschaften, denen nicht ein klein-
lich die Form zerreißender Realismus, sondern nur ein
groß zusammenfassendes Stilgeftihl angemessen ist.
Aber hier ist alle Härte vermieden. Die Formen gehen
weich ineinander iiber und die besondere Natur der
weiblichen Haut ist mit feinem Verständnis wiederge-
geben. Der Kiinstler beobachtet sein Modell schon aus
einiger Entfernung; er gibt zwar eine glatte abtastbare
überfläche, wie auch die Augustusbildnisse sie haben,
aber daneben hat er auch die Wirkung von Licht und
Luft bemerkt, die den Formen ihre Schärfe nimmt.
Doch ist hier nur eben der Anfang mit dieser Art von
Beobachtung gemacht, die dann immer bewußter geiibt
wird und die Entwicklung der römischen Bildnerei vom
streng plastischen zum malerischen Stil des zweiten
Jahrhunderts n. Chr. und zum Impressionismus des
dritten Jahrh. n. Chr. bestimmt.
So geht von der Clytia die woliltuende Wirkung
solcher Kunstwerke aus, zu deren Werden Natur, Stil
und innerer Anteil des Kiinstlers zu gleichen Teilen
mitgeholfen haben. Und den Reiz erhöht es noch, wie
hier die Wesenheiten zweier Völker ineinandergreifen.
Römisch ist die Frau, deren von Leid veredelte Schön-
heit den Kiinstler zum iiberzeugenden Nachschaffen
vermoclit hat, aber in der Form lebt jenes C.riechische,
das in den Zeugnissen der klassischen Kunst waltet und
schon in dem Kopf der Penelope, bei aller Unfreiheit
des Stils die kiinftige Schöhheit ahnen läßt.
Das Jiaus Bcbn tn tübeck
oon
fieinvidt) Kot)lt)a,u$en
iibecks alte Kunst, sowe'it sie sich nicht in einzig-
^ artiger Geschlossenheit im Stadtgrundriß mit
seinen alten Straßenziigen und herrlichen Häusern,
seinen mittelalterlichen, mit gotischen und barocken
Bildwerken gefiillten Kirchen spiegelt, ist in den Kunst-
und Kultursammlungen des St. Annenmuseums in einer,
der bedeutsamen Geschichte der Stadt entsprechenden
Abrundung vertreten.
So stark ist die Last der fast Gesetz gewordenen,
wenn auch glänzenden Überlieferung, daß sie dem Be-
schauer den Atem benimmt. Und man spiirt, was
Liibeck fehlt: Licht, Wind und Sturm, der lebendige
Anteil am pulsierenden Leben der Gegenwart, der allein
vor Verkümmerung bewahrt, der jeder friiheren Epoche
die Vorbedingung war zur Erfüllung ihrer künstle-
rischen Absichten.
Als es 1921 Karl Georg Heise, dem Direktor der
Liibecker Kunstsammlungen gelang, das Haus Behn in
Liibeck, das besterhaltene alte Patrizierhaus des spiiten
18. Jahrh. in Norddeutschland vor dem — wertvollen
10
die Lust des Schaffens aus frischer Erkenntnis, die
Wonne des Künstlers, dessen Auge die Schörfheit sieht
und dessen Hände das Erschaute mit Meisterschaft in
einen neuen Stoff übertragen. Da ist nichts von er-
lernter Routine, nichts von der Langweiligkeit einge-
iibter Kunstformen, nichts von der Starrheit natur-
fremder, greisenhafter Perioden. Alles ist der Natur
noch ganz nahe und alles weist auf die Zukunft, die noch
besser beobachten, noch mehr Reichtümer entdecken,
noch t'reier und leichter gestalten wird. Und ebenso am
Anfang einer Entwicklung steht der Kopf der Clytia.
Zwar der Beginn der römischen Kunst liegt weiter zu-
rück. Aber wir sind jetzt etwas zuriickhaltend ge-
worden und minder bereit als früher, den Römern die
Schaffung einer eigenen Kunst zuzuerkennen. Denn
auch der Realismus der republikanischen Bildnisse ist
griecliisch, mag er nun von den Griechen unmittelbar
oder auf dem Umwege iiber das ganz von griechischer
Kunst abhängige Etrurien gekommen sein. Aber diese
realistischen Bildnisse bezeichnen den Endpunkt einer
langen Entwicklung. Mit dem ldealismus des augu-
stischen Roms hebt eine neue entwicklungsgeschicht-
liche Reihe an. Freilich hatten schon in republikani-
scher Zeit griechische Bildhauer in klassizistisch- eklek-
tischem Sinne zu Rom gewirkt, und diese Art von Her-
vorbringung lebt noch weiter. Aber daneben scheint
sich eine Richtung durchgesetzt zu haben, deren Ver-
treter aus der Gesamtheit klassischer Kunst-
werke eine Vorstellung von großflächiger Formenauf-
fassung ableiten, auf harmonische Schönheit gerichtet
und .licht geneigt, sich mit Einzelheiten aufzuhalten.
Dieser Klassizismus hat — bei aller Anerkennung tech-
nischer Tüchtigkeit — den Vorwurf erfahren, daß es
ihm an selbständigem Formensinn und unmittelbarer
Naturauffassung ebenso wie am Gefühl fiir die Natur
des Materials mangele. Das hat beim Bildnis den Nach-
teil, daß, „je griechischer der Stil ist, desto mehr der
römische physiognomische 'J'ypus unterdriickt wird“.
Es ist aber erstaunlich, wie diese so wenig innerliche,
so äußerlich nachahmende Kunst der augustischen
Jahre schon zu Beginn des ersten nachchristlichen
Jahrhunderts wieder Leben gewonnen hat. Eben den
Beginn dieser Neubelebung scheint die Biiste der Clytia
zu bezeugen. Die individuell geformten Ziige mit ihrer
innerlichen Gemiitsstimmung, die garnicht schematisch
gewellten Haare, deren Strähnen eigenwillig durchein-
ander fluten, verraten deutlich eine neuerwachte
Freude an der Erscheinung und an ihren kiinstlerischen
Werten. Diese Werte sind vor allem Einfachheit der
Formen und Geschlossenheit des Umrisses, wie sie
auch der augustischen Kunst willkommen gewesen
waren, plastische Eigenschaften, denen nicht ein klein-
lich die Form zerreißender Realismus, sondern nur ein
groß zusammenfassendes Stilgeftihl angemessen ist.
Aber hier ist alle Härte vermieden. Die Formen gehen
weich ineinander iiber und die besondere Natur der
weiblichen Haut ist mit feinem Verständnis wiederge-
geben. Der Kiinstler beobachtet sein Modell schon aus
einiger Entfernung; er gibt zwar eine glatte abtastbare
überfläche, wie auch die Augustusbildnisse sie haben,
aber daneben hat er auch die Wirkung von Licht und
Luft bemerkt, die den Formen ihre Schärfe nimmt.
Doch ist hier nur eben der Anfang mit dieser Art von
Beobachtung gemacht, die dann immer bewußter geiibt
wird und die Entwicklung der römischen Bildnerei vom
streng plastischen zum malerischen Stil des zweiten
Jahrhunderts n. Chr. und zum Impressionismus des
dritten Jahrh. n. Chr. bestimmt.
So geht von der Clytia die woliltuende Wirkung
solcher Kunstwerke aus, zu deren Werden Natur, Stil
und innerer Anteil des Kiinstlers zu gleichen Teilen
mitgeholfen haben. Und den Reiz erhöht es noch, wie
hier die Wesenheiten zweier Völker ineinandergreifen.
Römisch ist die Frau, deren von Leid veredelte Schön-
heit den Kiinstler zum iiberzeugenden Nachschaffen
vermoclit hat, aber in der Form lebt jenes C.riechische,
das in den Zeugnissen der klassischen Kunst waltet und
schon in dem Kopf der Penelope, bei aller Unfreiheit
des Stils die kiinftige Schöhheit ahnen läßt.
Das Jiaus Bcbn tn tübeck
oon
fieinvidt) Kot)lt)a,u$en
iibecks alte Kunst, sowe'it sie sich nicht in einzig-
^ artiger Geschlossenheit im Stadtgrundriß mit
seinen alten Straßenziigen und herrlichen Häusern,
seinen mittelalterlichen, mit gotischen und barocken
Bildwerken gefiillten Kirchen spiegelt, ist in den Kunst-
und Kultursammlungen des St. Annenmuseums in einer,
der bedeutsamen Geschichte der Stadt entsprechenden
Abrundung vertreten.
So stark ist die Last der fast Gesetz gewordenen,
wenn auch glänzenden Überlieferung, daß sie dem Be-
schauer den Atem benimmt. Und man spiirt, was
Liibeck fehlt: Licht, Wind und Sturm, der lebendige
Anteil am pulsierenden Leben der Gegenwart, der allein
vor Verkümmerung bewahrt, der jeder friiheren Epoche
die Vorbedingung war zur Erfüllung ihrer künstle-
rischen Absichten.
Als es 1921 Karl Georg Heise, dem Direktor der
Liibecker Kunstsammlungen gelang, das Haus Behn in
Liibeck, das besterhaltene alte Patrizierhaus des spiiten
18. Jahrh. in Norddeutschland vor dem — wertvollen
10