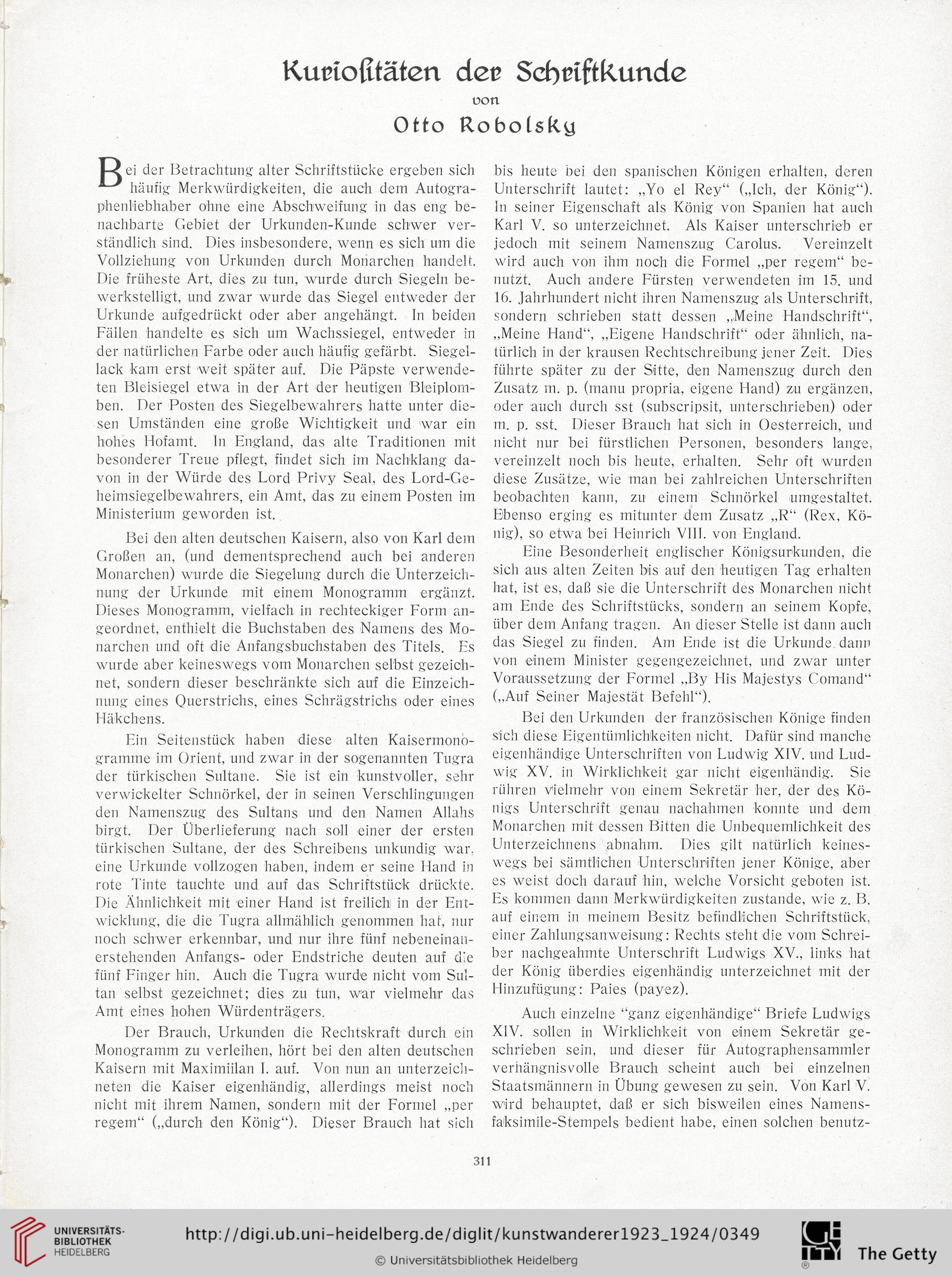Kimoßtäten det? Scbriftfcunde
oon
Otto Robotsky
l-c ei der Betrachtung alter Schriftstücke ergeben sich
häufig Merkwürdigkeiten, die auch dem Autogra-
phenliebhaber ohne eine Abschweifung in das eng be-
nachbarte Gebiet der Urkunden-Kunde schwer ver-
ständlich sind. Dies insbesondere, wenn es sich um die
Vollziehung von Urkunden durch Monarchen handelt.
Die früheste Art, dies zu tun, wurde durch Siegeln be-
werkstelligt, und zwar wurde das Siegel entweder der
Urkunde aufgedrückt oder aber angehängt. In beiden
Fäilen handelte es sich um Wachssiegel, entweder in
der natürlichen Farbe oder auch häufig gefärbt. Siegel-
lack kam erst weit später auf. Die Päpste verwende-
ten Bleisiegel etwa in der Art der heutigen Bleiplom-
ben. Der Posten des Siegelbewahrers hatte unter die-
sen Umständen eine große Wiehtigkeit und war ein
hohes Hofamt. In England, das alte Traditionen mit
besonderer Treue pflegt, findet sich im Nachklang da-
von in der Würde des Lord Privy Seal, des Lord-Ge-
heimsiegelbewahrers, ein Amt, das zu einem Posten im
Ministerium geworden ist.
Bei den alten deutschen Kaisern, also von Karl dem
Großen an, (und dementsprechend auch bei anderen
Monarchen) wurde die Siegelung durch die Unterzeich-
nung der Urkunde mit einem Monogramm ergänzt.
Dieses Monogramm, vielfach in rechteckiger Form an-
geordnet, enthielt die Buchstaben des Namens des Mo-
narchen und oft die Anfangsbuchstaben des Titels. Es
wurde aber keineswegs vom Monarchen selbst gezeich-
net, sondern dieser beschränkte sich auf die Einzeich-
nung eines Querstrichs, eines Schrägstrichs oder eines
Häkchens.
Ein Seitenstück haben diese alten Kaisermono-
gramme im Orient, und zwar in der sogenannten Tugra
der türkischen Sultane. Sie ist ein kunstvoller, sehr
verwickelter Schnörkel, der in seinen Verschlingungen
den Namenszug des Sultans und den Namen Allahs
birgt. Der Überlieferung nach soll einer der ersten
türkischen Sultane, der des Schreibens unkundig war,
eine Urkunde vollzogen haben, indem er seine Hand in
rote Tinte tauchte und auf das Schriftstück drückte.
Die Ähnlichkeit mit einer Hand ist freilichi in der Ent-
wicklung, die die Tugra allmählich genommen hat, nur
noch schwer erkennbar, und nur ihre fünf nebeneinau-
erstehenden Anfangs- oder Endstriche deuten auf die
fünf Finger hin. Auch die Tugra wurde nicht vom Sul-
tan selbst gezeichnet; dies zu tun, war vielmehr das
Amt eines hohen Würdenträgers.
Der Brauch, Urkunden die Rechtskraft durch ein
Monogramm zu verleihen, hört bei den alten deutschen
Kaisern mit Maximiilan I. auf. Von nun an unterzeich-
neten die Kaiser eigenhändig, allerdings meist noch
nicht mit ihrem Namen, sondern mit der Formel „per
regem“ („durch den König“). Dieser Brauch hat sich
bis heute bei den spanischen Königen erhalten, deren
Unterschrift lautet: „Yo el Rey“ („Ich, der König“).
In seiner Eigenschaft als König von Spanien hat auch
Karl V. so unterzeichnet. Als Kaiser unterschrieb er
jedoch mit seinem Namenszug Carolus. Vereinzelt
wird auch von ihm noch die Formel „per regem“ be-
nutzt. Auch andere Fürsten verwendeten im 15. und
16. Jahrhundert nicht ihren Namenszug als Unterschrift,
sondern schrieben statt dessen „Meine Handschrift“,
„Meine Hand“, „Eigene Handschrift“ oder ähnlich, na-
türlich in der krausen Rechtschreibung jener Zeit. Dies
führte später zu der Sitte, den Namenszug durch den
Zusatz m. p. (manu propria, eigene Hand) zu ergänzen,
oder auch durch sst (subscripsit, unterschrieben) oder
m. p. sst. Dieser Brauch hat sich in Oesterreich, und
nicht nur bei fürstlichen Personen, besonders lange,
vereinzelt noch bis heute, erhalten. Sehr oft wurden
diese Zusätze, wie man bei zahlreichen Unterschriften
beobachten kann, zu einem Schnörkel umgestaltet.
Bbenso erging es mitunter dem Zusatz „R“ (Rex, Kö-
nig), so etwa bei Heinrich VIII. von England.
Eine Besonderheit englischer Königsurkunden, die
sich aus alten Zeiten bis auf den heutigen Tag erhalten
hat, ist es, daß sie die Unterschrift des Monarchen nicht
am Ende des Schriftstücks, sondern an seinem Kopfe,
über dem Anfang tragen. An dieser Stelle ist dann auch
das Siegel zu finden. Am Ende ist die Urkunde dann
von einem Minister gegengezeichnet, und zwar unter
Voraussetzung der Formel „By His Majestys Comand“
(„Auf Seiner Majestät Befehl“).
Bei den Urkunden der französischen Könige finden
s'ich diese Eigentümlichkeiten nicht. Dafür sind manche
eigenhändige Unterschriften von Ludwig XIV. und Lud-
wig XV. in Wirklichkeit gar nicht eigenhändig. Sie
rühren vielmehr von einem Sekretär her, der des Kö-
nigs Unterschrift genau nachahmen konnte und dem
Monarchen mit dessen Bitten die Unbequemlichkeit des
Unterzeichnens abnahm. Dies gilt natürlich keines-
wegs bei sämtlichen Unterschriften jener Könige, aber
es weist doch darauf hin, welche Vorsicht geboten ist.
Es kommen dann Merkwürdigkeiten zustande, wie z. B.
auf eir.em in meinem Besitz befindlichen Schriftstück,
einer Zahlungsanweisung: Rechts steht die vom Schrei-
ber nachgeahmte Unterschrift Ludwigs XV., links hat
der König überdies eigenhändig unterzeichnet mit der
Hinzufügung: Paies (payez).
Auch einzelne “ganz eigenhändige“ Briefe Ludwigs
XIV. sollen in Wirklichkeit von einem Sekretär ge-
schrieben sein, und dieser für Autographensammler
verhängnisvolle Brauch scheint auch bei einzelnen
Staatsmännern in Übung gewesen zu sein. Von Karl V.
wird behauptet, daß er sich bisweilen eines Namens-
faksimile-Stempels bedient habe, einen solchen benutz-
311
oon
Otto Robotsky
l-c ei der Betrachtung alter Schriftstücke ergeben sich
häufig Merkwürdigkeiten, die auch dem Autogra-
phenliebhaber ohne eine Abschweifung in das eng be-
nachbarte Gebiet der Urkunden-Kunde schwer ver-
ständlich sind. Dies insbesondere, wenn es sich um die
Vollziehung von Urkunden durch Monarchen handelt.
Die früheste Art, dies zu tun, wurde durch Siegeln be-
werkstelligt, und zwar wurde das Siegel entweder der
Urkunde aufgedrückt oder aber angehängt. In beiden
Fäilen handelte es sich um Wachssiegel, entweder in
der natürlichen Farbe oder auch häufig gefärbt. Siegel-
lack kam erst weit später auf. Die Päpste verwende-
ten Bleisiegel etwa in der Art der heutigen Bleiplom-
ben. Der Posten des Siegelbewahrers hatte unter die-
sen Umständen eine große Wiehtigkeit und war ein
hohes Hofamt. In England, das alte Traditionen mit
besonderer Treue pflegt, findet sich im Nachklang da-
von in der Würde des Lord Privy Seal, des Lord-Ge-
heimsiegelbewahrers, ein Amt, das zu einem Posten im
Ministerium geworden ist.
Bei den alten deutschen Kaisern, also von Karl dem
Großen an, (und dementsprechend auch bei anderen
Monarchen) wurde die Siegelung durch die Unterzeich-
nung der Urkunde mit einem Monogramm ergänzt.
Dieses Monogramm, vielfach in rechteckiger Form an-
geordnet, enthielt die Buchstaben des Namens des Mo-
narchen und oft die Anfangsbuchstaben des Titels. Es
wurde aber keineswegs vom Monarchen selbst gezeich-
net, sondern dieser beschränkte sich auf die Einzeich-
nung eines Querstrichs, eines Schrägstrichs oder eines
Häkchens.
Ein Seitenstück haben diese alten Kaisermono-
gramme im Orient, und zwar in der sogenannten Tugra
der türkischen Sultane. Sie ist ein kunstvoller, sehr
verwickelter Schnörkel, der in seinen Verschlingungen
den Namenszug des Sultans und den Namen Allahs
birgt. Der Überlieferung nach soll einer der ersten
türkischen Sultane, der des Schreibens unkundig war,
eine Urkunde vollzogen haben, indem er seine Hand in
rote Tinte tauchte und auf das Schriftstück drückte.
Die Ähnlichkeit mit einer Hand ist freilichi in der Ent-
wicklung, die die Tugra allmählich genommen hat, nur
noch schwer erkennbar, und nur ihre fünf nebeneinau-
erstehenden Anfangs- oder Endstriche deuten auf die
fünf Finger hin. Auch die Tugra wurde nicht vom Sul-
tan selbst gezeichnet; dies zu tun, war vielmehr das
Amt eines hohen Würdenträgers.
Der Brauch, Urkunden die Rechtskraft durch ein
Monogramm zu verleihen, hört bei den alten deutschen
Kaisern mit Maximiilan I. auf. Von nun an unterzeich-
neten die Kaiser eigenhändig, allerdings meist noch
nicht mit ihrem Namen, sondern mit der Formel „per
regem“ („durch den König“). Dieser Brauch hat sich
bis heute bei den spanischen Königen erhalten, deren
Unterschrift lautet: „Yo el Rey“ („Ich, der König“).
In seiner Eigenschaft als König von Spanien hat auch
Karl V. so unterzeichnet. Als Kaiser unterschrieb er
jedoch mit seinem Namenszug Carolus. Vereinzelt
wird auch von ihm noch die Formel „per regem“ be-
nutzt. Auch andere Fürsten verwendeten im 15. und
16. Jahrhundert nicht ihren Namenszug als Unterschrift,
sondern schrieben statt dessen „Meine Handschrift“,
„Meine Hand“, „Eigene Handschrift“ oder ähnlich, na-
türlich in der krausen Rechtschreibung jener Zeit. Dies
führte später zu der Sitte, den Namenszug durch den
Zusatz m. p. (manu propria, eigene Hand) zu ergänzen,
oder auch durch sst (subscripsit, unterschrieben) oder
m. p. sst. Dieser Brauch hat sich in Oesterreich, und
nicht nur bei fürstlichen Personen, besonders lange,
vereinzelt noch bis heute, erhalten. Sehr oft wurden
diese Zusätze, wie man bei zahlreichen Unterschriften
beobachten kann, zu einem Schnörkel umgestaltet.
Bbenso erging es mitunter dem Zusatz „R“ (Rex, Kö-
nig), so etwa bei Heinrich VIII. von England.
Eine Besonderheit englischer Königsurkunden, die
sich aus alten Zeiten bis auf den heutigen Tag erhalten
hat, ist es, daß sie die Unterschrift des Monarchen nicht
am Ende des Schriftstücks, sondern an seinem Kopfe,
über dem Anfang tragen. An dieser Stelle ist dann auch
das Siegel zu finden. Am Ende ist die Urkunde dann
von einem Minister gegengezeichnet, und zwar unter
Voraussetzung der Formel „By His Majestys Comand“
(„Auf Seiner Majestät Befehl“).
Bei den Urkunden der französischen Könige finden
s'ich diese Eigentümlichkeiten nicht. Dafür sind manche
eigenhändige Unterschriften von Ludwig XIV. und Lud-
wig XV. in Wirklichkeit gar nicht eigenhändig. Sie
rühren vielmehr von einem Sekretär her, der des Kö-
nigs Unterschrift genau nachahmen konnte und dem
Monarchen mit dessen Bitten die Unbequemlichkeit des
Unterzeichnens abnahm. Dies gilt natürlich keines-
wegs bei sämtlichen Unterschriften jener Könige, aber
es weist doch darauf hin, welche Vorsicht geboten ist.
Es kommen dann Merkwürdigkeiten zustande, wie z. B.
auf eir.em in meinem Besitz befindlichen Schriftstück,
einer Zahlungsanweisung: Rechts steht die vom Schrei-
ber nachgeahmte Unterschrift Ludwigs XV., links hat
der König überdies eigenhändig unterzeichnet mit der
Hinzufügung: Paies (payez).
Auch einzelne “ganz eigenhändige“ Briefe Ludwigs
XIV. sollen in Wirklichkeit von einem Sekretär ge-
schrieben sein, und dieser für Autographensammler
verhängnisvolle Brauch scheint auch bei einzelnen
Staatsmännern in Übung gewesen zu sein. Von Karl V.
wird behauptet, daß er sich bisweilen eines Namens-
faksimile-Stempels bedient habe, einen solchen benutz-
311