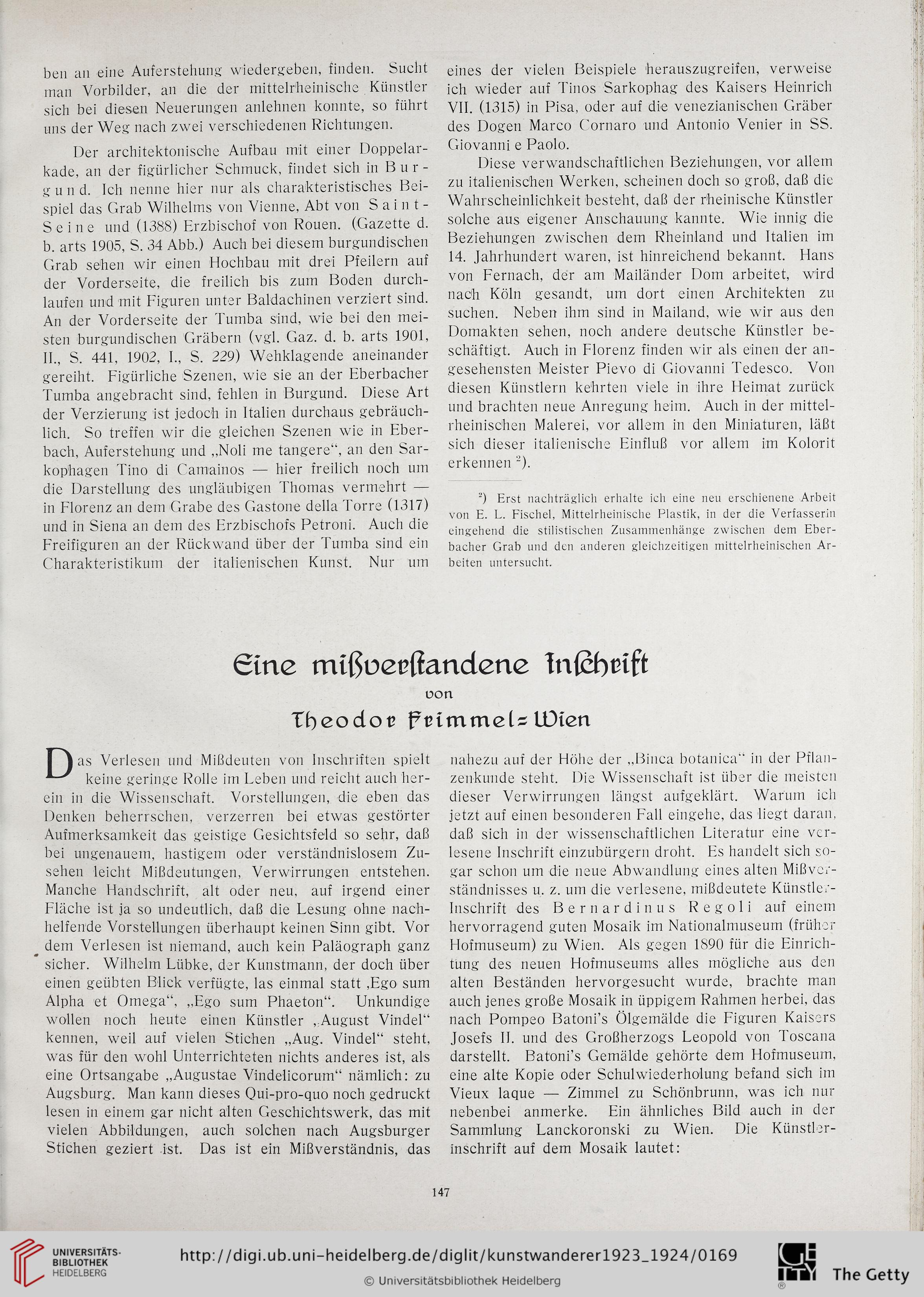ben an eine Auferstehung wiedergeben, finden. Sucht
man Vorbilder, an die der mittelrheinische Künstler
sich bei diesen Neuerungen anlehnen konnte, so führt
uns der Weg nach zwei verschiedenen Richtungen.
Der architektonische Aufbau mit einer Doppelar-
kade, an der figürlicher Schmuck, findet sich in B u r -
g u n d. Ich nenne hier nur als charakteristisches Bei-
spiel das Grab Wilhelms von Vienne, Abt voti S a i n t -
Seine und (1388) Erzbischof von Rouen. (Gazette d.
b. arts 1905, S. 34 Abb.) Auch bei diesem burgundischen
Grab sehen wir einen Hochbau mit drei Pfeilerti auf
der Vorderseite, die freilich bis zum Boden durch-
laufen und mit Figuren unter Baldachinen verziert sind.
An der Vorderseite der Tumba sind, wie bei den mei-
sten burgundischen Gräbern (vgl. Gaz. d. b. arts 1901,
II., S. 441, 1902, 1., S. 229) Wehklagende aneinander
gereiht. Figürliche Szenen, wie sie an der Eberbacher
Tumba angebracht sind, fehlen in Burgund. Diese Art
der Verzierung ist jedoch in Italien durchaus gebräuch-
lich. So treffen wir die gleichen Szenen wie in Eber-
bach, Auferstehung und „Noli me tangere“, an den Sar-
kophagen Tino di Camainos — hier freilich noch um
die Darstellung des ungläubigen Thomas vermehrt —
in Florenz an dem Grabe des Gastone della Torre (1317)
und in Siena an dem des Erzbischofs Petroni. Auch die
Freifiguren an der Rückwand über der Tumba sind ein
Charakteristikum der italienischen Kunst. Nur um
eines der vielen Beispiele herauszugreifen, verweise
ich wieder auf Tinos Sarkophag des Kaisers Heinrich
VII. (1315) in Pisa, oder auf die venezianischen Gräber
des Dogen Marco Cornaro und Antonio Venier in SS.
Giovanni e Paolo.
Diese verwandschaftlichen Beziehungen, vor allem
zu italienischen Werken, scheinen doch so groß, daß die
Wahrscheinlichkeit besteht, daß der r'heinische Künstler
solche aus eigener Anschauung kannte. Wie innig die
Beziehungen zwischen dem Rheinland und Italien im
14. Jahrhundert waren, ist hinreichend bekannt. Hans
von Fernach, der am Mailänder Dom arbeitet, w'ird
nach Köln gesandt, um dort einen Architekten zu
suchen. Neben ihm sind in Mailand, wie wir aus den
Domakten sehen, noch andere deutsche Künstler be-
schäftigt. Auch in Florenz finden wir als einen der an-
gesehensten Meister Pievo di Giovanni Tedesco. Von
diesen Künstlern kehrten viele in ihre Heimat zurück
und brachten neue Anregung heim. Auch in der mittel-
rheinischen Malerei, vor allem in den Miniaturen, läßt
sich dieser italienische Einfluß vor allem im Kolorit
erkennen 2).
2) Erst nachträglich erhalte ich eine neu erschienene Arbeit
von E. L. Fischel, Mittelrheinische Plastik, in der die Verfasserin
eingehend die stilistischen Zusammenhänge zwischen dem Eber-
bacher Grab und den anderen gleichzeitigen mittelrheinischen Ar-
beiten untersucht.
6tne mtßoet?{fanclerie Infcbrtft
üon
Tbcodot? ¥ütmmets LÜicn
| as Verleseu und Mißdeuten von Inschriften spielt
keine geringe Rolle im Leben und reicht auch her-
ein in die Wissenschaft. Vorstellungen, die eben das
Denken beherrschen, verzerren bei etwas gestörter
Aufmerksamkeit das geistige Gesichtsfeld so sehr, daß
bei ungenauem, hastigem oder verständnislosem Zu-
sehen leicht Mißdeutungen, Verwirrungen entstehen.
Manche Handschrift, alt oder neu, auf irgend einer
Fläche ist ja so undeutlich, daß die Lesung ohne nach-
helfende Vorstellungen überhaupt keinen Sinn gibt. Vor
j dem Verlesen ist niemand, auch kein Paläograph ganz
sicher. Wilhelm Lübke, der Kunstmann, der doch über
einen geübten Blick verfügte, las einmal statt ,Ego sum
Alpha et Omega“, „Ego sum Phaeton“. Unkundige
wollen noch heute einen Künstler „August Vindel“
kennen, weil auf vielen Stichen „Aug. Vindel“ steht,
was für den wohl Unterrichteten nichts anderes ist, als
eine Ortsangabe „Augustae Vindelicorum“ nämlich: zu
Augsburg. Man kann dieses Qui-pro-quo noch gedruckt
lesen in einem gar nicht alten Geschichtswerk, das mit
vielen Abbildungen, auch solchen nach Augsburger
Stichen geziert ist. Das ist ein Mißverständnis, das
nahezu auf der Höhe der „Binca botanica“ in der Pflan-
zenkuude steht. Die Wissenschaft ist über die meisten
dieser Verwirrungen längst aufgeklärt. Warutn ich
jetzt auf einen besonderen Fall eingehe, das liegt daran,
daß sich in der wissenschaftlichen Literatur eine ver-
lesene Inschrift einzubürgern droht. Es handelt sich so-
gar schon utn die neue Abwandlung eines alten Mißvcr-
ständnisses u. z. um die verlesene, mißdeutete Künstler-
Insehrift des Bernardinus Regoli auf einem
hervorragend guten Mosaik im Nationalmuseum (frühcr
Hofmuseum) zu Wien. Als gegen 1890 für die Einrich-
tung des neuen Hofmuseums alles mögliche aus den
alten Beständen hervorgesucht wurde, brachte man
auch jenes große Mosaik in üppigem Rahmen herbei, das
nach Pompeo Batoni’s Ölgemälde die Figuren Kaisers
Josefs II. und des Großherzogs Leopold von Toscana
darstellt. Batoni’s Gemälde gehörte dem Hofmuseum,
eine alte Kopie oder Schulwiederholung befand sich im
Vieux laque — Zimmel zu Schönbrunn, was ich nur
nebenbei anmerke. Ein ähnliches Bild auch in der
Sammlung Lanckoronski zu Wien. Die Künstler-
inschrift auf dem Mosaik lautet:
147
man Vorbilder, an die der mittelrheinische Künstler
sich bei diesen Neuerungen anlehnen konnte, so führt
uns der Weg nach zwei verschiedenen Richtungen.
Der architektonische Aufbau mit einer Doppelar-
kade, an der figürlicher Schmuck, findet sich in B u r -
g u n d. Ich nenne hier nur als charakteristisches Bei-
spiel das Grab Wilhelms von Vienne, Abt voti S a i n t -
Seine und (1388) Erzbischof von Rouen. (Gazette d.
b. arts 1905, S. 34 Abb.) Auch bei diesem burgundischen
Grab sehen wir einen Hochbau mit drei Pfeilerti auf
der Vorderseite, die freilich bis zum Boden durch-
laufen und mit Figuren unter Baldachinen verziert sind.
An der Vorderseite der Tumba sind, wie bei den mei-
sten burgundischen Gräbern (vgl. Gaz. d. b. arts 1901,
II., S. 441, 1902, 1., S. 229) Wehklagende aneinander
gereiht. Figürliche Szenen, wie sie an der Eberbacher
Tumba angebracht sind, fehlen in Burgund. Diese Art
der Verzierung ist jedoch in Italien durchaus gebräuch-
lich. So treffen wir die gleichen Szenen wie in Eber-
bach, Auferstehung und „Noli me tangere“, an den Sar-
kophagen Tino di Camainos — hier freilich noch um
die Darstellung des ungläubigen Thomas vermehrt —
in Florenz an dem Grabe des Gastone della Torre (1317)
und in Siena an dem des Erzbischofs Petroni. Auch die
Freifiguren an der Rückwand über der Tumba sind ein
Charakteristikum der italienischen Kunst. Nur um
eines der vielen Beispiele herauszugreifen, verweise
ich wieder auf Tinos Sarkophag des Kaisers Heinrich
VII. (1315) in Pisa, oder auf die venezianischen Gräber
des Dogen Marco Cornaro und Antonio Venier in SS.
Giovanni e Paolo.
Diese verwandschaftlichen Beziehungen, vor allem
zu italienischen Werken, scheinen doch so groß, daß die
Wahrscheinlichkeit besteht, daß der r'heinische Künstler
solche aus eigener Anschauung kannte. Wie innig die
Beziehungen zwischen dem Rheinland und Italien im
14. Jahrhundert waren, ist hinreichend bekannt. Hans
von Fernach, der am Mailänder Dom arbeitet, w'ird
nach Köln gesandt, um dort einen Architekten zu
suchen. Neben ihm sind in Mailand, wie wir aus den
Domakten sehen, noch andere deutsche Künstler be-
schäftigt. Auch in Florenz finden wir als einen der an-
gesehensten Meister Pievo di Giovanni Tedesco. Von
diesen Künstlern kehrten viele in ihre Heimat zurück
und brachten neue Anregung heim. Auch in der mittel-
rheinischen Malerei, vor allem in den Miniaturen, läßt
sich dieser italienische Einfluß vor allem im Kolorit
erkennen 2).
2) Erst nachträglich erhalte ich eine neu erschienene Arbeit
von E. L. Fischel, Mittelrheinische Plastik, in der die Verfasserin
eingehend die stilistischen Zusammenhänge zwischen dem Eber-
bacher Grab und den anderen gleichzeitigen mittelrheinischen Ar-
beiten untersucht.
6tne mtßoet?{fanclerie Infcbrtft
üon
Tbcodot? ¥ütmmets LÜicn
| as Verleseu und Mißdeuten von Inschriften spielt
keine geringe Rolle im Leben und reicht auch her-
ein in die Wissenschaft. Vorstellungen, die eben das
Denken beherrschen, verzerren bei etwas gestörter
Aufmerksamkeit das geistige Gesichtsfeld so sehr, daß
bei ungenauem, hastigem oder verständnislosem Zu-
sehen leicht Mißdeutungen, Verwirrungen entstehen.
Manche Handschrift, alt oder neu, auf irgend einer
Fläche ist ja so undeutlich, daß die Lesung ohne nach-
helfende Vorstellungen überhaupt keinen Sinn gibt. Vor
j dem Verlesen ist niemand, auch kein Paläograph ganz
sicher. Wilhelm Lübke, der Kunstmann, der doch über
einen geübten Blick verfügte, las einmal statt ,Ego sum
Alpha et Omega“, „Ego sum Phaeton“. Unkundige
wollen noch heute einen Künstler „August Vindel“
kennen, weil auf vielen Stichen „Aug. Vindel“ steht,
was für den wohl Unterrichteten nichts anderes ist, als
eine Ortsangabe „Augustae Vindelicorum“ nämlich: zu
Augsburg. Man kann dieses Qui-pro-quo noch gedruckt
lesen in einem gar nicht alten Geschichtswerk, das mit
vielen Abbildungen, auch solchen nach Augsburger
Stichen geziert ist. Das ist ein Mißverständnis, das
nahezu auf der Höhe der „Binca botanica“ in der Pflan-
zenkuude steht. Die Wissenschaft ist über die meisten
dieser Verwirrungen längst aufgeklärt. Warutn ich
jetzt auf einen besonderen Fall eingehe, das liegt daran,
daß sich in der wissenschaftlichen Literatur eine ver-
lesene Inschrift einzubürgern droht. Es handelt sich so-
gar schon utn die neue Abwandlung eines alten Mißvcr-
ständnisses u. z. um die verlesene, mißdeutete Künstler-
Insehrift des Bernardinus Regoli auf einem
hervorragend guten Mosaik im Nationalmuseum (frühcr
Hofmuseum) zu Wien. Als gegen 1890 für die Einrich-
tung des neuen Hofmuseums alles mögliche aus den
alten Beständen hervorgesucht wurde, brachte man
auch jenes große Mosaik in üppigem Rahmen herbei, das
nach Pompeo Batoni’s Ölgemälde die Figuren Kaisers
Josefs II. und des Großherzogs Leopold von Toscana
darstellt. Batoni’s Gemälde gehörte dem Hofmuseum,
eine alte Kopie oder Schulwiederholung befand sich im
Vieux laque — Zimmel zu Schönbrunn, was ich nur
nebenbei anmerke. Ein ähnliches Bild auch in der
Sammlung Lanckoronski zu Wien. Die Künstler-
inschrift auf dem Mosaik lautet:
147