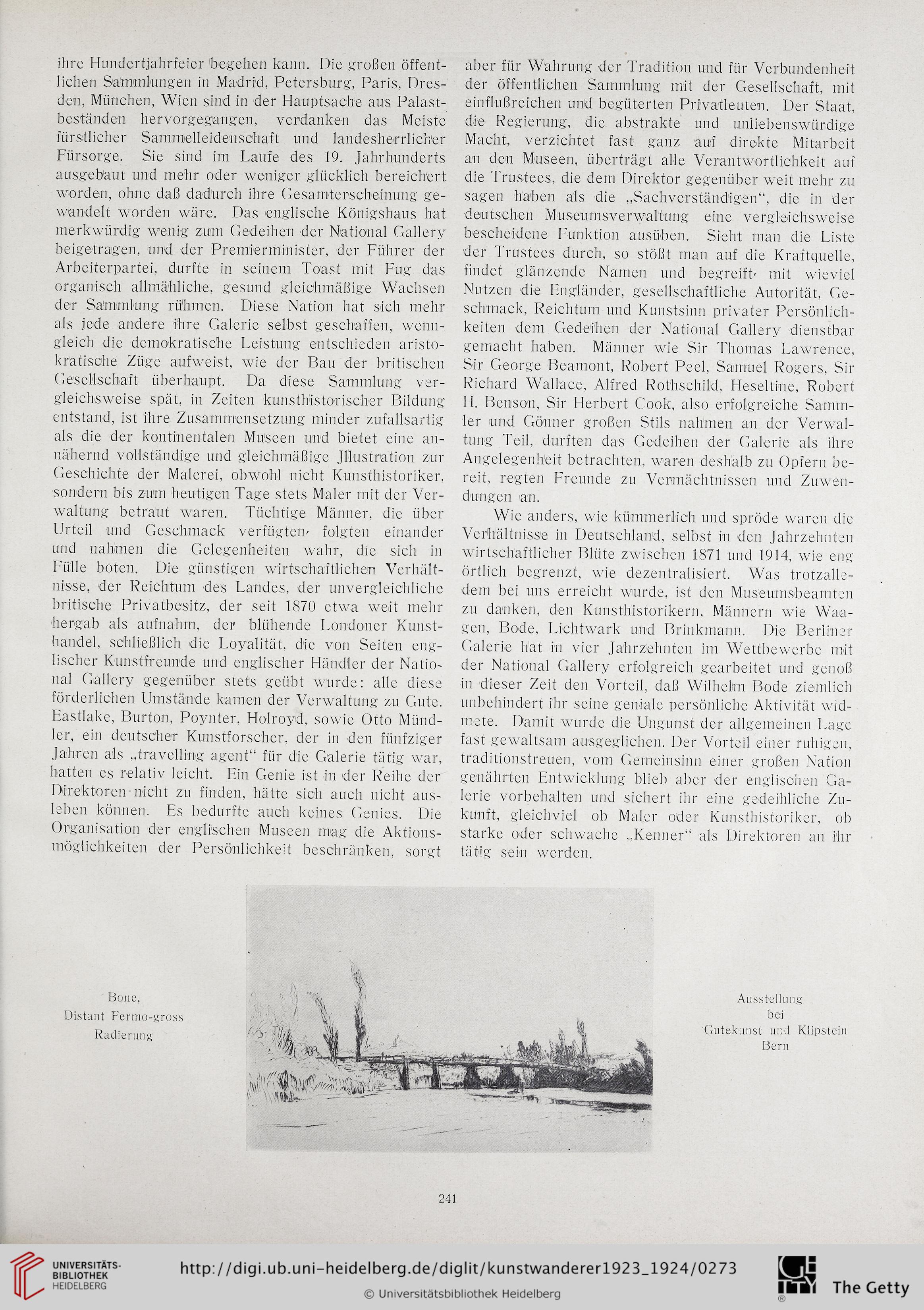ihre Hundertjährfeier begehen kann. Die großen öffent-
iichen Sähimlungen in Madrid, Petersburg, Paris, Dres-
den, München, Wien sind in der Hauptsache aus Palast-
beständen hervorgegangen, verdanken das Meiste
fürstlicher Sammelleidenschaft und landesherrlicher
Fürsorge. Sie sind im Laufe des 19. Jahrhunderts
ausgebäut und mehr oder weniger glücklich bereichert
worden, ohne daß dadurch ihre Gesamterscheinung ge-
wandelt worden wäre. Das englische Königshaus hat
merkwürdig wenig zum Gedeihen der National Gallery
beigetragen, und der Premierminister, der Führer der
Arbeiterpartei, durfte in seinem Toast mit Fug das
organisch allmähliche, gesund gleichmäßige Wachsen
der Sammlung rühmen. Diese Nation hat sich mehr
als jede andere ihre Galerie selbst geschaffen, wenn-
gle'ich die demokratische Leistung entschieden aristo-
kratische Züge aufweist, wie der Bäu der britischen
Gesellschaft überhaupt. Da diese Sammlung ver-
gleichsweise spät, in Zeiten kunsthistorischer Bildung
entstand, ist ihre Zusammensetzung minder zufallsartäg
als die der kontinentalen Museen und bietet eine an-
nähernd vollständige und gleichmäßige Jllustration zur
Geschichte der Malerei, obwohl nicht Kunsthistoriker,
sondern bis zum heutigen Tage stets Maler mit der Ver-
waltung betraut waren. Tüchtige Männer, die über
Urteil und Geschmack verfügtem folgten einander
und nahmen die Gelegenheiten wahr, die sich in
Fülle boten. Die günstigen wirtschaftlichen Verhält-
nisse, der Reichtum des Landes, der unvergleichliche
britische Privatbesitz, der seit 1870 etwa weit mehr
'hergäb als aufnahm, der blühende Londoner Kunst-
handel, schließlich d'ie Loyalität, die von Seiten eng-
lischer Kunstfreunde und englischer Händler der Natio-
nal Gallery gegenüber stets geübt wurde: alle diese
förderlichen Umstände kamen der Verwaltung zu Cmte.
Eastlake, Burton, Poynter, Holroyd, sowie Otto Münd-
ler, ein deutscher Kunstforscher, der in den fünfziger
Jahren als „travelling agent“ für die Galerie tätig war,
hatten es relativ leicht. Ein Genie ist in der Reihe der
Direktoren nicht zu finden, hätte sich auch nicht aus-
leben können. Es bedurfte auch keines Genies. Die
Organisation der englischen Museen mag die Aktions-
möglichkeiten der Persönlichkeit beschränken, sorgt
aber für Wahrung der Tradition und für Verbundenheit
der öffentlichen Sammlung mit der Gesellschaft, mit
einflußreichen und begüterten Privatleuten. Der Staat,
die Regierung, die abstrakte und unliebenswürdige
Macht, verzichtet fast ganz auf direkte Mitarbeit
an den Museen, überträgt alle Verantwortlichkeit auf
die Trustees, die dem Direktor gegenüber weit mehr zu
sagen haben als die „Sachverständigen“, die in der
deutschen Museumsverwaltung eine vergteichsweise
bescheidene Funktion ausüben. Sieht man die Liste
der Trustees durch, so stößt man auf die Kraftquelle,
findet glänzende Namen und begreifb mit wieviel
Nutzen die Engländer, gesellschaftliche Autorität, Ge-
schmack, Reichtum und Kunstsinn privater Persönlich-
keiten dem Gedeihen der National Gallery dienstbar
gemacht haben. Männer wie Sir Thomas Lawrence,
Sir George Beamont, Robert Peel, Samuel Rogers, Sir
Richard Wallace, Alfred Rothschild, Heseltine, Robert
H. Benson, Sir Herbert Cook, also erfolgreiche Samm-
ler und Gönner großen Stils nahmen an der Verwal-
tung Teil, durften das Gedeihen der Galerie als ihre
Angelegenheit betrachten, waren deshalb zu Opfern be-
reit, regten Freunde zu Vermächtnissen und Zuwen-
dungen an.
Wie anders, wie kümmerlich und spröde waren die
Verhältnisse in Deutschland, selbst in den Jahrzehnten
wirtschaftlicher Blüte zwischen 1871 und 1914, wie eng
örtlich begrenzt, wie dezentralisiert. Was trotzalle-
dem bei uns erreicht wurde, ist den Museumsbeamten
zu danken, den Kunsthistorikern, Männern wie Waa-
gen, Bode, Lichtwark und Brinkmann. Die Berliner
Galerie h'at in vier Jahrzehnten im Wettbewerbe mit
der National Gallery erfolgreich gearbeitet und genoß
in ’dieser Zeit den Vorteil, daß Wilhelm Bode ziemlich
unbehindert ihr seine geniale persönliche Aktivität wid-
mete. Dainit wurde die Ungunst der allgemeinen Lagc
fast gewaltsam ausgeglichen. Der Vorteil einer ruhigen,
traditionstreuen, vom Gemeinsinn einer großen Nation
genährten Entwicklung blieb aber der englischen Ga-
lerie vorbehalten und sichert ihr eine gedeihliche Zu-
kunft, gleichviel ob Maler oder Kunsthistoriker, ob
starke oder schwache „Kenner“ als Direktoren an ihr
tätig sein werden.
Bone,
Distant Fermo-gross
Kadierung
Ausstellung
bei
Gutekunst uni Klipstein
Bern
241
iichen Sähimlungen in Madrid, Petersburg, Paris, Dres-
den, München, Wien sind in der Hauptsache aus Palast-
beständen hervorgegangen, verdanken das Meiste
fürstlicher Sammelleidenschaft und landesherrlicher
Fürsorge. Sie sind im Laufe des 19. Jahrhunderts
ausgebäut und mehr oder weniger glücklich bereichert
worden, ohne daß dadurch ihre Gesamterscheinung ge-
wandelt worden wäre. Das englische Königshaus hat
merkwürdig wenig zum Gedeihen der National Gallery
beigetragen, und der Premierminister, der Führer der
Arbeiterpartei, durfte in seinem Toast mit Fug das
organisch allmähliche, gesund gleichmäßige Wachsen
der Sammlung rühmen. Diese Nation hat sich mehr
als jede andere ihre Galerie selbst geschaffen, wenn-
gle'ich die demokratische Leistung entschieden aristo-
kratische Züge aufweist, wie der Bäu der britischen
Gesellschaft überhaupt. Da diese Sammlung ver-
gleichsweise spät, in Zeiten kunsthistorischer Bildung
entstand, ist ihre Zusammensetzung minder zufallsartäg
als die der kontinentalen Museen und bietet eine an-
nähernd vollständige und gleichmäßige Jllustration zur
Geschichte der Malerei, obwohl nicht Kunsthistoriker,
sondern bis zum heutigen Tage stets Maler mit der Ver-
waltung betraut waren. Tüchtige Männer, die über
Urteil und Geschmack verfügtem folgten einander
und nahmen die Gelegenheiten wahr, die sich in
Fülle boten. Die günstigen wirtschaftlichen Verhält-
nisse, der Reichtum des Landes, der unvergleichliche
britische Privatbesitz, der seit 1870 etwa weit mehr
'hergäb als aufnahm, der blühende Londoner Kunst-
handel, schließlich d'ie Loyalität, die von Seiten eng-
lischer Kunstfreunde und englischer Händler der Natio-
nal Gallery gegenüber stets geübt wurde: alle diese
förderlichen Umstände kamen der Verwaltung zu Cmte.
Eastlake, Burton, Poynter, Holroyd, sowie Otto Münd-
ler, ein deutscher Kunstforscher, der in den fünfziger
Jahren als „travelling agent“ für die Galerie tätig war,
hatten es relativ leicht. Ein Genie ist in der Reihe der
Direktoren nicht zu finden, hätte sich auch nicht aus-
leben können. Es bedurfte auch keines Genies. Die
Organisation der englischen Museen mag die Aktions-
möglichkeiten der Persönlichkeit beschränken, sorgt
aber für Wahrung der Tradition und für Verbundenheit
der öffentlichen Sammlung mit der Gesellschaft, mit
einflußreichen und begüterten Privatleuten. Der Staat,
die Regierung, die abstrakte und unliebenswürdige
Macht, verzichtet fast ganz auf direkte Mitarbeit
an den Museen, überträgt alle Verantwortlichkeit auf
die Trustees, die dem Direktor gegenüber weit mehr zu
sagen haben als die „Sachverständigen“, die in der
deutschen Museumsverwaltung eine vergteichsweise
bescheidene Funktion ausüben. Sieht man die Liste
der Trustees durch, so stößt man auf die Kraftquelle,
findet glänzende Namen und begreifb mit wieviel
Nutzen die Engländer, gesellschaftliche Autorität, Ge-
schmack, Reichtum und Kunstsinn privater Persönlich-
keiten dem Gedeihen der National Gallery dienstbar
gemacht haben. Männer wie Sir Thomas Lawrence,
Sir George Beamont, Robert Peel, Samuel Rogers, Sir
Richard Wallace, Alfred Rothschild, Heseltine, Robert
H. Benson, Sir Herbert Cook, also erfolgreiche Samm-
ler und Gönner großen Stils nahmen an der Verwal-
tung Teil, durften das Gedeihen der Galerie als ihre
Angelegenheit betrachten, waren deshalb zu Opfern be-
reit, regten Freunde zu Vermächtnissen und Zuwen-
dungen an.
Wie anders, wie kümmerlich und spröde waren die
Verhältnisse in Deutschland, selbst in den Jahrzehnten
wirtschaftlicher Blüte zwischen 1871 und 1914, wie eng
örtlich begrenzt, wie dezentralisiert. Was trotzalle-
dem bei uns erreicht wurde, ist den Museumsbeamten
zu danken, den Kunsthistorikern, Männern wie Waa-
gen, Bode, Lichtwark und Brinkmann. Die Berliner
Galerie h'at in vier Jahrzehnten im Wettbewerbe mit
der National Gallery erfolgreich gearbeitet und genoß
in ’dieser Zeit den Vorteil, daß Wilhelm Bode ziemlich
unbehindert ihr seine geniale persönliche Aktivität wid-
mete. Dainit wurde die Ungunst der allgemeinen Lagc
fast gewaltsam ausgeglichen. Der Vorteil einer ruhigen,
traditionstreuen, vom Gemeinsinn einer großen Nation
genährten Entwicklung blieb aber der englischen Ga-
lerie vorbehalten und sichert ihr eine gedeihliche Zu-
kunft, gleichviel ob Maler oder Kunsthistoriker, ob
starke oder schwache „Kenner“ als Direktoren an ihr
tätig sein werden.
Bone,
Distant Fermo-gross
Kadierung
Ausstellung
bei
Gutekunst uni Klipstein
Bern
241