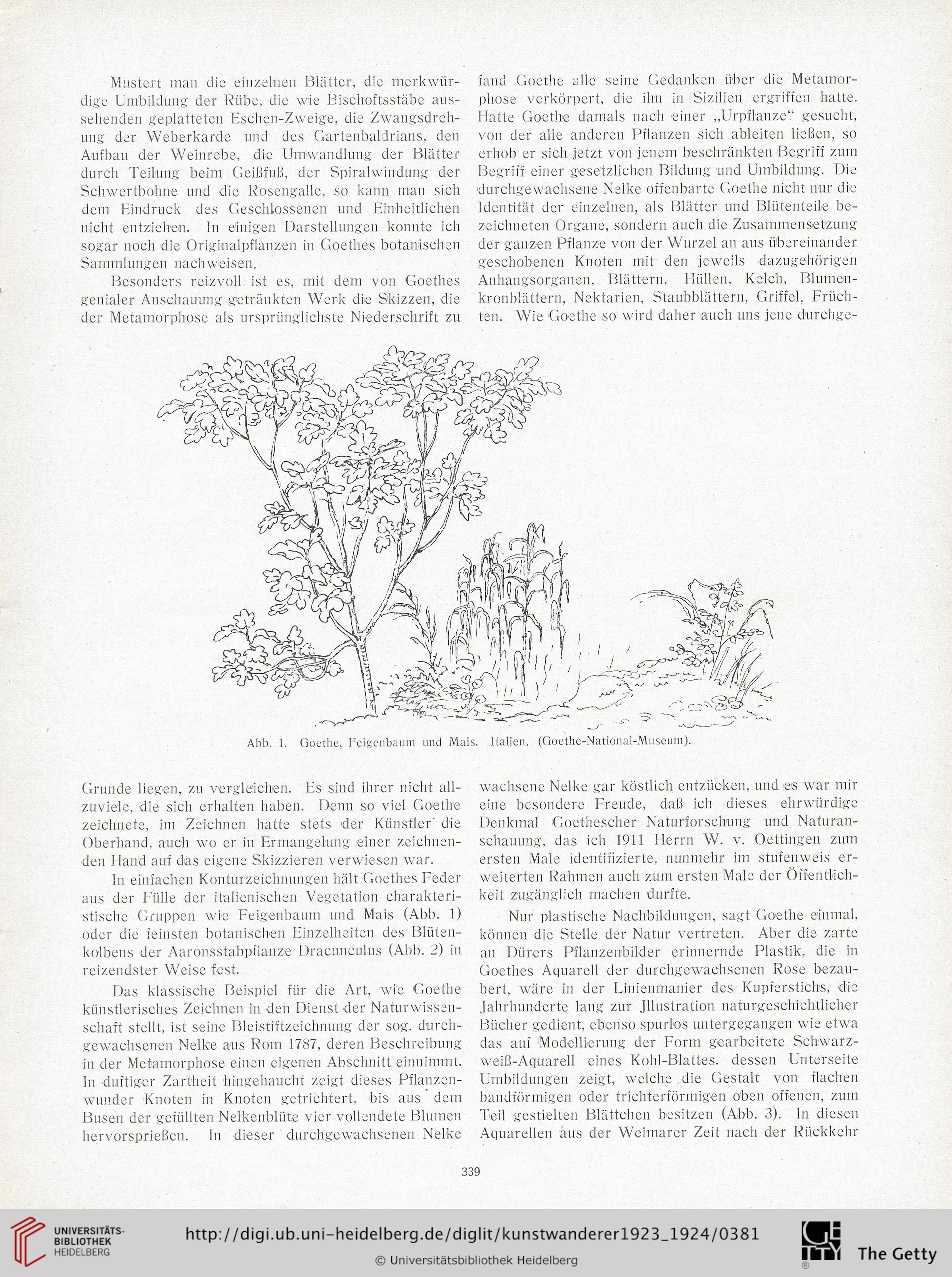Mustert man die einzelnen Blätter, die merkwür-
dige Umbildung der Rübe, die wie Bischoftsstäbe aus-
sehenden geplatteten Eschen-Zweige, die Zwangsdreh-
ung der Weberkarde und des Gartenbaldrians, den
Aufbau der Weinrebe, die Umwandlung der Blätter
durch Teilung beim Geißfuß, der Spiralwindung der
Schwertbo'hne und die Rosengalle, so kann man sich
dem Eindruck des Geschlossenen und Einheitlichen
nicht entzäehen. In einigen Darstellungen konnte ich
sogar noch die Originalpflanzen in Goethes botanischen
Sammlungen nachweisen.
Besonders reizvoll ist es, mit dem von Goethes
genialer Anschauung getränkten Werk die Skizzen, die
der Metamorphose als ürsprünglichste Niederschrift zu
fand Goethe alle seine Gedanken über die Metamor-
phose verkörpert, die ihn in Sizilien ergriffen hatte.
Hatte Goethe damals nach einer „Urpflanze“ gesucht,
von der alle anderen Pflanzen sich ableiten ließen, so
erhob er sich jetzt von jenem beschränkten Begriff zuin
Begriff einer gesetzlichen Bildung und Umbildung. Die
durchgewachsene Nelke offenbarte Goethe nicht nur die
Identität der einzelnen, als Blätter und Blütenteile be-
zeicluieten Organe, sondern auch die Zusammensetzung
der ganzen Pflanze von der Wurzel an aus übereinander
geschobenen Knoten mit den jeweils dazugehörigen
Anhangsorganen, Blättern, Hülleh, Kelch, Blumen-
kronblättern, Nektarien, Staubblättern, Griffel, Früch-
ten. Wie Goethe so wird daher auch uns jene durchge-
Grunde liegen, zu vergleichen. Es sind ihrer nicht all-
zuviele, die sich erhalten haben. Denn so viel Goethe
zeichnete, im Zeichnen hatte stets der Künstler' die
Oberhand, auch wo er in Ermangelung einer zeichnen-
den Hand auf das eigene Skizzieren verwiesen war.
In einfachen Konturzeichnungen hält Goethes Feder
aus der Fülle der italienischen Vegetation charakteri-
stische Gruppen wie Feigenbaum und Mais (Abb. 1)
oder die feinsten botanischen Einzelheiten des Blüten-
kolbens der Aaronsstabpflanze Dracunculus (Abb. 2) in
reizendster Weise fest.
Das klassische Beispiel für die Art, wie Goethe
künstlerisches Zeichnen in 'den Dienst der Naturwissen-
schaft stellt, ist seine Bleistiftzeichnung der sog. durch-
gewachsenen Nelke aus Rom 1787, deren Beschreibung
in der Metamorphose einen eigenen Abschnitt einnrmmt.
In duftiger Zartheit bingehaucht zeigt dieses Pflanzen-
wunder Knoten in Knoten getriclitert, bis aus dem
Busen der ’gefüllten Nelkenblüte vier vollendete Blumen
hervorsprießen. ln dieser durchgewachsenen Nelke
wachsene Nelke gar köstlich entzücken, und e:s war mir
eine besondere Freude, daß ich dieses ehrwürdige
Denkmal Goethescher Naturforschung und Naturan-
schauung, das ich 1911 Herrn W. v. Oettingen zum
ersten Male identifizierte, nunmehr im stufenweis er-
weiterten Rahmen auch zum ersten Male der Öffentlich-
keit zugänglich machen durfte.
Nur plastische Nachbildungen, sagt Goethe einmal,
können die Stelle der Natur vertreten. Aber die zarte
an Dürers Pflanzenbilder erinnernde Plastik, die in
Goethes Aquarell der durchgewachsenen Rose bezau-
bert, wäre in der Linienmanier des Kupferstichs, die
Jahrhunderte lang zur Jllustration naturgeschichtlicher
Bücher gedient, ebenso spurlos untergegangen wie etwa
das auf Modellierung der Form gearbeitete Schwarz-
weiß-Aquarell eines Kohl-Blattes. dessen Unterseite
Umbildungen zeigt, welche .die Gestalt von flachen
bandförmigen oder trichterförmigen oben offenen, zum
Teil gestielten Blättchen besitzen (Abb. 3). In diesen
Aquarellen aus der Weimarer Zeit nach der Rückkehr
339
dige Umbildung der Rübe, die wie Bischoftsstäbe aus-
sehenden geplatteten Eschen-Zweige, die Zwangsdreh-
ung der Weberkarde und des Gartenbaldrians, den
Aufbau der Weinrebe, die Umwandlung der Blätter
durch Teilung beim Geißfuß, der Spiralwindung der
Schwertbo'hne und die Rosengalle, so kann man sich
dem Eindruck des Geschlossenen und Einheitlichen
nicht entzäehen. In einigen Darstellungen konnte ich
sogar noch die Originalpflanzen in Goethes botanischen
Sammlungen nachweisen.
Besonders reizvoll ist es, mit dem von Goethes
genialer Anschauung getränkten Werk die Skizzen, die
der Metamorphose als ürsprünglichste Niederschrift zu
fand Goethe alle seine Gedanken über die Metamor-
phose verkörpert, die ihn in Sizilien ergriffen hatte.
Hatte Goethe damals nach einer „Urpflanze“ gesucht,
von der alle anderen Pflanzen sich ableiten ließen, so
erhob er sich jetzt von jenem beschränkten Begriff zuin
Begriff einer gesetzlichen Bildung und Umbildung. Die
durchgewachsene Nelke offenbarte Goethe nicht nur die
Identität der einzelnen, als Blätter und Blütenteile be-
zeicluieten Organe, sondern auch die Zusammensetzung
der ganzen Pflanze von der Wurzel an aus übereinander
geschobenen Knoten mit den jeweils dazugehörigen
Anhangsorganen, Blättern, Hülleh, Kelch, Blumen-
kronblättern, Nektarien, Staubblättern, Griffel, Früch-
ten. Wie Goethe so wird daher auch uns jene durchge-
Grunde liegen, zu vergleichen. Es sind ihrer nicht all-
zuviele, die sich erhalten haben. Denn so viel Goethe
zeichnete, im Zeichnen hatte stets der Künstler' die
Oberhand, auch wo er in Ermangelung einer zeichnen-
den Hand auf das eigene Skizzieren verwiesen war.
In einfachen Konturzeichnungen hält Goethes Feder
aus der Fülle der italienischen Vegetation charakteri-
stische Gruppen wie Feigenbaum und Mais (Abb. 1)
oder die feinsten botanischen Einzelheiten des Blüten-
kolbens der Aaronsstabpflanze Dracunculus (Abb. 2) in
reizendster Weise fest.
Das klassische Beispiel für die Art, wie Goethe
künstlerisches Zeichnen in 'den Dienst der Naturwissen-
schaft stellt, ist seine Bleistiftzeichnung der sog. durch-
gewachsenen Nelke aus Rom 1787, deren Beschreibung
in der Metamorphose einen eigenen Abschnitt einnrmmt.
In duftiger Zartheit bingehaucht zeigt dieses Pflanzen-
wunder Knoten in Knoten getriclitert, bis aus dem
Busen der ’gefüllten Nelkenblüte vier vollendete Blumen
hervorsprießen. ln dieser durchgewachsenen Nelke
wachsene Nelke gar köstlich entzücken, und e:s war mir
eine besondere Freude, daß ich dieses ehrwürdige
Denkmal Goethescher Naturforschung und Naturan-
schauung, das ich 1911 Herrn W. v. Oettingen zum
ersten Male identifizierte, nunmehr im stufenweis er-
weiterten Rahmen auch zum ersten Male der Öffentlich-
keit zugänglich machen durfte.
Nur plastische Nachbildungen, sagt Goethe einmal,
können die Stelle der Natur vertreten. Aber die zarte
an Dürers Pflanzenbilder erinnernde Plastik, die in
Goethes Aquarell der durchgewachsenen Rose bezau-
bert, wäre in der Linienmanier des Kupferstichs, die
Jahrhunderte lang zur Jllustration naturgeschichtlicher
Bücher gedient, ebenso spurlos untergegangen wie etwa
das auf Modellierung der Form gearbeitete Schwarz-
weiß-Aquarell eines Kohl-Blattes. dessen Unterseite
Umbildungen zeigt, welche .die Gestalt von flachen
bandförmigen oder trichterförmigen oben offenen, zum
Teil gestielten Blättchen besitzen (Abb. 3). In diesen
Aquarellen aus der Weimarer Zeit nach der Rückkehr
339