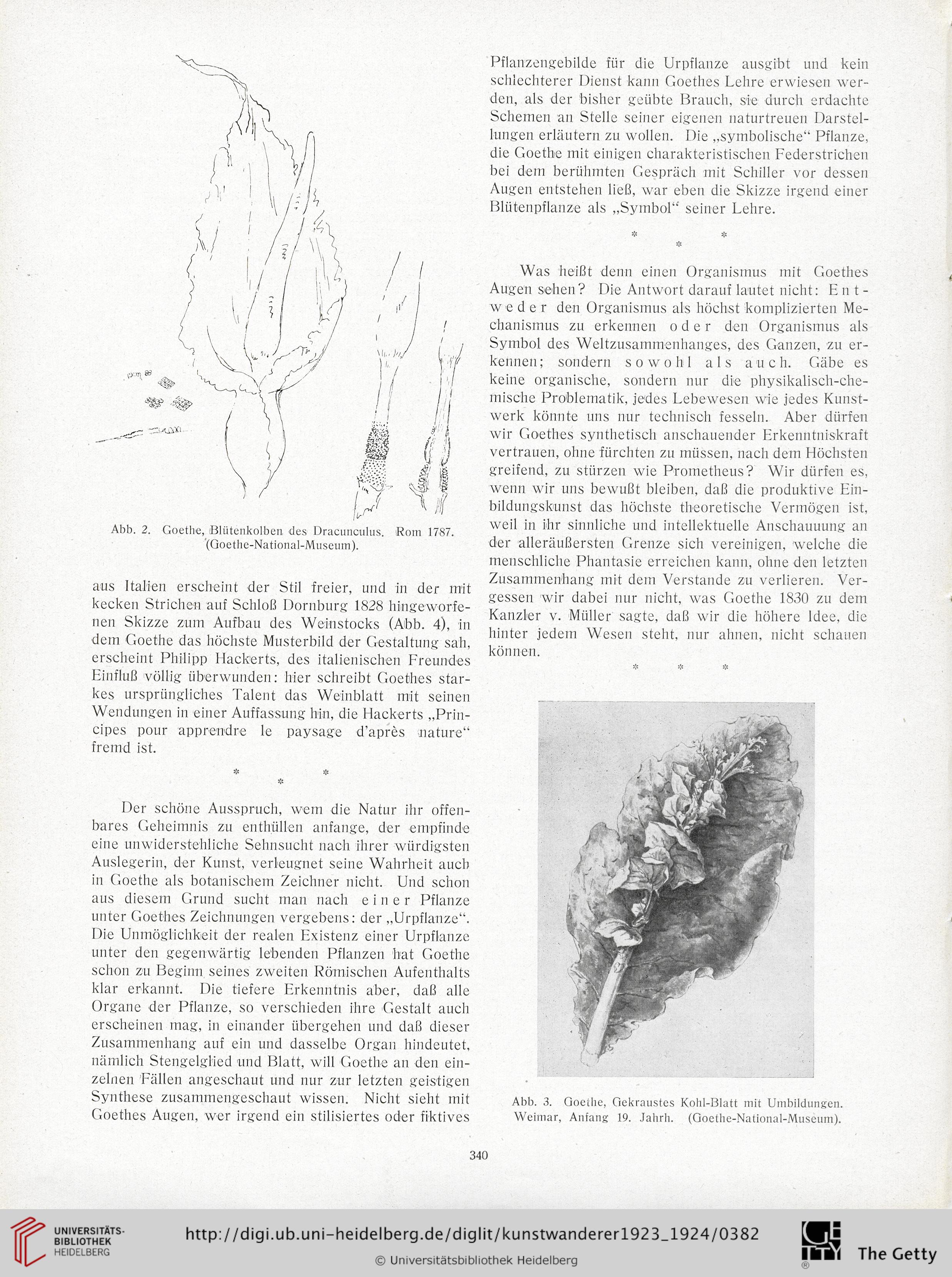Abb. 2. Goethe, Bliitenkolben des Dracunculus. iRom 1787.
(Goethe-National-Museum).
aus Italien erscheint der Stil freier, und in der mit
kecken Strichen auf Schloß Dornburg 1828 hingeworfe-
nen Skizze zum Aufbau des Weinstocks (Abb. 4), in
dem Goethe das höchste Musterbild der Gestaltung sah,
erscheint Philipp Hackerts, des italienischen Freundes
Einfluß völlig iiberwunden: hier schreibt Goethes star-
kes ursprtingliches 'l’alent das Weinblatt mit seinen
Wendungen in einer Auffassung hin, die Hackerts „Prin-
cipes pour apprendre le paysage d’apres nature“
fremd ist.
❖ ❖
Der schöne Ausspruch, wem die Natur ihr offen-
bares Geheimnis zu enthüllen anfange, der empfinde
eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten
Auslegerin, der Kunst, verleugnet seine Walirheit aucb
in Goethe als botanischem Zeichner nicht. Und schon
aus diesem Grund sucht man nach e i n e r Pflanze
unter Goethes Zeichnungen vergebens: der „Urpflanze“.
Die Unmöglichkeit der realen Existenz einer Urpflanze
unter den gegenwärtig le'benden Pflanzen hat Goethe
schon zu Beginn seines zweiten Römischen Aufenthalts
klar erkannt. Die tiefere Erkenntnis aber, daß alle
Organe der Pflanze, so verschieden ihre Gestalt auch
erscheinen mag, in einander übergehen und daß dieser
Zusammenbang auf ein und dasselbe Organ hindeutet,
nämlich Stengelglied und Blatt, will Goetlie an den ein-
zelnen ’Fällen angeschaut und nur zur letzten geistigen
Synthese zusammengeschaut wissen. Nicht sieht mit
Goethes Augen, wer irgend ein stilisiertes oder fiktives
Pflanzengebilde für die Urpflanze ausgibt und kein
schlechterer Dienst kann Goethes Lehre erwiesen wer-
den, als der bisher geübte Brauch, sie durch erdachte
Schemen an Stelle seiner eigenen naturtreuen Darstel-
lungen erläutern zu wollen. Die „symbolische“ Pflanze,
die Goethe mit einigen charakteristischen Federstrichen
bei dem berühmten Gespräch mit Schiller vor dessen
Augen entstehen ließ, war eben die Skizze irgend einer
Blütenpflanze als „Symbol“ seiner Lehre.
Was heißt denn einen Organisrnus mit Goethes
Augen sehen? Die Antwort darauf lautet nicht: E n t -
weder den Organismus als höchst komplizierten Me-
chanismus zu erkennen o d e r den Organismus als
Symbol des Weltzusammenhanges, des Ganzen, zu er-
kennen; sondern sowohl als auch. Gäbe es
keine organische, sondern nur die physikalisch-che-
mische Problernatik, jedes Lebewesen wie jedes Kunst-
werk könnte uns nur technisch fesseln. Aber diirfen
wir Goethes synthetisch anschauender Erkenntniskraft
vertrauen, ohne fürchten zu müssen, nach dem Höchsten
greifend, zu stürzen wie Prometheus? Wir dürfen es,
wenn wir uns bewußt bleiben, daß die produktive Ein-
bildungskunst das höchste theoretische Vermögen ist,
weil in ihr sinnliche und intellektuelle Anschauuung an
der alleräußersten Grenze sich vereinigen, welche die
menschliche Phantasie erreichen kann, ohne den letzten
Zusammen'hang mit dem Verstande zu verlieren. Ver-
gessen wir dabei nur nicht, was Goethe 1830 zu dem
Kanzler v. Müller sagte, daß wir die höhere ldee, die
hinter jedem Wesen steht, nur ahnen, nicht schauen
können.
Abb. 3. Goethe, Gekraustes Kohl-Blatt mit Umbildungen.
Weimar, Anfang 19. Jahrh. (Goethe-National-Museum).
340
(Goethe-National-Museum).
aus Italien erscheint der Stil freier, und in der mit
kecken Strichen auf Schloß Dornburg 1828 hingeworfe-
nen Skizze zum Aufbau des Weinstocks (Abb. 4), in
dem Goethe das höchste Musterbild der Gestaltung sah,
erscheint Philipp Hackerts, des italienischen Freundes
Einfluß völlig iiberwunden: hier schreibt Goethes star-
kes ursprtingliches 'l’alent das Weinblatt mit seinen
Wendungen in einer Auffassung hin, die Hackerts „Prin-
cipes pour apprendre le paysage d’apres nature“
fremd ist.
❖ ❖
Der schöne Ausspruch, wem die Natur ihr offen-
bares Geheimnis zu enthüllen anfange, der empfinde
eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten
Auslegerin, der Kunst, verleugnet seine Walirheit aucb
in Goethe als botanischem Zeichner nicht. Und schon
aus diesem Grund sucht man nach e i n e r Pflanze
unter Goethes Zeichnungen vergebens: der „Urpflanze“.
Die Unmöglichkeit der realen Existenz einer Urpflanze
unter den gegenwärtig le'benden Pflanzen hat Goethe
schon zu Beginn seines zweiten Römischen Aufenthalts
klar erkannt. Die tiefere Erkenntnis aber, daß alle
Organe der Pflanze, so verschieden ihre Gestalt auch
erscheinen mag, in einander übergehen und daß dieser
Zusammenbang auf ein und dasselbe Organ hindeutet,
nämlich Stengelglied und Blatt, will Goetlie an den ein-
zelnen ’Fällen angeschaut und nur zur letzten geistigen
Synthese zusammengeschaut wissen. Nicht sieht mit
Goethes Augen, wer irgend ein stilisiertes oder fiktives
Pflanzengebilde für die Urpflanze ausgibt und kein
schlechterer Dienst kann Goethes Lehre erwiesen wer-
den, als der bisher geübte Brauch, sie durch erdachte
Schemen an Stelle seiner eigenen naturtreuen Darstel-
lungen erläutern zu wollen. Die „symbolische“ Pflanze,
die Goethe mit einigen charakteristischen Federstrichen
bei dem berühmten Gespräch mit Schiller vor dessen
Augen entstehen ließ, war eben die Skizze irgend einer
Blütenpflanze als „Symbol“ seiner Lehre.
Was heißt denn einen Organisrnus mit Goethes
Augen sehen? Die Antwort darauf lautet nicht: E n t -
weder den Organismus als höchst komplizierten Me-
chanismus zu erkennen o d e r den Organismus als
Symbol des Weltzusammenhanges, des Ganzen, zu er-
kennen; sondern sowohl als auch. Gäbe es
keine organische, sondern nur die physikalisch-che-
mische Problernatik, jedes Lebewesen wie jedes Kunst-
werk könnte uns nur technisch fesseln. Aber diirfen
wir Goethes synthetisch anschauender Erkenntniskraft
vertrauen, ohne fürchten zu müssen, nach dem Höchsten
greifend, zu stürzen wie Prometheus? Wir dürfen es,
wenn wir uns bewußt bleiben, daß die produktive Ein-
bildungskunst das höchste theoretische Vermögen ist,
weil in ihr sinnliche und intellektuelle Anschauuung an
der alleräußersten Grenze sich vereinigen, welche die
menschliche Phantasie erreichen kann, ohne den letzten
Zusammen'hang mit dem Verstande zu verlieren. Ver-
gessen wir dabei nur nicht, was Goethe 1830 zu dem
Kanzler v. Müller sagte, daß wir die höhere ldee, die
hinter jedem Wesen steht, nur ahnen, nicht schauen
können.
Abb. 3. Goethe, Gekraustes Kohl-Blatt mit Umbildungen.
Weimar, Anfang 19. Jahrh. (Goethe-National-Museum).
340