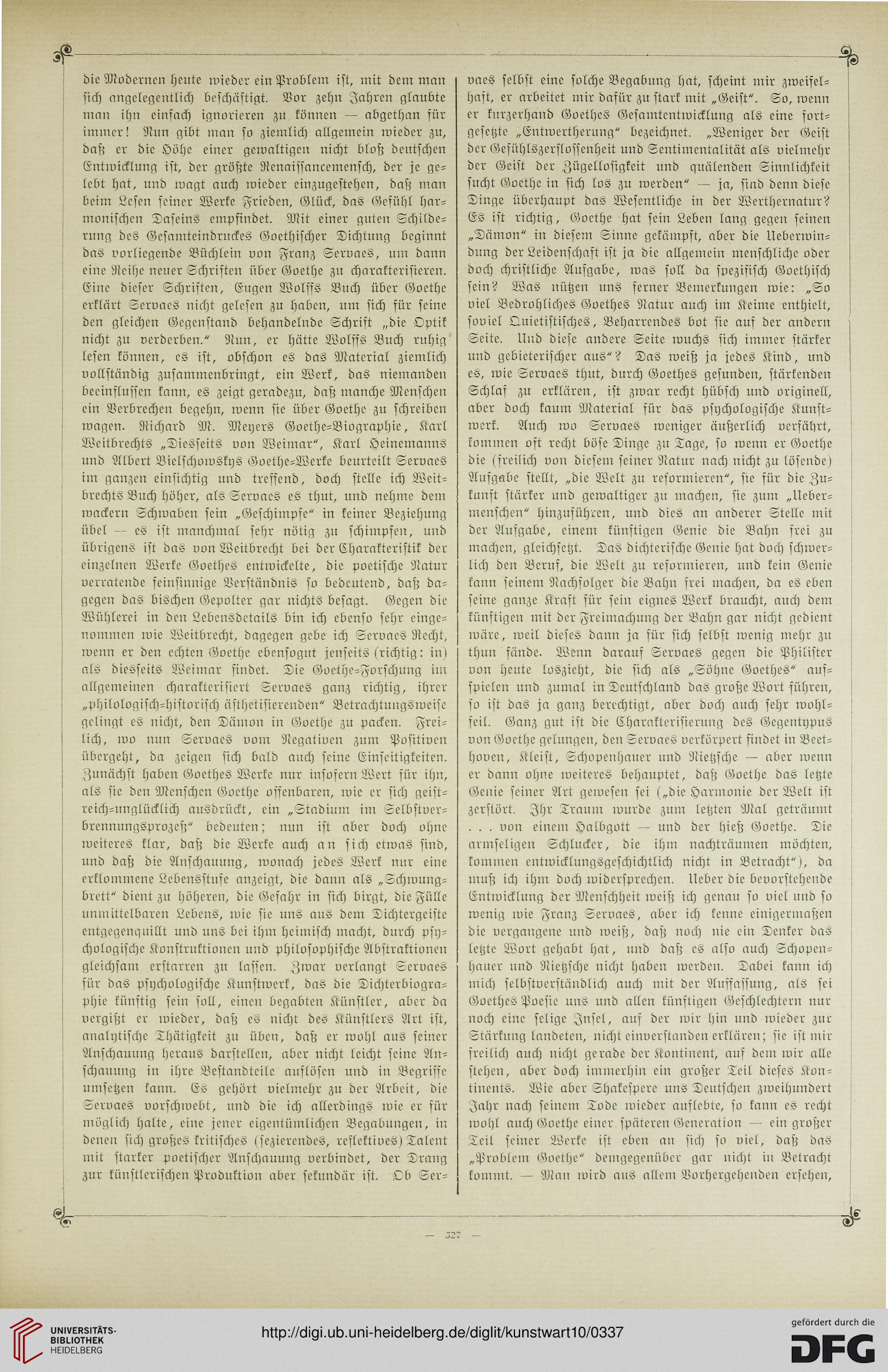die Modernen heutc nneder ein Problem ist, mit dem man
sich nngelegentlich beschnftigt. Vor zehn Jahren glnubte
man ihn einfach ignorieren zu können — abgethan sür
iminer! Nun gibt man so ziemlich allgemein wieder zu,
daß er die Höhe einer gewaltigen nicht bloß deutschen
Entwicklung ist, der größte Renaissancemensch, der je ge-
lebt hat, und wagt auch wieder einzugestehen, daß man
beim Lesen seiner Werke Frieden, Glück, das Gefühl har-
monischen Daseins empfindet. Mit einer guten Schilde-
rung des Gesamteindruckes Goethischer Dichtung beginnt
das vorliegende Büchlein von Franz Servaes, um dann
eine Reihe neuer Schriften über Goethe zu charakterisieren.
Eine dieser Schriften, Eugen Wolsss Buch über Goethe
erklärt Servaes nicht gelesen zu habcn, um sich für seine
den gleichen Gegenstand behandelnde Schrist „die Optik
nicht zu verderben." Nun, er hätte Wolffs Buch ruhig
lesen können, es ist, obschon es das Material ziemlich
vollständig zusammenbringt, ein Werk, das niemanden
beeinflussen kann, es zeigt geradezu, daß manche Menschen
ein Verbrechen begehn, wenn sie über Goethe zu schreiben
wagen. Richard M. Meyers Goethe-Viographie, Karl
Weitbrechts „Diesseits von Weimar", Karl Heinemanns
und Albert Bielschowskys Goethe-Werke beurteilt Servaes
im ganzen einsichtig und treffend, doch stelle ich Weit-
brechts Buch höher, als Servaes es thut, und nehme dem
wackern Schwaben sein „Geschimpfe" in keiner Beziehung
übel — es ist manchmal sehr nötig zu schimpfen, und
übrigens ist das von Weitbrecht bei der Charakteristik der
einzelnen Werke Goethes entwickelte, die poetische Natur
verratende feinsinnige Verständnis so bedeutend, daß da-
gegen das bischen Gepolter gar nichts besagt. Gegen die
Wühlerei in den Lebensdetails bin ich ebenso sehr einge-
nommen wie Weitbrecht, dagegen gebe ich Servaes Recht,
wenn er den echten Goethe ebensogut jenseits srichtig: in)
als diesseits Weimar findet. Die Goethe-Forschung im
allgemeinen charakterisiert Servaes ganz richtig, ihrer
„philologisch-historisch ästhetisierenden" Betrachtungsweisc
gelingt es nicht, den Dämon in Goethe zu packen. Frei-
lich, wo nun Servaes vom Negativen zum Positiven
übergeht, da zeigen sich bald auch seine Einseitigkeiten.
Zunächst haben Goethes Werke nur insofern Wert sür ihn,
als sie den Menschen Goethe offenbaren, wie er sich geist-
reich-unglücklich ausdrückt, ein „Stadium im Selbstver-
brennungsprozeß" bedeuten; nun ist aber doch ohne
weiteres klar, daß die Werke auch an sich etwas sind,
und daß die Anschauung, wonach jedes Werk nur eine
erklommene Lebensstufe anzeigt, die dann als „Schwung-
brett" dient zu höheren, die Gefahr in sich birgt, die Fülle
unmittelbaren Lebens, wie sie uns aus dem Dichtergeiste
entgegenquillt und uns bei ihm hcimisch macht, durch psy-
chologische Konstruktionen und philosophische Abstraktionen
gleichsam erstarren zu lassen. Zwar verlangt Servaes
für das psychologische Kunstwerk, das die Dichterbiogra-
phie künstig sein soll, einen begabten Künstler, aber da
vergißt er wieder, daß es nicht des Künstlers Art ist,
analrstische Thätigkeit zu üben, daß er wohl aus seiner
Anschauung heraus darstellen, aber nicht leicht seine An-
schauung in ihre Bestandteile auflösen und in Begriffe
umsetzen kann. Es gehört vielmehr zu der Arbeit, die
Servaes vorschwebt, und die ich allerdings wie er sür
möglich halte, eine jener eigentümlichen Begabungen, in
denen sich großes kritisches (sezierendes, reflektives) Talent
mit starker poetischer Anschauung verbindet, der Drang
zur künstlerischen Produktion aber sekundär ist. Ob Ser-
vaes selbst eine solche Begabung hat, scheint mir zweifel-
hast, er arbeitet mir dasür zu stark mit „Geist". So, wenn
er kurzerhand Goethes Gesamtcntwicklung als eine fort-
gesetzte „Entwertherung" bezeichnet. „Weniger der Geist
der Gefühlszerslossenheit und Sentimentalität als vielmehr
der Geist der Zügellosigkeit und quälenden Sinnlichkeit
sucht Goethe in sich los zu werden" — ja, sind denn diese
Dinge überhaupt dns Wesentliche in der Werthernatur?
Es ist richtig, Goethe hat sein Leben lang gegen seinen
„Dümon" in diesem Sinne gekämpft, aber die Ueberwin-
dung der Leidenschaft ist ja die allgemein menschliche oder
doch christliche Ausgabe, was soll da spezifisch Goethisch
sein? Was nützen uns serner Bemerkungen wie: „So
viel Bedrohliches Goethes Natur auch im Keime enthielt,
soviel Quietistisches, Beharrendes bot sie auf der andern
Seite. Und diese andere Seite wuchs sich immer stärker
und gebieterischer aus"? Das weiß ja jedes Kind, und
es, wie Servaes thut, durch Goethes gesunden, stärkenden
Schlaf zu erklären, ist zwar recht hübsch und originell,
aber doch kaum Material sür das psychologische Kunst-
werk. Auch wo Servaes weniger äußerlich verfährt,
kommen oft recht böse Dinge zu Tage, so wenn er Goethe
die (sreilich von diesem seiner Natur nach nicht zu lösende)
Aufgabe stellt, „die Welt zu resormieren", sre sür die Zu-
kunft stärker und gewaltiger zu machen, sie zum „Ueber-
menschen" hinzusühren, und dies an anderer Stelle mit
der Aufgabe, einem künftigen Genie die Bahn srei zu
machen, gleichsctzt. Das dichterische Genie hat doch schwer-
lich den Beruf, die Welt zu resormieren, und kein Genie
kann seinem Nachsolger die Bahn frei machen, da es eben
seine ganze Krast für sein eignes Werk braucht, auch dem
künftigen mit der Freimachung der Bahn gar nicht gedient
wäre, weil dieses dann ja sür sich selbst wenig mehr zu
thun fände. Wenn darauf Servaes gegen die Philister
von heute loszieht, die sich als „Söhne Goethes" aus-
spielen und zumal in Deutschland das große Wort führen,
so ist das ja ganz berechtigt, aber doch auch sehr wohl-
feil. Ganz gut ist die Charakterisierung des Gegentypus
von Goethe gelungen, den Servaes verkörpert findet in Beet-
hoven, Kleist, Schopenhauer und Nietzsche — aber wenn
er dann ohne weiteres behauptet, daß Goethe das letzte
Genie seiner Art gewesen sei („die Harmonie der Welt ist
zerstört. Jhr Traum wurde zum letzten Mal geträumt
. . . von einem Halbgott — und der hieß Goethe. Die
armseligen Schlucker, die ihm nachträumen möchten,
kommen entwicklungsgeschichtlich nicht in Betracht"), da
muß ich ihm doch widersprechen. Ueber die bevorstehende
Entwicklung der Menschheir weiß ich genau so viel und so
wenig wie Franz Servaes, aber ich kenne einigermaßen
die vergangene und weiß, daß noch nie ein Denker das
letzte Wort gehabt hat, und daß es also auch Schopen-
hauer und Nietzsche nicht haben werden. Dabei kann ich
mich selbstverstündlich auch mit der Auffassung, als sei
Goethes Poesie uns und allen künstigen Geschlechtern nur
noch eine selige Jnsel, auf der wir lstn und wieder zur
Stärkung landeten, nicht einverstanden erklären; sie ist mir
sreilich auch nicht gerade der Kontinent, auf dem wir alle
stehen, aber doch immerhin ein großer Teil dieses Kon-
tinents. Wie aber Shakespere uns Deutschen zweihundert
Jahr nach seinem Tode wieder auflebte, so kann es recht
wohl auch Goethe einer spüteren Generation — ein großer
Teil seiner Werke ist eben an sich so viel, daß das
„Problem Goethe" demgegenüber gar nicht in Betracht
kommt. — Man wird aus allem Vorhergehenden ersehen,
sich nngelegentlich beschnftigt. Vor zehn Jahren glnubte
man ihn einfach ignorieren zu können — abgethan sür
iminer! Nun gibt man so ziemlich allgemein wieder zu,
daß er die Höhe einer gewaltigen nicht bloß deutschen
Entwicklung ist, der größte Renaissancemensch, der je ge-
lebt hat, und wagt auch wieder einzugestehen, daß man
beim Lesen seiner Werke Frieden, Glück, das Gefühl har-
monischen Daseins empfindet. Mit einer guten Schilde-
rung des Gesamteindruckes Goethischer Dichtung beginnt
das vorliegende Büchlein von Franz Servaes, um dann
eine Reihe neuer Schriften über Goethe zu charakterisieren.
Eine dieser Schriften, Eugen Wolsss Buch über Goethe
erklärt Servaes nicht gelesen zu habcn, um sich für seine
den gleichen Gegenstand behandelnde Schrist „die Optik
nicht zu verderben." Nun, er hätte Wolffs Buch ruhig
lesen können, es ist, obschon es das Material ziemlich
vollständig zusammenbringt, ein Werk, das niemanden
beeinflussen kann, es zeigt geradezu, daß manche Menschen
ein Verbrechen begehn, wenn sie über Goethe zu schreiben
wagen. Richard M. Meyers Goethe-Viographie, Karl
Weitbrechts „Diesseits von Weimar", Karl Heinemanns
und Albert Bielschowskys Goethe-Werke beurteilt Servaes
im ganzen einsichtig und treffend, doch stelle ich Weit-
brechts Buch höher, als Servaes es thut, und nehme dem
wackern Schwaben sein „Geschimpfe" in keiner Beziehung
übel — es ist manchmal sehr nötig zu schimpfen, und
übrigens ist das von Weitbrecht bei der Charakteristik der
einzelnen Werke Goethes entwickelte, die poetische Natur
verratende feinsinnige Verständnis so bedeutend, daß da-
gegen das bischen Gepolter gar nichts besagt. Gegen die
Wühlerei in den Lebensdetails bin ich ebenso sehr einge-
nommen wie Weitbrecht, dagegen gebe ich Servaes Recht,
wenn er den echten Goethe ebensogut jenseits srichtig: in)
als diesseits Weimar findet. Die Goethe-Forschung im
allgemeinen charakterisiert Servaes ganz richtig, ihrer
„philologisch-historisch ästhetisierenden" Betrachtungsweisc
gelingt es nicht, den Dämon in Goethe zu packen. Frei-
lich, wo nun Servaes vom Negativen zum Positiven
übergeht, da zeigen sich bald auch seine Einseitigkeiten.
Zunächst haben Goethes Werke nur insofern Wert sür ihn,
als sie den Menschen Goethe offenbaren, wie er sich geist-
reich-unglücklich ausdrückt, ein „Stadium im Selbstver-
brennungsprozeß" bedeuten; nun ist aber doch ohne
weiteres klar, daß die Werke auch an sich etwas sind,
und daß die Anschauung, wonach jedes Werk nur eine
erklommene Lebensstufe anzeigt, die dann als „Schwung-
brett" dient zu höheren, die Gefahr in sich birgt, die Fülle
unmittelbaren Lebens, wie sie uns aus dem Dichtergeiste
entgegenquillt und uns bei ihm hcimisch macht, durch psy-
chologische Konstruktionen und philosophische Abstraktionen
gleichsam erstarren zu lassen. Zwar verlangt Servaes
für das psychologische Kunstwerk, das die Dichterbiogra-
phie künstig sein soll, einen begabten Künstler, aber da
vergißt er wieder, daß es nicht des Künstlers Art ist,
analrstische Thätigkeit zu üben, daß er wohl aus seiner
Anschauung heraus darstellen, aber nicht leicht seine An-
schauung in ihre Bestandteile auflösen und in Begriffe
umsetzen kann. Es gehört vielmehr zu der Arbeit, die
Servaes vorschwebt, und die ich allerdings wie er sür
möglich halte, eine jener eigentümlichen Begabungen, in
denen sich großes kritisches (sezierendes, reflektives) Talent
mit starker poetischer Anschauung verbindet, der Drang
zur künstlerischen Produktion aber sekundär ist. Ob Ser-
vaes selbst eine solche Begabung hat, scheint mir zweifel-
hast, er arbeitet mir dasür zu stark mit „Geist". So, wenn
er kurzerhand Goethes Gesamtcntwicklung als eine fort-
gesetzte „Entwertherung" bezeichnet. „Weniger der Geist
der Gefühlszerslossenheit und Sentimentalität als vielmehr
der Geist der Zügellosigkeit und quälenden Sinnlichkeit
sucht Goethe in sich los zu werden" — ja, sind denn diese
Dinge überhaupt dns Wesentliche in der Werthernatur?
Es ist richtig, Goethe hat sein Leben lang gegen seinen
„Dümon" in diesem Sinne gekämpft, aber die Ueberwin-
dung der Leidenschaft ist ja die allgemein menschliche oder
doch christliche Ausgabe, was soll da spezifisch Goethisch
sein? Was nützen uns serner Bemerkungen wie: „So
viel Bedrohliches Goethes Natur auch im Keime enthielt,
soviel Quietistisches, Beharrendes bot sie auf der andern
Seite. Und diese andere Seite wuchs sich immer stärker
und gebieterischer aus"? Das weiß ja jedes Kind, und
es, wie Servaes thut, durch Goethes gesunden, stärkenden
Schlaf zu erklären, ist zwar recht hübsch und originell,
aber doch kaum Material sür das psychologische Kunst-
werk. Auch wo Servaes weniger äußerlich verfährt,
kommen oft recht böse Dinge zu Tage, so wenn er Goethe
die (sreilich von diesem seiner Natur nach nicht zu lösende)
Aufgabe stellt, „die Welt zu resormieren", sre sür die Zu-
kunft stärker und gewaltiger zu machen, sie zum „Ueber-
menschen" hinzusühren, und dies an anderer Stelle mit
der Aufgabe, einem künftigen Genie die Bahn srei zu
machen, gleichsctzt. Das dichterische Genie hat doch schwer-
lich den Beruf, die Welt zu resormieren, und kein Genie
kann seinem Nachsolger die Bahn frei machen, da es eben
seine ganze Krast für sein eignes Werk braucht, auch dem
künftigen mit der Freimachung der Bahn gar nicht gedient
wäre, weil dieses dann ja sür sich selbst wenig mehr zu
thun fände. Wenn darauf Servaes gegen die Philister
von heute loszieht, die sich als „Söhne Goethes" aus-
spielen und zumal in Deutschland das große Wort führen,
so ist das ja ganz berechtigt, aber doch auch sehr wohl-
feil. Ganz gut ist die Charakterisierung des Gegentypus
von Goethe gelungen, den Servaes verkörpert findet in Beet-
hoven, Kleist, Schopenhauer und Nietzsche — aber wenn
er dann ohne weiteres behauptet, daß Goethe das letzte
Genie seiner Art gewesen sei („die Harmonie der Welt ist
zerstört. Jhr Traum wurde zum letzten Mal geträumt
. . . von einem Halbgott — und der hieß Goethe. Die
armseligen Schlucker, die ihm nachträumen möchten,
kommen entwicklungsgeschichtlich nicht in Betracht"), da
muß ich ihm doch widersprechen. Ueber die bevorstehende
Entwicklung der Menschheir weiß ich genau so viel und so
wenig wie Franz Servaes, aber ich kenne einigermaßen
die vergangene und weiß, daß noch nie ein Denker das
letzte Wort gehabt hat, und daß es also auch Schopen-
hauer und Nietzsche nicht haben werden. Dabei kann ich
mich selbstverstündlich auch mit der Auffassung, als sei
Goethes Poesie uns und allen künstigen Geschlechtern nur
noch eine selige Jnsel, auf der wir lstn und wieder zur
Stärkung landeten, nicht einverstanden erklären; sie ist mir
sreilich auch nicht gerade der Kontinent, auf dem wir alle
stehen, aber doch immerhin ein großer Teil dieses Kon-
tinents. Wie aber Shakespere uns Deutschen zweihundert
Jahr nach seinem Tode wieder auflebte, so kann es recht
wohl auch Goethe einer spüteren Generation — ein großer
Teil seiner Werke ist eben an sich so viel, daß das
„Problem Goethe" demgegenüber gar nicht in Betracht
kommt. — Man wird aus allem Vorhergehenden ersehen,