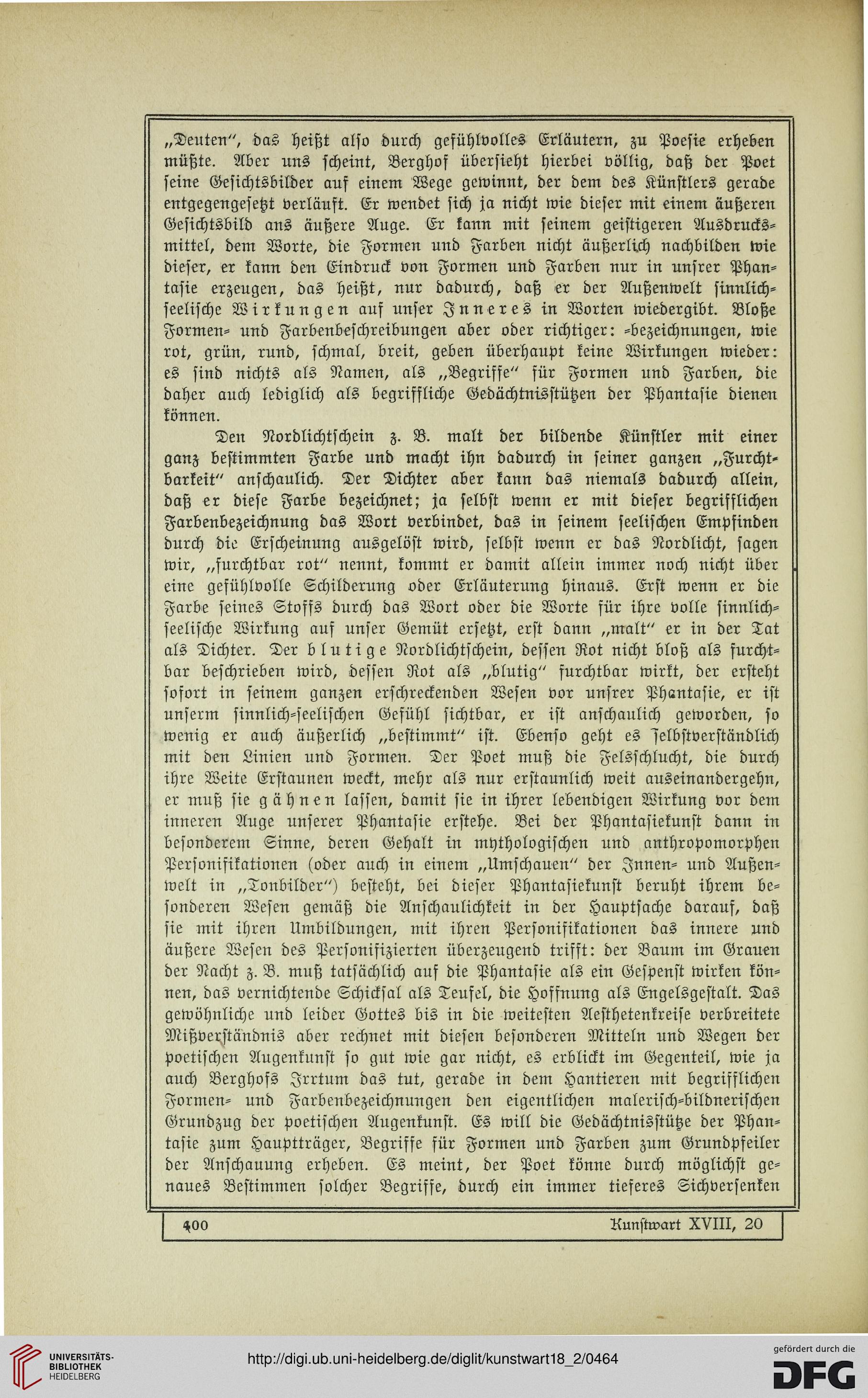„Deuten", das heißt also durch gefühlvolles Erläutern, zu Poesie erheben
müßte. Aber uns scheint, Berghof übersieht hierbei völlig, daß der Poet
seine Gesichtsbilder auf einem Wege gewinnt, der dem des Künstlers gerade
entgegengesetzt verläuft. Er wendet sich ja nicht wie dieser mit einem äußeren
Gesichtsbild ans äußere Auge. Er kann mit seinem geistigeren Ausdrucks--
mittel, dem Worte, die Formen und Farben nicht äußerlich nachbilden wie
dieser, er kann den Eindruck von Formen und Farben nur in unsrer Phan-
tasie erzeugen, das heißt, nur dadurch, daß er der Außenwelt sinnlich-
seelische Wirkungen auf unfer Jnneres in Worten wiedergibt. Bloße
Formen- und Farbenbeschreibungen aber oder richtiger: -bezeichnungen, wie
rot, grün, rund, schmal, breit, geben überhaupt keine Wirkungen wieder:
es sind nichts als Namen, als „Begriffe" für Formen und Farben, die
daher auch lediglich als begriffliche Gedächtnisstützen der Phantasie dienen
können.
Den Nordlichtschein z. B. malt der bildende Künstler mit einer
ganz bestimmten Farbe und macht ihn dadurch in seiner ganzen „Furcht-
barkeit" anschaulich. Der Dichter aber kann das niemals dadurch allein,
daß er diese Farbe bezeichnet; ja selbst wenn er mit dieser begrifflichen
Farbenbezeichnung das Wort verbindet, das in seinem seelischen Empfinden
durch die Erscheinung ausgelöst wird, selbst wenn er das Nordlicht, sagen
wir, „furchtbar rot" nennt, kommt er damit allein immer noch nicht über
eine gefühlvolle Schilderung oder Erläuterung hinaus. Erst wenn er die
Farbe seines Stoffs durch das Wort oder die Worte für ihre volle sinnlich-
seelische Wirkung auf unser Gemüt ersetzt, erst dann „malt" er in der Tat
als Dichter. Der blutige Nordlichtschein, dessen Rot nicht bloß als furcht-
bar beschrieben wird, dessen Rot als „blutig" furchtbar wirkt, der ersteht
sofort in seinem ganzen erschreckenden Wesen vor unsrer Phantasie, er ist
unserm sinnlich-seelischen Gesühl sichtbar, er ist anschaulich geworden, so
wenig er auch äußerlich „bestimmt" ist. Ebenso geht es 'selbstverständlich
mit den Linien und Formen. Der Poet muß die Felsschlucht, die durch
ihre Weite Erstaunen weckt, mehr als nur erstaunlich weit auseinandergehn,
er muß sie gähnen lassen, damit sie in ihrer lebendigen Wirkung vor dem
innereu Auge unserer Phantasie erstehe. Bei der Phantasiekunst dann in
besonderem Sinne, deren Gehalt in mythologischen und anthropomorphen
Personifikationen (oder auch in einem „Umschauen" der Jnnen- und Außen-
welt in „Tonbilder") besteht, bei dieser Phantasiekunst beruht ihrem be-
sonderen Wesen gemäß die Anschaulichkeit in der Hauptsache darauf, daß
sie mit ihren Umbilduugen, mit ihren Personifikationen das innere und
äußere Wesen des Personifizierten überzeugend trifft: der Baum im Grauen
der Nacht z. B. muß tatsächlich auf die Phantasie als ein Gespenst wirken kön-
nen, das vernichtende Schicksal als Teufel, die Hoffnung als Engelsgestalt. Das
gewöhnliche und leider Gottes bis in die weitesten Aesthetenkreise verbreitete
Mißverständnis aber rechnet mit diesen besonderen Mitteln und Wegen der
poetischen Augenkunst so gut wie gar nicht, es erblickt im Gegenteil, wie ja
auch Berghofs Jrrtum das tut, gerade in dem Hantieren mit begrifflichen
Formen- und Farbenbezeichnungen den eigentlichen malerisch-bildnerischen
Grundzug der poetischen Augenkunst. Es will die Gedächtnisstütze der Phan-
tasie zum Hauptträger, Begriffe für Formen und Farben zum Grundpfeiler
der Anschauung erheben. Es meint, der Poet könne durch möglichst ge-
naues Bestimmen solcher Begriffe, durch ein immer tieferes Sichversenken
HOO Runstwart XVIII, 20
müßte. Aber uns scheint, Berghof übersieht hierbei völlig, daß der Poet
seine Gesichtsbilder auf einem Wege gewinnt, der dem des Künstlers gerade
entgegengesetzt verläuft. Er wendet sich ja nicht wie dieser mit einem äußeren
Gesichtsbild ans äußere Auge. Er kann mit seinem geistigeren Ausdrucks--
mittel, dem Worte, die Formen und Farben nicht äußerlich nachbilden wie
dieser, er kann den Eindruck von Formen und Farben nur in unsrer Phan-
tasie erzeugen, das heißt, nur dadurch, daß er der Außenwelt sinnlich-
seelische Wirkungen auf unfer Jnneres in Worten wiedergibt. Bloße
Formen- und Farbenbeschreibungen aber oder richtiger: -bezeichnungen, wie
rot, grün, rund, schmal, breit, geben überhaupt keine Wirkungen wieder:
es sind nichts als Namen, als „Begriffe" für Formen und Farben, die
daher auch lediglich als begriffliche Gedächtnisstützen der Phantasie dienen
können.
Den Nordlichtschein z. B. malt der bildende Künstler mit einer
ganz bestimmten Farbe und macht ihn dadurch in seiner ganzen „Furcht-
barkeit" anschaulich. Der Dichter aber kann das niemals dadurch allein,
daß er diese Farbe bezeichnet; ja selbst wenn er mit dieser begrifflichen
Farbenbezeichnung das Wort verbindet, das in seinem seelischen Empfinden
durch die Erscheinung ausgelöst wird, selbst wenn er das Nordlicht, sagen
wir, „furchtbar rot" nennt, kommt er damit allein immer noch nicht über
eine gefühlvolle Schilderung oder Erläuterung hinaus. Erst wenn er die
Farbe seines Stoffs durch das Wort oder die Worte für ihre volle sinnlich-
seelische Wirkung auf unser Gemüt ersetzt, erst dann „malt" er in der Tat
als Dichter. Der blutige Nordlichtschein, dessen Rot nicht bloß als furcht-
bar beschrieben wird, dessen Rot als „blutig" furchtbar wirkt, der ersteht
sofort in seinem ganzen erschreckenden Wesen vor unsrer Phantasie, er ist
unserm sinnlich-seelischen Gesühl sichtbar, er ist anschaulich geworden, so
wenig er auch äußerlich „bestimmt" ist. Ebenso geht es 'selbstverständlich
mit den Linien und Formen. Der Poet muß die Felsschlucht, die durch
ihre Weite Erstaunen weckt, mehr als nur erstaunlich weit auseinandergehn,
er muß sie gähnen lassen, damit sie in ihrer lebendigen Wirkung vor dem
innereu Auge unserer Phantasie erstehe. Bei der Phantasiekunst dann in
besonderem Sinne, deren Gehalt in mythologischen und anthropomorphen
Personifikationen (oder auch in einem „Umschauen" der Jnnen- und Außen-
welt in „Tonbilder") besteht, bei dieser Phantasiekunst beruht ihrem be-
sonderen Wesen gemäß die Anschaulichkeit in der Hauptsache darauf, daß
sie mit ihren Umbilduugen, mit ihren Personifikationen das innere und
äußere Wesen des Personifizierten überzeugend trifft: der Baum im Grauen
der Nacht z. B. muß tatsächlich auf die Phantasie als ein Gespenst wirken kön-
nen, das vernichtende Schicksal als Teufel, die Hoffnung als Engelsgestalt. Das
gewöhnliche und leider Gottes bis in die weitesten Aesthetenkreise verbreitete
Mißverständnis aber rechnet mit diesen besonderen Mitteln und Wegen der
poetischen Augenkunst so gut wie gar nicht, es erblickt im Gegenteil, wie ja
auch Berghofs Jrrtum das tut, gerade in dem Hantieren mit begrifflichen
Formen- und Farbenbezeichnungen den eigentlichen malerisch-bildnerischen
Grundzug der poetischen Augenkunst. Es will die Gedächtnisstütze der Phan-
tasie zum Hauptträger, Begriffe für Formen und Farben zum Grundpfeiler
der Anschauung erheben. Es meint, der Poet könne durch möglichst ge-
naues Bestimmen solcher Begriffe, durch ein immer tieferes Sichversenken
HOO Runstwart XVIII, 20