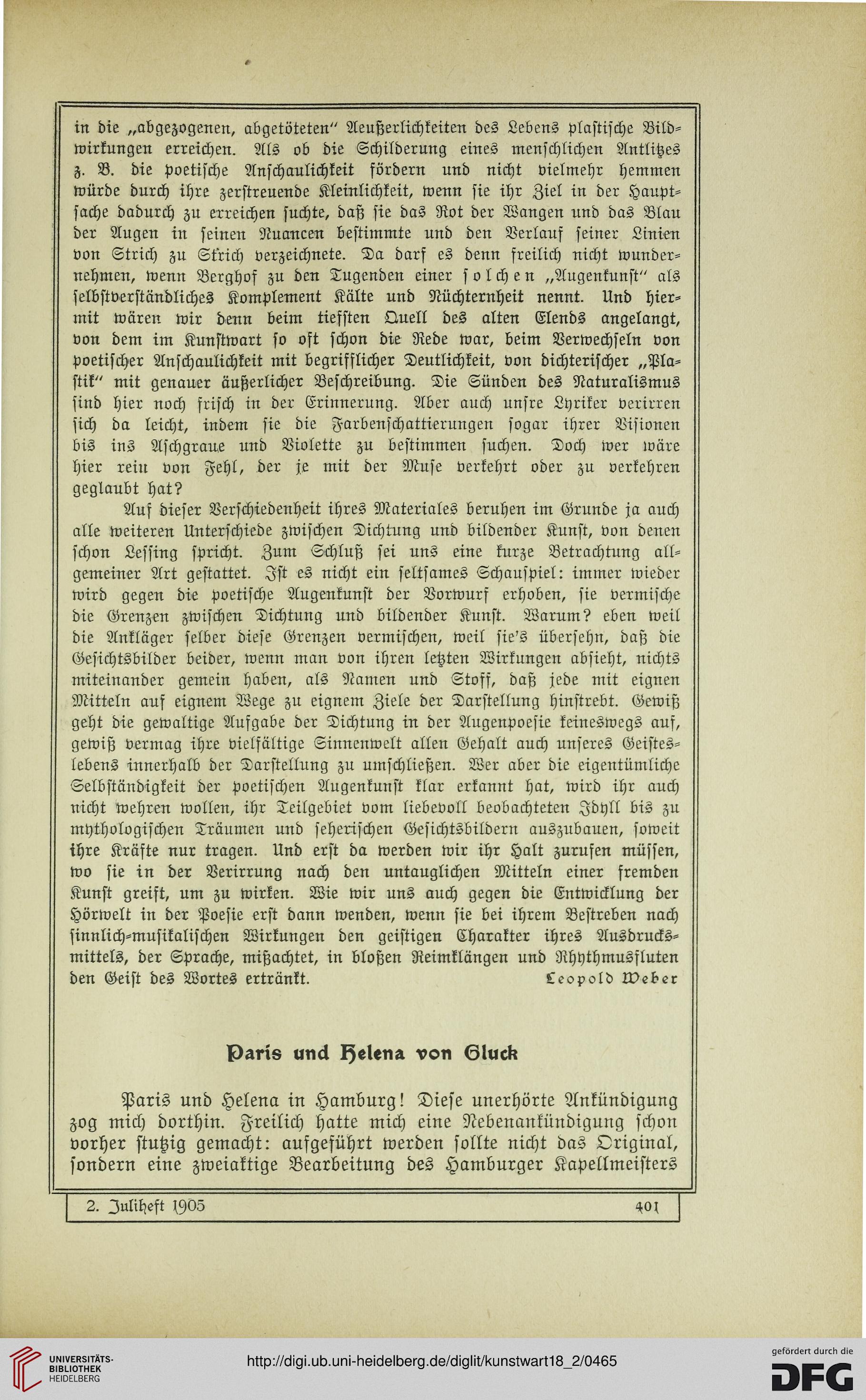in die „abgezogenen, abgetöteten" Aeußerlichkeiten des Lebens plastische Bild-
wirkungen erreichen. Als ob die Schilderung eines menschlichen Antlitzes
z. B. die poetische Anschanlichkeit sördern und nicht vielmehr hemmen
würde durch ihre zerstreuende Kleinlichkeit, wenn sie ihr Ziel in der Haupt-
sache dadurch zu erreichen suchte, daß sie das Rot der Wangen und das Blau
der Augen in seinen Nuancen bestimmte und den Verlauf seiner Linien
von Strich zu Strich verzeichnete. Da darf es denn freilich nicht wunder-
nehmen, wenn Berghof zu den Tugenden einer solchen „Augenkunst" als
selbstverständliches Komplement Kälte und Nüchternheit nennt. Und hier-
mit wären wir denn beim tiefsten Quell des alten Elends angelangt,
von dem im Kunstwart so oft schon die Rede war, beim Verwechseln von
poetischer Anschaulichkeit mit begrifflicher Deutlichkeit, von dichterischer „Pla-
stik" mit genauer äußerlicher Beschreibung. Die Sünden des Naturalismus
sind hier noch frisch in der Erinnerung. Aber auch unsre Lyriker verirren
sich da leicht, indem sie die Farbenschattierungen sogar ihrer Visionen
bis inS Aschgrane und Violette zu bestimmen suchen. Doch wer wäre
hier rein von Fehl, der je mit der Muse verkehrt oder zu verkehren
geglaubt hat?
Auf dieser Verschiedenheit ihres Materiales beruhen im Grunde ja auch
alle weiteren Unterschiede zwischen Dichtung und bildender Kunst, von denen
schon Lessing spricht. Zum Schluß sei uns eine kurze Betrachtung all-
gemeiner Art gestattet. Jst es nicht ein seltsames Schauspiel: immer wieder
wird gegen die poetische Augenkunst der Vorwurf erhoben, sie vermische
die Grenzen zwischen Dichtung und bildender Kunst. Warum? eben weil
die Ankläger selber diese Grenzen vermischen, weil sie's übersehn, daß die
Gesichtsbilder beider, wenn man von ihren letzten Wirkungen absieht, nichts
miteinander gemein haben, als Namen und Stoff, daß jede mit eignen
Mitteln auf eignem Wege zu eignem Ziele der Darstellung hinstrebt. Gewiß
geht die gewaltige Aufgabe der Dichtung in der Augenpoesie keineswegs auf,
gewiß vermag ihre vielfältige Siuneuwelt allen Gehalt auch unseres Geistes-
lebens innerhalb der Darstellung zu umschließen. Wer aber die eigentümliche
Selbständigkeit der poetischen Augenkunst klar erkannt hat, wird ihr auch
nicht wehren wollen, ihr Teilgebiet vom liebevoll beobachteten Jdyll bis zu
mythologischen Träumen und seherischen Gesichtsbildern auszubauen, soweit
ihre Kräfte nur tragen. Und erst da werden wir ihr Halt zurufen müssen,
wo sie in der Verirrung nach den untauglichen Mitteln einer fremden
Kunst greift, um zu wirken. Wie wir uns auch gegen die Entwicklung der
Hörwelt in der Poesie erst dann wenden, wenn sie bei ihrem Bestreben nach
sinnlich-musikalischen Wirkungen den geistigen Charakter ihres Ausdrucks-
mittels, der Sprache, mißachtet, in bloßen Reimklängen und Nhythmusfluten
den Geist des Wortes ertränkt. Leopold weber
Oaris linci IZelena von Gluck
Paris und Helena in Harnburg! Diese unerhörte Ankündigung
zog mich dorthin. Freilich hatte mich eine Nebenankündigung schon
vorher stutzig gemacht: aufgeführt werden sollte nicht das Original,
sondern eine zweiaktige Bearbeitung des Hamburger Kapellmeisters
2. Zuliheft l9Ö5 ^Ot
wirkungen erreichen. Als ob die Schilderung eines menschlichen Antlitzes
z. B. die poetische Anschanlichkeit sördern und nicht vielmehr hemmen
würde durch ihre zerstreuende Kleinlichkeit, wenn sie ihr Ziel in der Haupt-
sache dadurch zu erreichen suchte, daß sie das Rot der Wangen und das Blau
der Augen in seinen Nuancen bestimmte und den Verlauf seiner Linien
von Strich zu Strich verzeichnete. Da darf es denn freilich nicht wunder-
nehmen, wenn Berghof zu den Tugenden einer solchen „Augenkunst" als
selbstverständliches Komplement Kälte und Nüchternheit nennt. Und hier-
mit wären wir denn beim tiefsten Quell des alten Elends angelangt,
von dem im Kunstwart so oft schon die Rede war, beim Verwechseln von
poetischer Anschaulichkeit mit begrifflicher Deutlichkeit, von dichterischer „Pla-
stik" mit genauer äußerlicher Beschreibung. Die Sünden des Naturalismus
sind hier noch frisch in der Erinnerung. Aber auch unsre Lyriker verirren
sich da leicht, indem sie die Farbenschattierungen sogar ihrer Visionen
bis inS Aschgrane und Violette zu bestimmen suchen. Doch wer wäre
hier rein von Fehl, der je mit der Muse verkehrt oder zu verkehren
geglaubt hat?
Auf dieser Verschiedenheit ihres Materiales beruhen im Grunde ja auch
alle weiteren Unterschiede zwischen Dichtung und bildender Kunst, von denen
schon Lessing spricht. Zum Schluß sei uns eine kurze Betrachtung all-
gemeiner Art gestattet. Jst es nicht ein seltsames Schauspiel: immer wieder
wird gegen die poetische Augenkunst der Vorwurf erhoben, sie vermische
die Grenzen zwischen Dichtung und bildender Kunst. Warum? eben weil
die Ankläger selber diese Grenzen vermischen, weil sie's übersehn, daß die
Gesichtsbilder beider, wenn man von ihren letzten Wirkungen absieht, nichts
miteinander gemein haben, als Namen und Stoff, daß jede mit eignen
Mitteln auf eignem Wege zu eignem Ziele der Darstellung hinstrebt. Gewiß
geht die gewaltige Aufgabe der Dichtung in der Augenpoesie keineswegs auf,
gewiß vermag ihre vielfältige Siuneuwelt allen Gehalt auch unseres Geistes-
lebens innerhalb der Darstellung zu umschließen. Wer aber die eigentümliche
Selbständigkeit der poetischen Augenkunst klar erkannt hat, wird ihr auch
nicht wehren wollen, ihr Teilgebiet vom liebevoll beobachteten Jdyll bis zu
mythologischen Träumen und seherischen Gesichtsbildern auszubauen, soweit
ihre Kräfte nur tragen. Und erst da werden wir ihr Halt zurufen müssen,
wo sie in der Verirrung nach den untauglichen Mitteln einer fremden
Kunst greift, um zu wirken. Wie wir uns auch gegen die Entwicklung der
Hörwelt in der Poesie erst dann wenden, wenn sie bei ihrem Bestreben nach
sinnlich-musikalischen Wirkungen den geistigen Charakter ihres Ausdrucks-
mittels, der Sprache, mißachtet, in bloßen Reimklängen und Nhythmusfluten
den Geist des Wortes ertränkt. Leopold weber
Oaris linci IZelena von Gluck
Paris und Helena in Harnburg! Diese unerhörte Ankündigung
zog mich dorthin. Freilich hatte mich eine Nebenankündigung schon
vorher stutzig gemacht: aufgeführt werden sollte nicht das Original,
sondern eine zweiaktige Bearbeitung des Hamburger Kapellmeisters
2. Zuliheft l9Ö5 ^Ot