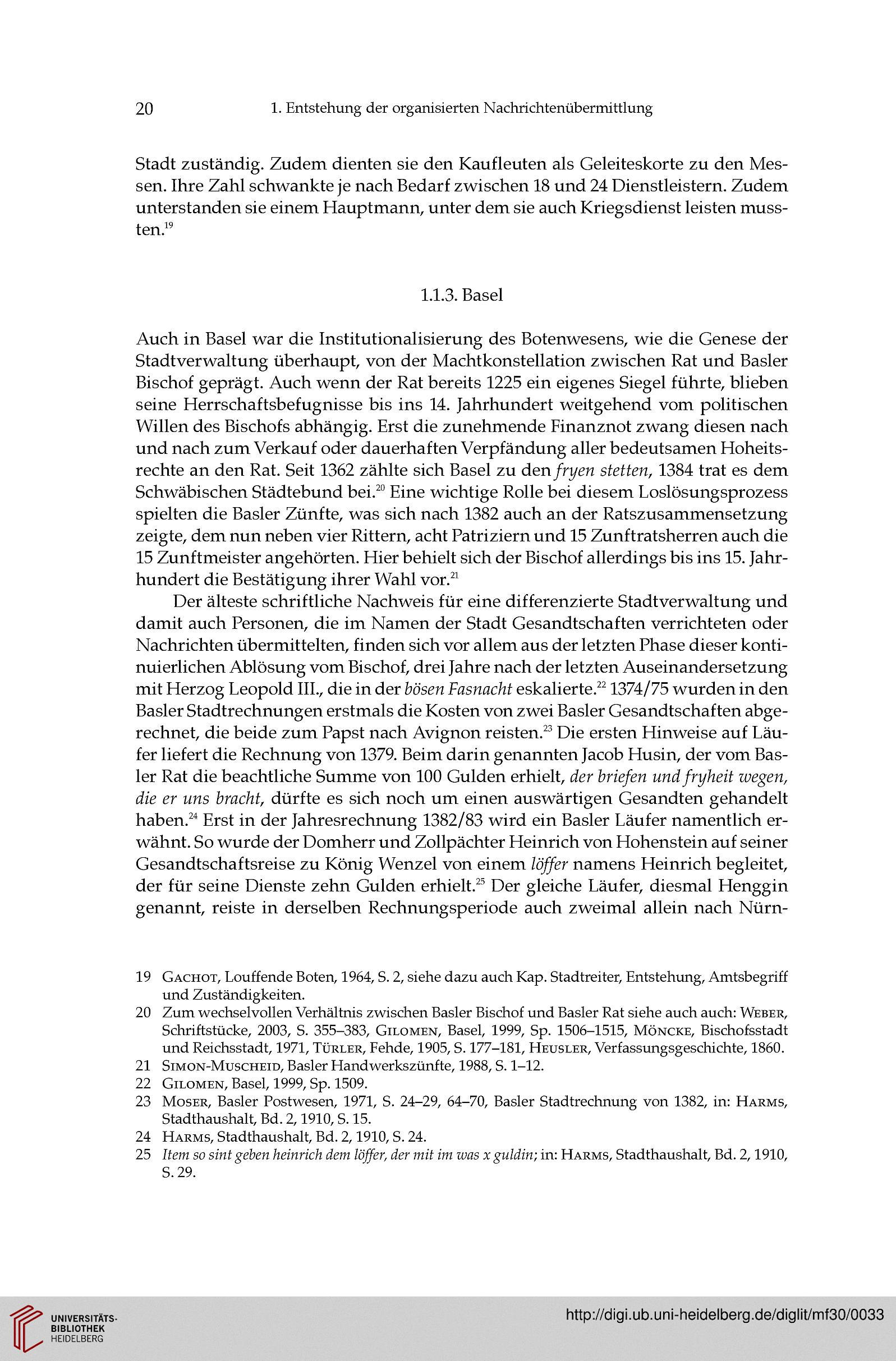20
1. Entstehung der organisierten Nachrichtenübermittlung
Stadt zuständig. Zudem dienten sie den Kaufleuten als Geleiteskorte zu den Mes-
sen. Ihre Zahl schwankte je nach Bedarf zwischen 18 und 24 Dienstleistern. Zudem
unterstanden sie einem Hauptmann, unter dem sie auch Kriegsdienst leisten muss-
ten.19
1.1.3. Basel
Auch in Basel war die Institutionalisierung des Botenwesens, wie die Genese der
Stadtverwaltung überhaupt, von der Machtkonstellation zwischen Rat und Basler
Bischof geprägt. Auch wenn der Rat bereits 1225 ein eigenes Siegel führte, blieben
seine Herrschaftsbefugnisse bis ins 14. Jahrhundert weitgehend vom politischen
Willen des Bischofs abhängig. Erst die zunehmende Finanznot zwang diesen nach
und nach zum Verkauf oder dauerhaften Verpfändung aller bedeutsamen Hoheits-
rechte an den Rat. Seit 1362 zählte sich Basel zu den fryen stetten, 1384 trat es dem
Schwäbischen Städtebund bei.20 Eine wichtige Rolle bei diesem Loslösungsprozess
spielten die Basler Zünfte, was sich nach 1382 auch an der Ratszusammensetzung
zeigte, dem nun neben vier Rittern, acht Patriziern und 15 Zunftratsherren auch die
15 Zunftmeister angehörten. Hier behielt sich der Bischof allerdings bis ins 15. Jahr-
hundert die Bestätigung ihrer Wahl vor.21
Der älteste schriftliche Nachweis für eine differenzierte Stadtverwaltung und
damit auch Personen, die im Namen der Stadt Gesandtschaften verrichteten oder
Nachrichten übermittelten, finden sich vor allem aus der letzten Phase dieser konti-
nuierlichen Ablösung vom Bischof, drei Jahre nach der letzten Auseinandersetzung
mit Herzog Leopold III., die in der bösen Fasnacht eskalierte.221374/75 wurden in den
Basler Stadtrechnungen erstmals die Kosten von zwei Basler Gesandtschaften abge-
rechnet, die beide zum Papst nach Avignon reisten.23 Die ersten Hinweise auf Läu-
fer liefert die Rechnung von 1379. Beim darin genannten Jacob Husin, der vom Bas-
ler Rat die beachtliche Summe von 100 Gulden erhielt, der briefen nndfryheit wegen,
die er uns bracht, dürfte es sich noch um einen auswärtigen Gesandten gehandelt
haben.24 Erst in der Jahresrechnung 1382/83 wird ein Basler Läufer namentlich er-
wähnt. So wurde der Domherr und Zollpächter Heinrich von Hohenstein auf seiner
Gesandtschaftsreise zu König Wenzel von einem löffer namens Heinrich begleitet,
der für seine Dienste zehn Gulden erhielt.25 Der gleiche Läufer, diesmal Henggin
genannt, reiste in derselben Rechnungsperiode auch zweimal allein nach Nürn-
19 Gachot, Louffende Boten, 1964, S. 2, siehe dazu auch Kap. Stadtreiter, Entstehung, Amtsbegriff
und Zuständigkeiten.
20 Zum wechselvollen Verhältnis zwischen Basler Bischof und Basler Rat siehe auch auch: Weber,
Schriftstücke, 2003, S. 355-383, Gilomen, Basel, 1999, Sp. 1506-1515, Möncke, Bischofsstadt
und Reichsstadt, 1971, Türler, Fehde, 1905, S. 177-181, Heusler, Verfassungsgeschichte, 1860.
21 Simon-Muscheid, Basler Handwerkszünfte, 1988, S. 1-12.
22 Gilomen, Basel, 1999, Sp. 1509.
23 Moser, Basler Postwesen, 1971, S. 24-29, 64-70, Basler Stadtrechnung von 1382, in: Harms,
Stadthaushalt, Bd. 2,1910, S. 15.
24 Harms, Stadthaushalt, Bd. 2,1910, S. 24.
25 Item so sint geben heinrich dem löffer, der mit im was xguldin; in: Harms, Stadthaushalt, Bd. 2,1910,
S. 29.
1. Entstehung der organisierten Nachrichtenübermittlung
Stadt zuständig. Zudem dienten sie den Kaufleuten als Geleiteskorte zu den Mes-
sen. Ihre Zahl schwankte je nach Bedarf zwischen 18 und 24 Dienstleistern. Zudem
unterstanden sie einem Hauptmann, unter dem sie auch Kriegsdienst leisten muss-
ten.19
1.1.3. Basel
Auch in Basel war die Institutionalisierung des Botenwesens, wie die Genese der
Stadtverwaltung überhaupt, von der Machtkonstellation zwischen Rat und Basler
Bischof geprägt. Auch wenn der Rat bereits 1225 ein eigenes Siegel führte, blieben
seine Herrschaftsbefugnisse bis ins 14. Jahrhundert weitgehend vom politischen
Willen des Bischofs abhängig. Erst die zunehmende Finanznot zwang diesen nach
und nach zum Verkauf oder dauerhaften Verpfändung aller bedeutsamen Hoheits-
rechte an den Rat. Seit 1362 zählte sich Basel zu den fryen stetten, 1384 trat es dem
Schwäbischen Städtebund bei.20 Eine wichtige Rolle bei diesem Loslösungsprozess
spielten die Basler Zünfte, was sich nach 1382 auch an der Ratszusammensetzung
zeigte, dem nun neben vier Rittern, acht Patriziern und 15 Zunftratsherren auch die
15 Zunftmeister angehörten. Hier behielt sich der Bischof allerdings bis ins 15. Jahr-
hundert die Bestätigung ihrer Wahl vor.21
Der älteste schriftliche Nachweis für eine differenzierte Stadtverwaltung und
damit auch Personen, die im Namen der Stadt Gesandtschaften verrichteten oder
Nachrichten übermittelten, finden sich vor allem aus der letzten Phase dieser konti-
nuierlichen Ablösung vom Bischof, drei Jahre nach der letzten Auseinandersetzung
mit Herzog Leopold III., die in der bösen Fasnacht eskalierte.221374/75 wurden in den
Basler Stadtrechnungen erstmals die Kosten von zwei Basler Gesandtschaften abge-
rechnet, die beide zum Papst nach Avignon reisten.23 Die ersten Hinweise auf Läu-
fer liefert die Rechnung von 1379. Beim darin genannten Jacob Husin, der vom Bas-
ler Rat die beachtliche Summe von 100 Gulden erhielt, der briefen nndfryheit wegen,
die er uns bracht, dürfte es sich noch um einen auswärtigen Gesandten gehandelt
haben.24 Erst in der Jahresrechnung 1382/83 wird ein Basler Läufer namentlich er-
wähnt. So wurde der Domherr und Zollpächter Heinrich von Hohenstein auf seiner
Gesandtschaftsreise zu König Wenzel von einem löffer namens Heinrich begleitet,
der für seine Dienste zehn Gulden erhielt.25 Der gleiche Läufer, diesmal Henggin
genannt, reiste in derselben Rechnungsperiode auch zweimal allein nach Nürn-
19 Gachot, Louffende Boten, 1964, S. 2, siehe dazu auch Kap. Stadtreiter, Entstehung, Amtsbegriff
und Zuständigkeiten.
20 Zum wechselvollen Verhältnis zwischen Basler Bischof und Basler Rat siehe auch auch: Weber,
Schriftstücke, 2003, S. 355-383, Gilomen, Basel, 1999, Sp. 1506-1515, Möncke, Bischofsstadt
und Reichsstadt, 1971, Türler, Fehde, 1905, S. 177-181, Heusler, Verfassungsgeschichte, 1860.
21 Simon-Muscheid, Basler Handwerkszünfte, 1988, S. 1-12.
22 Gilomen, Basel, 1999, Sp. 1509.
23 Moser, Basler Postwesen, 1971, S. 24-29, 64-70, Basler Stadtrechnung von 1382, in: Harms,
Stadthaushalt, Bd. 2,1910, S. 15.
24 Harms, Stadthaushalt, Bd. 2,1910, S. 24.
25 Item so sint geben heinrich dem löffer, der mit im was xguldin; in: Harms, Stadthaushalt, Bd. 2,1910,
S. 29.