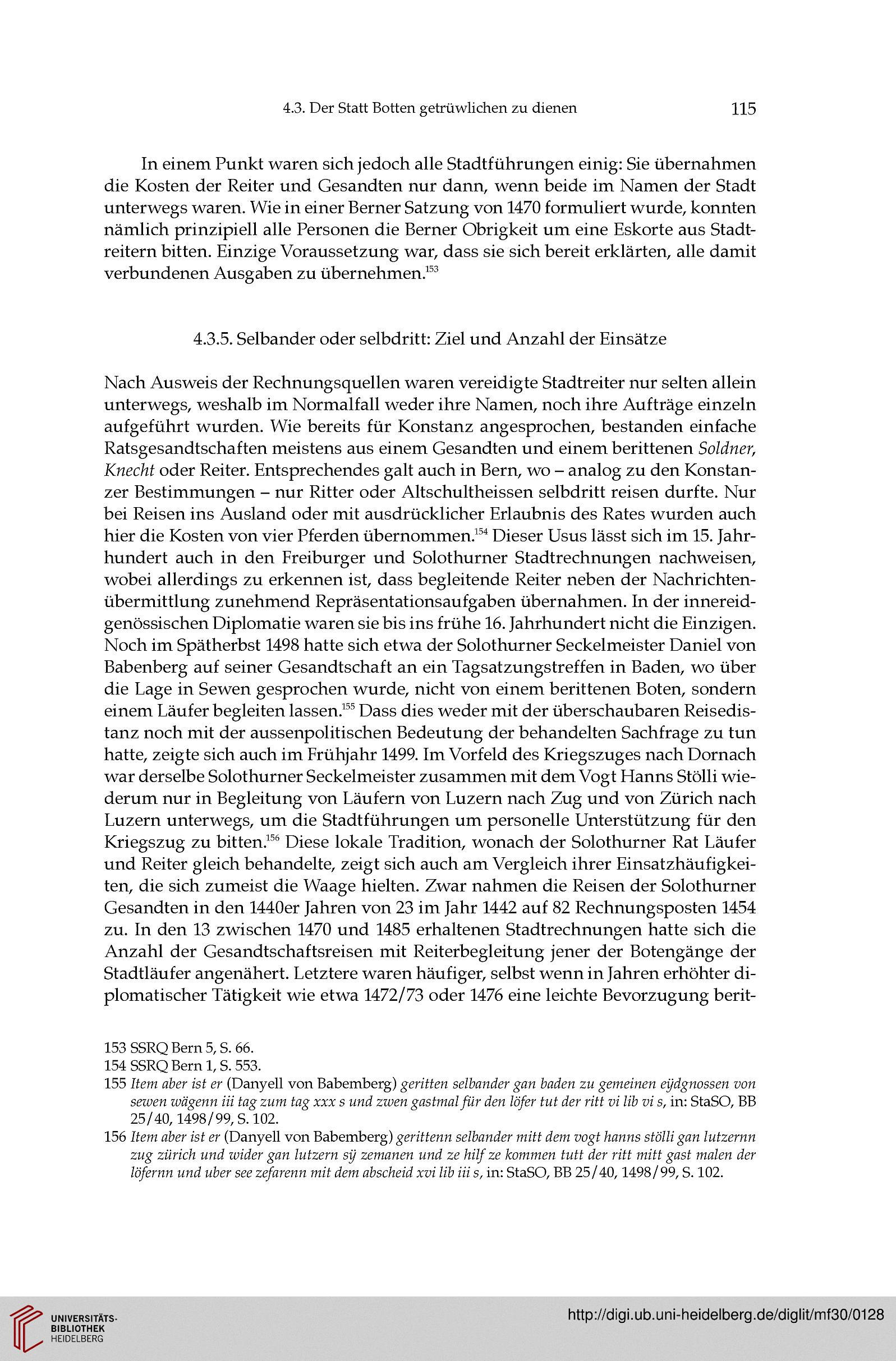4.3. Der Statt Botten getrüwlichen zu dienen
115
In einem Punkt waren sich jedoch alle Stadtführungen einig: Sie übernahmen
die Kosten der Reiter und Gesandten nur dann, wenn beide im Namen der Stadt
unterwegs waren. Wie in einer Berner Satzung von 1470 formuliert wurde, konnten
nämlich prinzipiell alle Personen die Berner Obrigkeit um eine Eskorte aus Stadt-
reitern bitten. Einzige Voraussetzung war, dass sie sich bereit erklärten, alle damit
verbundenen Ausgaben zu übernehmen.153
4.3.5. Selbander oder selbdritt: Ziel und Anzahl der Einsätze
Nach Ausweis der Rechnungsquellen waren vereidigte Stadtreiter nur selten allein
unterwegs, weshalb im Normalfall weder ihre Namen, noch ihre Aufträge einzeln
aufgeführt wurden. Wie bereits für Konstanz angesprochen, bestanden einfache
Ratsgesandtschaften meistens aus einem Gesandten und einem berittenen Soldner,
Knecht oder Reiter. Entsprechendes galt auch in Bern, wo - analog zu den Konstan-
zer Bestimmungen - nur Ritter oder Altschultheissen selbdritt reisen durfte. Nur
bei Reisen ins Ausland oder mit ausdrücklicher Erlaubnis des Rates wurden auch
hier die Kosten von vier Pferden übernommen.154 Dieser Usus lässt sich im 15. Jahr-
hundert auch in den Freiburger und Solothurner Stadtrechnungen nachweisen,
wobei allerdings zu erkennen ist, dass begleitende Reiter neben der Nachrichten-
übermittlung zunehmend Repräsentationsaufgaben übernahmen. In der innereid-
genössischen Diplomatie waren sie bis ins frühe 16. Jahrhundert nicht die Einzigen.
Noch im Spätherbst 1498 hatte sich etwa der Solothurner Seckeimeister Daniel von
Babenberg auf seiner Gesandtschaft an ein Tagsatzungstreffen in Baden, wo über
die Lage in Sewen gesprochen wurde, nicht von einem berittenen Boten, sondern
einem Läufer begleiten lassen.155 Dass dies weder mit der überschaubaren Reisedis-
tanz noch mit der aussenpolitischen Bedeutung der behandelten Sachfrage zu tun
hatte, zeigte sich auch im Frühjahr 1499. Im Vorfeld des Kriegszuges nach Dörnach
war derselbe Solothurner Seckeimeister zusammen mit dem Vogt Hanns Stölli wie-
derum nur in Begleitung von Läufern von Luzern nach Zug und von Zürich nach
Luzern unterwegs, um die Stadtführungen um personelle Unterstützung für den
Kriegszug zu bitten.156 Diese lokale Tradition, wonach der Solothurner Rat Läufer
und Reiter gleich behandelte, zeigt sich auch am Vergleich ihrer Einsatzhäufigkei-
ten, die sich zumeist die Waage hielten. Zwar nahmen die Reisen der Solothurner
Gesandten in den 1440er Jahren von 23 im Jahr 1442 auf 82 Rechnungsposten 1454
zu. In den 13 zwischen 1470 und 1485 erhaltenen Stadtrechnungen hatte sich die
Anzahl der Gesandtschaftsreisen mit Reiterbegleitung jener der Botengänge der
Stadtläufer angenähert. Letztere waren häufiger, selbst wenn in Jahren erhöhter di-
plomatischer Tätigkeit wie etwa 1472/73 oder 1476 eine leichte Bevorzugung berit-
153 SSRQ Bern 5, S. 66.
154 SSRQ Bern 1, S. 553.
155 Item aber ist er (Danyell von Babemberg) geritten selbander gan baden zu gemeinen eydgnossen von
seinen wägenn iii tag zum tag xxx s und zwen gastmal für den löfer tut der ritt vi lib vi s, in: StaSO, BB
25/40,1498/99, S. 102.
156 Item aber ist er (Danyell von Babemberg) gerittenn selbander mitt dem vogt hanns stölli gan lutzernn
zug Zürich und wider gan lutzern sy zemanen und ze hilf ze kommen tutt der ritt mitt gast malen der
löfernn und über see zefarenn mit dem abscheid xvi lib iii s, in: StaSO, BB 25/40,1498/99, S. 102.
115
In einem Punkt waren sich jedoch alle Stadtführungen einig: Sie übernahmen
die Kosten der Reiter und Gesandten nur dann, wenn beide im Namen der Stadt
unterwegs waren. Wie in einer Berner Satzung von 1470 formuliert wurde, konnten
nämlich prinzipiell alle Personen die Berner Obrigkeit um eine Eskorte aus Stadt-
reitern bitten. Einzige Voraussetzung war, dass sie sich bereit erklärten, alle damit
verbundenen Ausgaben zu übernehmen.153
4.3.5. Selbander oder selbdritt: Ziel und Anzahl der Einsätze
Nach Ausweis der Rechnungsquellen waren vereidigte Stadtreiter nur selten allein
unterwegs, weshalb im Normalfall weder ihre Namen, noch ihre Aufträge einzeln
aufgeführt wurden. Wie bereits für Konstanz angesprochen, bestanden einfache
Ratsgesandtschaften meistens aus einem Gesandten und einem berittenen Soldner,
Knecht oder Reiter. Entsprechendes galt auch in Bern, wo - analog zu den Konstan-
zer Bestimmungen - nur Ritter oder Altschultheissen selbdritt reisen durfte. Nur
bei Reisen ins Ausland oder mit ausdrücklicher Erlaubnis des Rates wurden auch
hier die Kosten von vier Pferden übernommen.154 Dieser Usus lässt sich im 15. Jahr-
hundert auch in den Freiburger und Solothurner Stadtrechnungen nachweisen,
wobei allerdings zu erkennen ist, dass begleitende Reiter neben der Nachrichten-
übermittlung zunehmend Repräsentationsaufgaben übernahmen. In der innereid-
genössischen Diplomatie waren sie bis ins frühe 16. Jahrhundert nicht die Einzigen.
Noch im Spätherbst 1498 hatte sich etwa der Solothurner Seckeimeister Daniel von
Babenberg auf seiner Gesandtschaft an ein Tagsatzungstreffen in Baden, wo über
die Lage in Sewen gesprochen wurde, nicht von einem berittenen Boten, sondern
einem Läufer begleiten lassen.155 Dass dies weder mit der überschaubaren Reisedis-
tanz noch mit der aussenpolitischen Bedeutung der behandelten Sachfrage zu tun
hatte, zeigte sich auch im Frühjahr 1499. Im Vorfeld des Kriegszuges nach Dörnach
war derselbe Solothurner Seckeimeister zusammen mit dem Vogt Hanns Stölli wie-
derum nur in Begleitung von Läufern von Luzern nach Zug und von Zürich nach
Luzern unterwegs, um die Stadtführungen um personelle Unterstützung für den
Kriegszug zu bitten.156 Diese lokale Tradition, wonach der Solothurner Rat Läufer
und Reiter gleich behandelte, zeigt sich auch am Vergleich ihrer Einsatzhäufigkei-
ten, die sich zumeist die Waage hielten. Zwar nahmen die Reisen der Solothurner
Gesandten in den 1440er Jahren von 23 im Jahr 1442 auf 82 Rechnungsposten 1454
zu. In den 13 zwischen 1470 und 1485 erhaltenen Stadtrechnungen hatte sich die
Anzahl der Gesandtschaftsreisen mit Reiterbegleitung jener der Botengänge der
Stadtläufer angenähert. Letztere waren häufiger, selbst wenn in Jahren erhöhter di-
plomatischer Tätigkeit wie etwa 1472/73 oder 1476 eine leichte Bevorzugung berit-
153 SSRQ Bern 5, S. 66.
154 SSRQ Bern 1, S. 553.
155 Item aber ist er (Danyell von Babemberg) geritten selbander gan baden zu gemeinen eydgnossen von
seinen wägenn iii tag zum tag xxx s und zwen gastmal für den löfer tut der ritt vi lib vi s, in: StaSO, BB
25/40,1498/99, S. 102.
156 Item aber ist er (Danyell von Babemberg) gerittenn selbander mitt dem vogt hanns stölli gan lutzernn
zug Zürich und wider gan lutzern sy zemanen und ze hilf ze kommen tutt der ritt mitt gast malen der
löfernn und über see zefarenn mit dem abscheid xvi lib iii s, in: StaSO, BB 25/40,1498/99, S. 102.