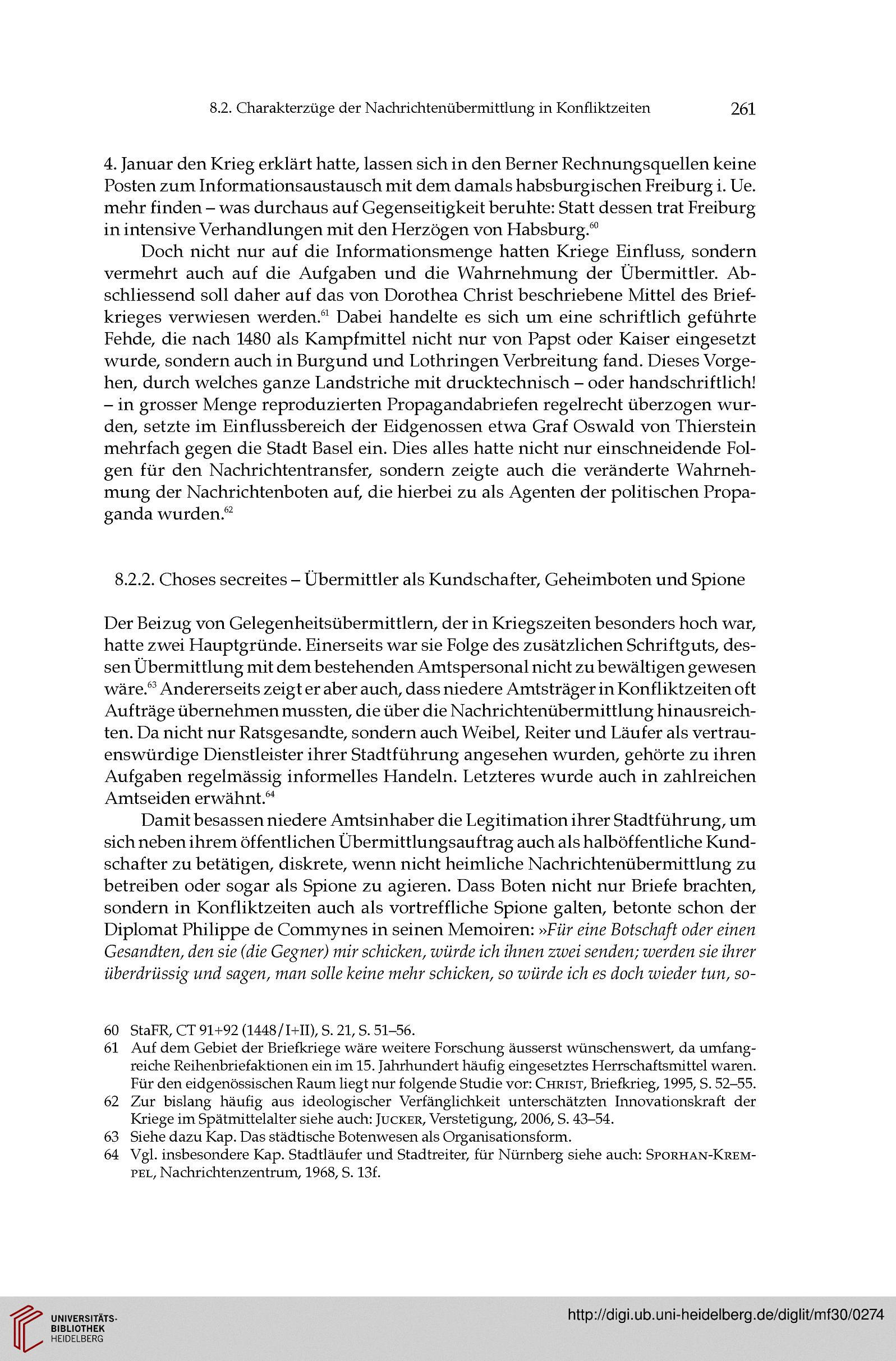8.2. Charakterzüge der Nachrichtenübermittlung in Konfliktzeiten
261
4. Januar den Krieg erklärt hatte, lassen sich in den Berner Rechnungsquellen keine
Posten zum Informationsaustausch mit dem damals habsburgischen Freiburg i. Ue.
mehr finden - was durchaus auf Gegenseitigkeit beruhte: Statt dessen trat Freiburg
in intensive Verhandlungen mit den Herzogen von Habsburg.60
Doch nicht nur auf die Informationsmenge hatten Kriege Einfluss, sondern
vermehrt auch auf die Aufgaben und die Wahrnehmung der Übermittler. Ab-
schliessend soll daher auf das von Dorothea Christ beschriebene Mittel des Brief-
krieges verwiesen werden.61 Dabei handelte es sich um eine schriftlich geführte
Fehde, die nach 1480 als Kampfmittel nicht nur von Papst oder Kaiser eingesetzt
wurde, sondern auch in Burgund und Lothringen Verbreitung fand. Dieses Vorge-
hen, durch welches ganze Landstriche mit drucktechnisch - oder handschriftlich!
- in grosser Menge reproduzierten Propagandabriefen regelrecht überzogen wur-
den, setzte im Einflussbereich der Eidgenossen etwa Graf Oswald von Thierstein
mehrfach gegen die Stadt Basel ein. Dies alles hatte nicht nur einschneidende Fol-
gen für den Nachrichtentransfer, sondern zeigte auch die veränderte Wahrneh-
mung der Nachrichtenboten auf, die hierbei zu als Agenten der politischen Propa-
ganda wurden.62
8.2.2. Choses secreites - Übermittler als Kundschafter, Geheimboten und Spione
Der Beizug von Gelegenheitsübermittlern, der in Kriegszeiten besonders hoch war,
hatte zwei Hauptgründe. Einerseits war sie Folge des zusätzlichen Schriftguts, des-
sen Übermittlung mit dem bestehenden Amtspersonal nicht zu bewältigen gewesen
wäre.63 Andererseits zeigt er aber auch, dass niedere Amtsträger in Konfliktzeiten oft
Aufträge übernehmen mussten, die über die Nachrichtenübermittlung hinausreich-
ten. Da nicht nur Ratsgesandte, sondern auch Weibel, Reiter und Läufer als vertrau-
enswürdige Dienstleister ihrer Stadtführung angesehen wurden, gehörte zu ihren
Aufgaben regelmässig informelles Handeln. Letzteres wurde auch in zahlreichen
Amtseiden erwähnt.64
Damit besassen niedere Amtsinhaber die Legitimation ihrer Stadtführung, um
sich neben ihrem öffentlichen Übermittlungsauftrag auch als halböffentliche Kund-
schafter zu betätigen, diskrete, wenn nicht heimliche Nachrichtenübermittlung zu
betreiben oder sogar als Spione zu agieren. Dass Boten nicht nur Briefe brachten,
sondern in Konfliktzeiten auch als vortreffliche Spione galten, betonte schon der
Diplomat Philippe de Commynes in seinen Memoiren: »Für eine Botschaft oder einen
Gesandten, den sie (die Gegner) mir schicken, würde ich ihnen zwei senden; werden sie ihrer
überdrüssig und sagen, man solle keine mehr schicken, so würde ich es doch wieder tun, so-
60 StaFR, CT 91+92 (1448/I+II), S. 21, S. 51-56.
61 Auf dem Gebiet der Briefkriege wäre weitere Forschung äusserst wünschenswert, da umfang-
reiche Reihenbriefaktionen ein im 15. Jahrhundert häufig eingesetztes Herrschaftsmittel waren.
Für den eidgenössischen Raum liegt nur folgende Studie vor: Christ, Briefkrieg, 1995, S. 52-55.
62 Zur bislang häufig aus ideologischer Verfänglichkeit unterschätzten Innovationskraft der
Kriege im Spätmittelalter siehe auch: Jucker, Verstetigung, 2006, S. 43-54.
63 Siehe dazu Kap. Das städtische Botenwesen als Organisationsform.
64 Vgl. insbesondere Kap. Stadtläufer und Stadtreiter, für Nürnberg siehe auch: Sporhan-Krem-
pel, Nachrichtenzentrum, 1968, S. 13f.
261
4. Januar den Krieg erklärt hatte, lassen sich in den Berner Rechnungsquellen keine
Posten zum Informationsaustausch mit dem damals habsburgischen Freiburg i. Ue.
mehr finden - was durchaus auf Gegenseitigkeit beruhte: Statt dessen trat Freiburg
in intensive Verhandlungen mit den Herzogen von Habsburg.60
Doch nicht nur auf die Informationsmenge hatten Kriege Einfluss, sondern
vermehrt auch auf die Aufgaben und die Wahrnehmung der Übermittler. Ab-
schliessend soll daher auf das von Dorothea Christ beschriebene Mittel des Brief-
krieges verwiesen werden.61 Dabei handelte es sich um eine schriftlich geführte
Fehde, die nach 1480 als Kampfmittel nicht nur von Papst oder Kaiser eingesetzt
wurde, sondern auch in Burgund und Lothringen Verbreitung fand. Dieses Vorge-
hen, durch welches ganze Landstriche mit drucktechnisch - oder handschriftlich!
- in grosser Menge reproduzierten Propagandabriefen regelrecht überzogen wur-
den, setzte im Einflussbereich der Eidgenossen etwa Graf Oswald von Thierstein
mehrfach gegen die Stadt Basel ein. Dies alles hatte nicht nur einschneidende Fol-
gen für den Nachrichtentransfer, sondern zeigte auch die veränderte Wahrneh-
mung der Nachrichtenboten auf, die hierbei zu als Agenten der politischen Propa-
ganda wurden.62
8.2.2. Choses secreites - Übermittler als Kundschafter, Geheimboten und Spione
Der Beizug von Gelegenheitsübermittlern, der in Kriegszeiten besonders hoch war,
hatte zwei Hauptgründe. Einerseits war sie Folge des zusätzlichen Schriftguts, des-
sen Übermittlung mit dem bestehenden Amtspersonal nicht zu bewältigen gewesen
wäre.63 Andererseits zeigt er aber auch, dass niedere Amtsträger in Konfliktzeiten oft
Aufträge übernehmen mussten, die über die Nachrichtenübermittlung hinausreich-
ten. Da nicht nur Ratsgesandte, sondern auch Weibel, Reiter und Läufer als vertrau-
enswürdige Dienstleister ihrer Stadtführung angesehen wurden, gehörte zu ihren
Aufgaben regelmässig informelles Handeln. Letzteres wurde auch in zahlreichen
Amtseiden erwähnt.64
Damit besassen niedere Amtsinhaber die Legitimation ihrer Stadtführung, um
sich neben ihrem öffentlichen Übermittlungsauftrag auch als halböffentliche Kund-
schafter zu betätigen, diskrete, wenn nicht heimliche Nachrichtenübermittlung zu
betreiben oder sogar als Spione zu agieren. Dass Boten nicht nur Briefe brachten,
sondern in Konfliktzeiten auch als vortreffliche Spione galten, betonte schon der
Diplomat Philippe de Commynes in seinen Memoiren: »Für eine Botschaft oder einen
Gesandten, den sie (die Gegner) mir schicken, würde ich ihnen zwei senden; werden sie ihrer
überdrüssig und sagen, man solle keine mehr schicken, so würde ich es doch wieder tun, so-
60 StaFR, CT 91+92 (1448/I+II), S. 21, S. 51-56.
61 Auf dem Gebiet der Briefkriege wäre weitere Forschung äusserst wünschenswert, da umfang-
reiche Reihenbriefaktionen ein im 15. Jahrhundert häufig eingesetztes Herrschaftsmittel waren.
Für den eidgenössischen Raum liegt nur folgende Studie vor: Christ, Briefkrieg, 1995, S. 52-55.
62 Zur bislang häufig aus ideologischer Verfänglichkeit unterschätzten Innovationskraft der
Kriege im Spätmittelalter siehe auch: Jucker, Verstetigung, 2006, S. 43-54.
63 Siehe dazu Kap. Das städtische Botenwesen als Organisationsform.
64 Vgl. insbesondere Kap. Stadtläufer und Stadtreiter, für Nürnberg siehe auch: Sporhan-Krem-
pel, Nachrichtenzentrum, 1968, S. 13f.