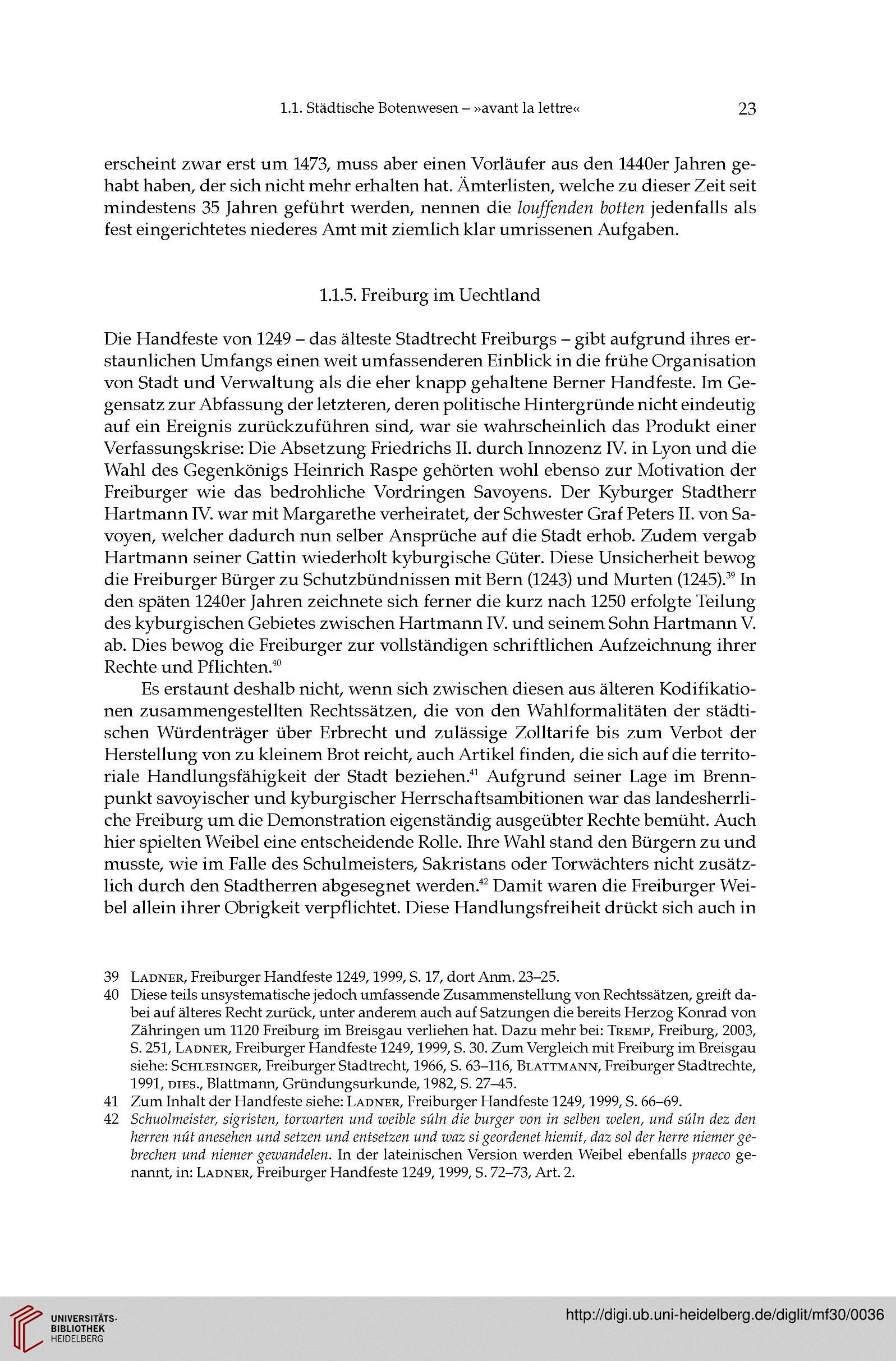1.1. Städtische Botenwesen - »avant la lettre^
23
erscheint zwar erst um 1473, muss aber einen Vorläufer aus den 1440er Jahren ge-
habt haben, der sich nicht mehr erhalten hat. Ämterlisten, welche zu dieser Zeit seit
mindestens 35 Jahren geführt werden, nennen die louffenden hotten jedenfalls als
fest eingerichtetes niederes Amt mit ziemlich klar umrissenen Aufgaben.
1.1.5. Freiburg im Uechtland
Die Handfeste von 1249 - das älteste Stadtrecht Freiburgs - gibt aufgrund ihres er-
staunlichen Umfangs einen weit umfassenderen Einblick in die frühe Organisation
von Stadt und Verwaltung als die eher knapp gehaltene Berner Handfeste. Im Ge-
gensatz zur Abfassung der letzteren, deren politische Hintergründe nicht eindeutig
auf ein Ereignis zurückzuführen sind, war sie wahrscheinlich das Produkt einer
Verfassungskrise: Die Absetzung Friedrichs II. durch Innozenz IV. in Lyon und die
Wahl des Gegenkönigs Heinrich Raspe gehörten wohl ebenso zur Motivation der
Freiburger wie das bedrohliche Vordringen Savoyens. Der Kyburger Stadtherr
Hartmann IV. war mit Margarethe verheiratet, der Schwester Graf Peters II. von Sa-
voyen, welcher dadurch nun selber Ansprüche auf die Stadt erhob. Zudem vergab
Hartmann seiner Gattin wiederholt kyburgische Güter. Diese Unsicherheit bewog
die Freiburger Bürger zu Schutzbündnissen mit Bern (1243) und Murten (1245).39 In
den späten 1240er Jahren zeichnete sich ferner die kurz nach 1250 erfolgte Teilung
des kyburgischen Gebietes zwischen Hartmann IV. und seinem Sohn Hartmann V.
ab. Dies bewog die Freiburger zur vollständigen schriftlichen Aufzeichnung ihrer
Rechte und Pflichten.40
Es erstaunt deshalb nicht, wenn sich zwischen diesen aus älteren Kodifikatio-
nen zusammengestellten Rechtssätzen, die von den Wahlformalitäten der städti-
schen Würdenträger über Erbrecht und zulässige Zolltarife bis zum Verbot der
Herstellung von zu kleinem Brot reicht, auch Artikel finden, die sich auf die territo-
riale Handlungsfähigkeit der Stadt beziehen.41 Aufgrund seiner Lage im Brenn-
punkt savoyischer und kyburgischer Herrschaftsambitionen war das landesherrli-
che Freiburg um die Demonstration eigenständig ausgeübter Rechte bemüht. Auch
hier spielten Weibel eine entscheidende Rolle. Ihre Wahl stand den Bürgern zu und
musste, wie im Falle des Schulmeisters, Sakristans oder Torwächters nicht zusätz-
lich durch den Stadtherren abgesegnet werden.42 Damit waren die Freiburger Wei-
bel allein ihrer Obrigkeit verpflichtet. Diese Handlungsfreiheit drückt sich auch in
39 Ladner, Freiburger Handfeste 1249,1999, S. 17, dort Anm. 23-25.
40 Diese teils unsystematische jedoch umfassende Zusammenstellung von Rechtssätzen, greift da-
bei auf älteres Recht zurück, unter anderem auch auf Satzungen die bereits Herzog Konrad von
Zähringen um 1120 Freiburg im Breisgau verliehen hat. Dazu mehr bei: Tremp, Freiburg, 2003,
S. 251, Ladner, Freiburger Handfeste 1249,1999, S. 30. Zum Vergleich mit Freiburg im Breisgau
siehe: Schlesinger, Freiburger Stadtrecht, 1966, S. 63-116, Blattmann, Freiburger Stadtrechte,
1991, dies., Blattmann, Gründungsurkunde, 1982, S. 27-45.
41 Zum Inhalt der Handfeste siehe: Ladner, Freiburger Handfeste 1249,1999, S. 66-69.
42 Schuolmeister, sigristen, torwarten und weible süln die burger von in selben welen, und süln dez den
Herren nüt anesehen und setzen und entsetzen und waz si geordenet hiemit, daz sol der herre niemer ge-
brechen und niemer gewandelen. In der lateinischen Version werden Weibel ebenfalls praeco ge-
nannt, in: Ladner, Freiburger Handfeste 1249,1999, S. 72-73, Art. 2.
23
erscheint zwar erst um 1473, muss aber einen Vorläufer aus den 1440er Jahren ge-
habt haben, der sich nicht mehr erhalten hat. Ämterlisten, welche zu dieser Zeit seit
mindestens 35 Jahren geführt werden, nennen die louffenden hotten jedenfalls als
fest eingerichtetes niederes Amt mit ziemlich klar umrissenen Aufgaben.
1.1.5. Freiburg im Uechtland
Die Handfeste von 1249 - das älteste Stadtrecht Freiburgs - gibt aufgrund ihres er-
staunlichen Umfangs einen weit umfassenderen Einblick in die frühe Organisation
von Stadt und Verwaltung als die eher knapp gehaltene Berner Handfeste. Im Ge-
gensatz zur Abfassung der letzteren, deren politische Hintergründe nicht eindeutig
auf ein Ereignis zurückzuführen sind, war sie wahrscheinlich das Produkt einer
Verfassungskrise: Die Absetzung Friedrichs II. durch Innozenz IV. in Lyon und die
Wahl des Gegenkönigs Heinrich Raspe gehörten wohl ebenso zur Motivation der
Freiburger wie das bedrohliche Vordringen Savoyens. Der Kyburger Stadtherr
Hartmann IV. war mit Margarethe verheiratet, der Schwester Graf Peters II. von Sa-
voyen, welcher dadurch nun selber Ansprüche auf die Stadt erhob. Zudem vergab
Hartmann seiner Gattin wiederholt kyburgische Güter. Diese Unsicherheit bewog
die Freiburger Bürger zu Schutzbündnissen mit Bern (1243) und Murten (1245).39 In
den späten 1240er Jahren zeichnete sich ferner die kurz nach 1250 erfolgte Teilung
des kyburgischen Gebietes zwischen Hartmann IV. und seinem Sohn Hartmann V.
ab. Dies bewog die Freiburger zur vollständigen schriftlichen Aufzeichnung ihrer
Rechte und Pflichten.40
Es erstaunt deshalb nicht, wenn sich zwischen diesen aus älteren Kodifikatio-
nen zusammengestellten Rechtssätzen, die von den Wahlformalitäten der städti-
schen Würdenträger über Erbrecht und zulässige Zolltarife bis zum Verbot der
Herstellung von zu kleinem Brot reicht, auch Artikel finden, die sich auf die territo-
riale Handlungsfähigkeit der Stadt beziehen.41 Aufgrund seiner Lage im Brenn-
punkt savoyischer und kyburgischer Herrschaftsambitionen war das landesherrli-
che Freiburg um die Demonstration eigenständig ausgeübter Rechte bemüht. Auch
hier spielten Weibel eine entscheidende Rolle. Ihre Wahl stand den Bürgern zu und
musste, wie im Falle des Schulmeisters, Sakristans oder Torwächters nicht zusätz-
lich durch den Stadtherren abgesegnet werden.42 Damit waren die Freiburger Wei-
bel allein ihrer Obrigkeit verpflichtet. Diese Handlungsfreiheit drückt sich auch in
39 Ladner, Freiburger Handfeste 1249,1999, S. 17, dort Anm. 23-25.
40 Diese teils unsystematische jedoch umfassende Zusammenstellung von Rechtssätzen, greift da-
bei auf älteres Recht zurück, unter anderem auch auf Satzungen die bereits Herzog Konrad von
Zähringen um 1120 Freiburg im Breisgau verliehen hat. Dazu mehr bei: Tremp, Freiburg, 2003,
S. 251, Ladner, Freiburger Handfeste 1249,1999, S. 30. Zum Vergleich mit Freiburg im Breisgau
siehe: Schlesinger, Freiburger Stadtrecht, 1966, S. 63-116, Blattmann, Freiburger Stadtrechte,
1991, dies., Blattmann, Gründungsurkunde, 1982, S. 27-45.
41 Zum Inhalt der Handfeste siehe: Ladner, Freiburger Handfeste 1249,1999, S. 66-69.
42 Schuolmeister, sigristen, torwarten und weible süln die burger von in selben welen, und süln dez den
Herren nüt anesehen und setzen und entsetzen und waz si geordenet hiemit, daz sol der herre niemer ge-
brechen und niemer gewandelen. In der lateinischen Version werden Weibel ebenfalls praeco ge-
nannt, in: Ladner, Freiburger Handfeste 1249,1999, S. 72-73, Art. 2.