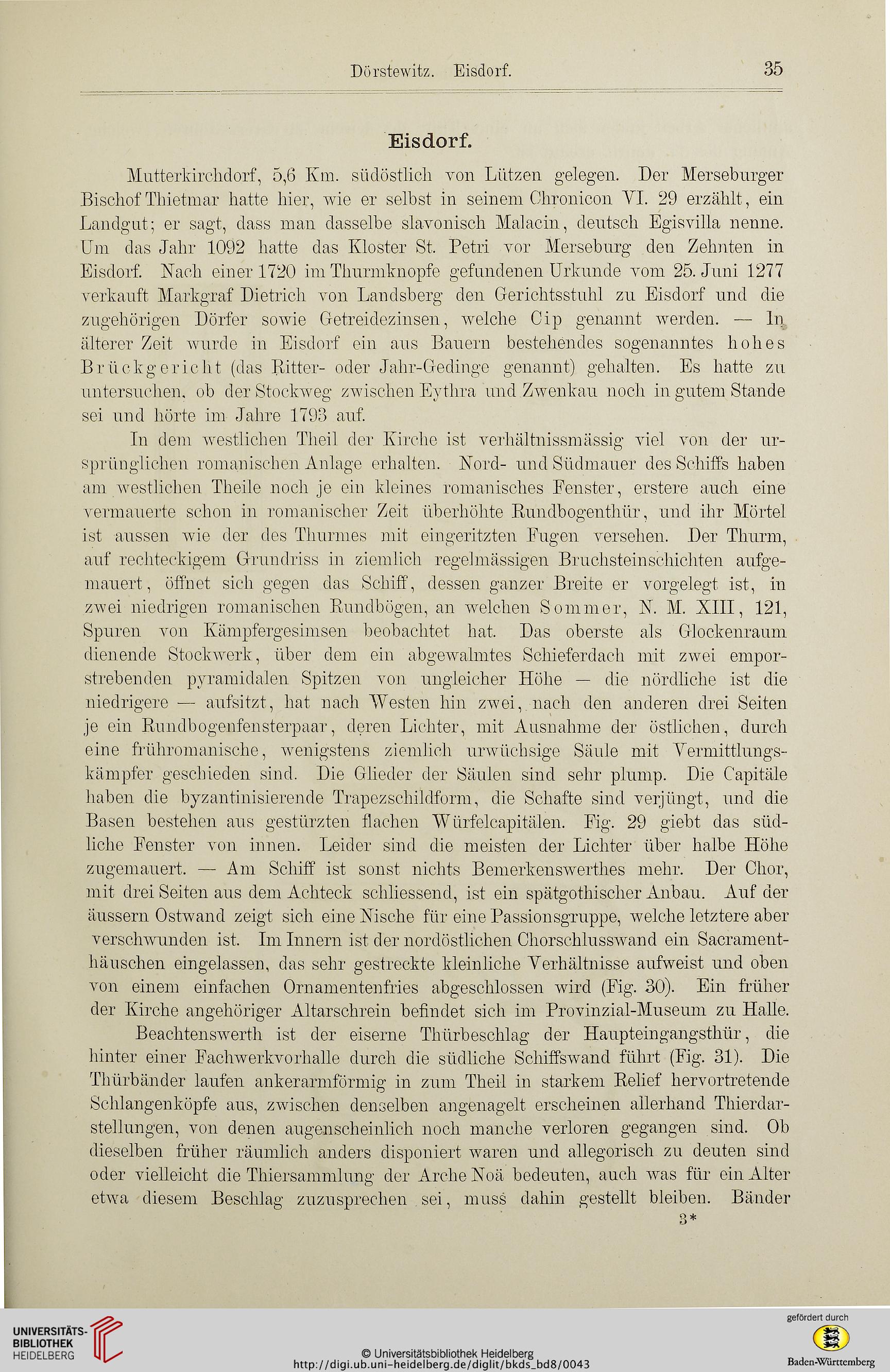Dörstewitz. Eisdorf.
35
Eisdorf.
Mutterkirchdorf, 5,6 Km. südöstlich von Lützen gelegen. Der Merseburger
Bischof Thietmar hatte hier, wie er selbst in seinem Chronicon VI. 29 erzählt, ein
Landgut; er sagt, dass mau dasselbe slavonisch Malacin, deutsch Egisvilla nenne.
Um das Jahr 1092 hatte das Kloster St. Petri vor Merseburg den Zehnten in
Eisdorf. Nach einer 1720 im Thurmknopfe gefundenen Urkunde vom 25. Juni 1277
verkauft Markgraf Dietrich von Landsberg den Gerichtsstuhl zu Eisdorf und die
zugehörigen Dörfer sowie Getreidezinsen, welche Cip genannt werden. — ln
älterer Zeit wurde in Eisdorf ein aus Bauern bestehendes sogenanntes hohes
Brückgericht (das Ritter- oder Jahr-Gedinge genannt) gehalten. Es hatte zu
untersuchen, ob der Stockweg zwischen Eythra und Zwenkau noch in gutem Stande
sei und hörte im Jahre 1793 auf.
In dem westlichen Theil der Kirche ist verhältnissmässig viel von der ur-
sprünglichen romanischen Anlage erhalten. Nord- und Südmauer des Schiffs haben
am westlichen Theile noch je ein kleines romanisches Fenster, erstere auch eine
vermauerte schon in romanischer Zeit überhöhte Rundbogenthür, und ihr Mörtel
ist aussen wie der des Thurnies mit eingeritzten Fugen versehen. Der Thurm,
auf rechteckigem Grundriss in ziemlich regelmässigen Bruchsteinschichten aufge-
mauert, öffnet sich gegen das Schiff, dessen ganzer Breite er vorgelegt ist, in
zwei niedrigen romanischen Rundbögen, an welchen Sommer, N. M. XIII, 121,
Spuren von Kämpfergesimsen beobachtet hat. Das oberste als Glockenraum
dienende Stockwerk, über dem ein abgewalmtes Schieferdach mit zwei empor-
strebenden pyramidalen Spitzen von ungleicher Höhe — die nördliche ist die
niedrigere — aufsitzt, hat nach Westen hin zwei, nach den anderen drei Seiten
je ein Rundbogenfensterpaar, deren Lichter, mit Ausnahme der östlichen, durch
eine frühromanische, wenigstens ziemlich urwüchsige Säule mit Vermittlungs-
kämpfer geschieden sind. Die Glieder der Säulen sind sehr plump. Die Capitäle
haben die byzantinisierende Trapezschildform, die Schafte sind verjüngt, und die
Basen bestehen aus gestürzten flachen W ürfelcapitälen. Fig. 29 giebt das süd-
liche Fenster von innen. Leider sind die meisten der Lichter über halbe Höhe
zugemauert. — Am Schiff ist sonst nichts Bemerkenswerthes mehr. Der Chor,
mit drei Seiten aus dem Achteck schliessend, ist ein spätgothischer Anbau. Auf der
äussern Ostwand zeigt sich eine Nische für eine Passionsgruppe, welche letztere aber
verschwunden ist. Im Innern ist der nordöstlichen Chorschlusswand ein Sacrament-
häuschen eingelassen, das sehr gestreckte kleinliche Verhältnisse aufweist und oben
von einem einfachen Ornamentenfries abgeschlossen wird (Fig. 30). Ein früher
der Kirche angehöriger Altarschrein befindet sich im Provinzial-Museum zu Halle.
Beachtenswerth ist der eiserne Thürbeschlag der Haupteingangsthür, die
hinter einer Fachwerkvorhalle durch die südliche Schiffswand führt (Fig. 31). Die
Thürbänder laufen ankerarmförmig in zum Theil in starkem Relief hervortretende
Schlangenköpfe aus, zwischen denselben angenagelt erscheinen allerhand Thierdar-
stellungen, von denen augenscheinlich noch manche verloren gegangen sind. Ob
dieselben früher räumlich anders disponiert waren und allegorisch zu deuten sind
oder vielleicht die Thiersammlung der Arche Noä bedeuten, auch was für ein Alter
etwa diesem Beschlag zuzusprechen sei, muss dahin gestellt bleiben. Bänder
35
Eisdorf.
Mutterkirchdorf, 5,6 Km. südöstlich von Lützen gelegen. Der Merseburger
Bischof Thietmar hatte hier, wie er selbst in seinem Chronicon VI. 29 erzählt, ein
Landgut; er sagt, dass mau dasselbe slavonisch Malacin, deutsch Egisvilla nenne.
Um das Jahr 1092 hatte das Kloster St. Petri vor Merseburg den Zehnten in
Eisdorf. Nach einer 1720 im Thurmknopfe gefundenen Urkunde vom 25. Juni 1277
verkauft Markgraf Dietrich von Landsberg den Gerichtsstuhl zu Eisdorf und die
zugehörigen Dörfer sowie Getreidezinsen, welche Cip genannt werden. — ln
älterer Zeit wurde in Eisdorf ein aus Bauern bestehendes sogenanntes hohes
Brückgericht (das Ritter- oder Jahr-Gedinge genannt) gehalten. Es hatte zu
untersuchen, ob der Stockweg zwischen Eythra und Zwenkau noch in gutem Stande
sei und hörte im Jahre 1793 auf.
In dem westlichen Theil der Kirche ist verhältnissmässig viel von der ur-
sprünglichen romanischen Anlage erhalten. Nord- und Südmauer des Schiffs haben
am westlichen Theile noch je ein kleines romanisches Fenster, erstere auch eine
vermauerte schon in romanischer Zeit überhöhte Rundbogenthür, und ihr Mörtel
ist aussen wie der des Thurnies mit eingeritzten Fugen versehen. Der Thurm,
auf rechteckigem Grundriss in ziemlich regelmässigen Bruchsteinschichten aufge-
mauert, öffnet sich gegen das Schiff, dessen ganzer Breite er vorgelegt ist, in
zwei niedrigen romanischen Rundbögen, an welchen Sommer, N. M. XIII, 121,
Spuren von Kämpfergesimsen beobachtet hat. Das oberste als Glockenraum
dienende Stockwerk, über dem ein abgewalmtes Schieferdach mit zwei empor-
strebenden pyramidalen Spitzen von ungleicher Höhe — die nördliche ist die
niedrigere — aufsitzt, hat nach Westen hin zwei, nach den anderen drei Seiten
je ein Rundbogenfensterpaar, deren Lichter, mit Ausnahme der östlichen, durch
eine frühromanische, wenigstens ziemlich urwüchsige Säule mit Vermittlungs-
kämpfer geschieden sind. Die Glieder der Säulen sind sehr plump. Die Capitäle
haben die byzantinisierende Trapezschildform, die Schafte sind verjüngt, und die
Basen bestehen aus gestürzten flachen W ürfelcapitälen. Fig. 29 giebt das süd-
liche Fenster von innen. Leider sind die meisten der Lichter über halbe Höhe
zugemauert. — Am Schiff ist sonst nichts Bemerkenswerthes mehr. Der Chor,
mit drei Seiten aus dem Achteck schliessend, ist ein spätgothischer Anbau. Auf der
äussern Ostwand zeigt sich eine Nische für eine Passionsgruppe, welche letztere aber
verschwunden ist. Im Innern ist der nordöstlichen Chorschlusswand ein Sacrament-
häuschen eingelassen, das sehr gestreckte kleinliche Verhältnisse aufweist und oben
von einem einfachen Ornamentenfries abgeschlossen wird (Fig. 30). Ein früher
der Kirche angehöriger Altarschrein befindet sich im Provinzial-Museum zu Halle.
Beachtenswerth ist der eiserne Thürbeschlag der Haupteingangsthür, die
hinter einer Fachwerkvorhalle durch die südliche Schiffswand führt (Fig. 31). Die
Thürbänder laufen ankerarmförmig in zum Theil in starkem Relief hervortretende
Schlangenköpfe aus, zwischen denselben angenagelt erscheinen allerhand Thierdar-
stellungen, von denen augenscheinlich noch manche verloren gegangen sind. Ob
dieselben früher räumlich anders disponiert waren und allegorisch zu deuten sind
oder vielleicht die Thiersammlung der Arche Noä bedeuten, auch was für ein Alter
etwa diesem Beschlag zuzusprechen sei, muss dahin gestellt bleiben. Bänder