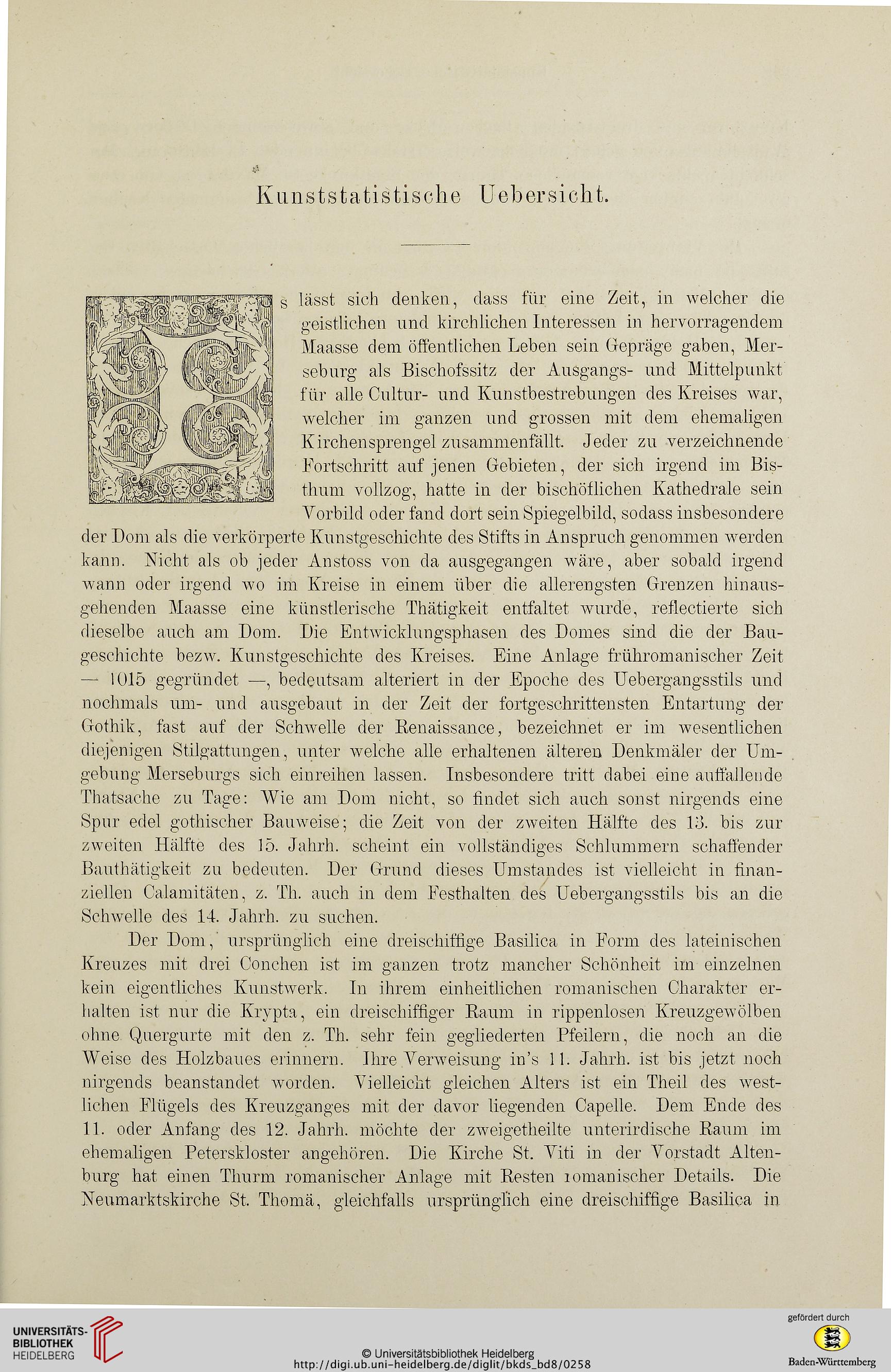Kunststatistische Uebersicht.
s lässt sich denken, dass für eine Zeit, in welcher die
geistlichen und kirchlichen Interessen in hervorragendem
Maasse dem öffentlichen Leben sein Gepräge gaben, Mer-
seburg als Bischofssitz der Ausgangs- und Mittelpunkt
für alle Cultur- und Kunstbestrebungen des Kreises war,
welcher im ganzen und grossen mit dem ehemaligen
Kirchensprengel zusammenfällt. Jeder zu verzeichnende
Fortschritt auf jenen Gebieten, der sich irgend im Bis-
thum vollzog, hatte in der bischöflichen Kathedrale sein
Vorbild oder fand dort sein Spiegelbild, sodass insbesondere
der Dom als die verkörperte Kunstgeschichte des Stifts in Anspruch genommen werden
kann. Nicht als ob jeder Anstoss von da ausgegangen wäre, aber sobald irgend
wann oder irgend wo im Kreise in einem über die allerengsten Grenzen hinaus-
gehenden Maasse eine künstlerische Thätigkeit entfaltet wurde, reflectierte sich
dieselbe auch am Dom. Die Entwicklungsphasen des Domes sind die der Bau-
geschichte bezw. Kunstgeschichte des Kreises. Eine Anlage frühromanischer Zeit
— 1015 gegründet —, bedeutsam alteriert in der Epoche des Uebergangsstils und
nochmals um- und ausgebaut in der Zeit der fortgeschrittensten Entartung der
Gothik, fast auf der Schwelle der Renaissance, bezeichnet er im wesentlichen
diejenigen Stilgattungen, unter welche alle erhaltenen älteren Denkmäler der Um-
gebung Merseburgs sich einreihen lassen. Insbesondere tritt dabei eine auffallende
Tbatsache zu Tage: Wie am Dom nicht, so findet sich auch sonst nirgends eine
Spur edel gothischer Bauweise; die Zeit von der zweiten Hälfte des 13. bis zur
zweiten Hälfte des 15. Jahrh. scheint ein vollständiges Schlummern schaffender
Bauthätigkeit zu bedeuten. Der Grund dieses Umstandes ist vielleicht in finan-
ziellen Calamitäten, z. Th. auch in dem Festhalten des Uebergangsstils bis an die
Schwelle des 14. Jahrh. zu suchen.
Der Dom, ursprünglich eine dreischiffige Basilica in Form des lateinischen
Kreuzes mit drei Conchen ist im ganzen trotz mancher Schönheit im einzelnen
kein eigentliches Kunstwerk. In ihrem einheitlichen romanischen Charakter er-
halten ist nur die Krypta, ein dreischiffiger Raum in rippenlosen Kreuzgewölben
ohne Quergnrte mit den z. Th. sehr fein gegliederten Pfeilern, die noch an die
Weise des Holzbaues erinnern. Ihre Verweisung in’s 11. Jahrh. ist bis jetzt noch
nirgends beanstandet worden. Vielleicht gleichen Alters ist ein Theil des west-
lichen Flügels des Kreuzganges mit der davor liegenden Capelle. Dem Ende des
11. oder Anfang des 12. Jahrh. möchte der zweigeteilte unterirdische Raum im
ehemaligen Peterskloster angehören. Die Kirche St. Viti in der Vorstadt Alten-
burg hat einen Thurm romanischer Anlage mit Resten lomanischer Details. Die
Neumarktskirche St. Thomä, gleichfalls ursprünglich eine dreischiffige Basilica in
s lässt sich denken, dass für eine Zeit, in welcher die
geistlichen und kirchlichen Interessen in hervorragendem
Maasse dem öffentlichen Leben sein Gepräge gaben, Mer-
seburg als Bischofssitz der Ausgangs- und Mittelpunkt
für alle Cultur- und Kunstbestrebungen des Kreises war,
welcher im ganzen und grossen mit dem ehemaligen
Kirchensprengel zusammenfällt. Jeder zu verzeichnende
Fortschritt auf jenen Gebieten, der sich irgend im Bis-
thum vollzog, hatte in der bischöflichen Kathedrale sein
Vorbild oder fand dort sein Spiegelbild, sodass insbesondere
der Dom als die verkörperte Kunstgeschichte des Stifts in Anspruch genommen werden
kann. Nicht als ob jeder Anstoss von da ausgegangen wäre, aber sobald irgend
wann oder irgend wo im Kreise in einem über die allerengsten Grenzen hinaus-
gehenden Maasse eine künstlerische Thätigkeit entfaltet wurde, reflectierte sich
dieselbe auch am Dom. Die Entwicklungsphasen des Domes sind die der Bau-
geschichte bezw. Kunstgeschichte des Kreises. Eine Anlage frühromanischer Zeit
— 1015 gegründet —, bedeutsam alteriert in der Epoche des Uebergangsstils und
nochmals um- und ausgebaut in der Zeit der fortgeschrittensten Entartung der
Gothik, fast auf der Schwelle der Renaissance, bezeichnet er im wesentlichen
diejenigen Stilgattungen, unter welche alle erhaltenen älteren Denkmäler der Um-
gebung Merseburgs sich einreihen lassen. Insbesondere tritt dabei eine auffallende
Tbatsache zu Tage: Wie am Dom nicht, so findet sich auch sonst nirgends eine
Spur edel gothischer Bauweise; die Zeit von der zweiten Hälfte des 13. bis zur
zweiten Hälfte des 15. Jahrh. scheint ein vollständiges Schlummern schaffender
Bauthätigkeit zu bedeuten. Der Grund dieses Umstandes ist vielleicht in finan-
ziellen Calamitäten, z. Th. auch in dem Festhalten des Uebergangsstils bis an die
Schwelle des 14. Jahrh. zu suchen.
Der Dom, ursprünglich eine dreischiffige Basilica in Form des lateinischen
Kreuzes mit drei Conchen ist im ganzen trotz mancher Schönheit im einzelnen
kein eigentliches Kunstwerk. In ihrem einheitlichen romanischen Charakter er-
halten ist nur die Krypta, ein dreischiffiger Raum in rippenlosen Kreuzgewölben
ohne Quergnrte mit den z. Th. sehr fein gegliederten Pfeilern, die noch an die
Weise des Holzbaues erinnern. Ihre Verweisung in’s 11. Jahrh. ist bis jetzt noch
nirgends beanstandet worden. Vielleicht gleichen Alters ist ein Theil des west-
lichen Flügels des Kreuzganges mit der davor liegenden Capelle. Dem Ende des
11. oder Anfang des 12. Jahrh. möchte der zweigeteilte unterirdische Raum im
ehemaligen Peterskloster angehören. Die Kirche St. Viti in der Vorstadt Alten-
burg hat einen Thurm romanischer Anlage mit Resten lomanischer Details. Die
Neumarktskirche St. Thomä, gleichfalls ursprünglich eine dreischiffige Basilica in