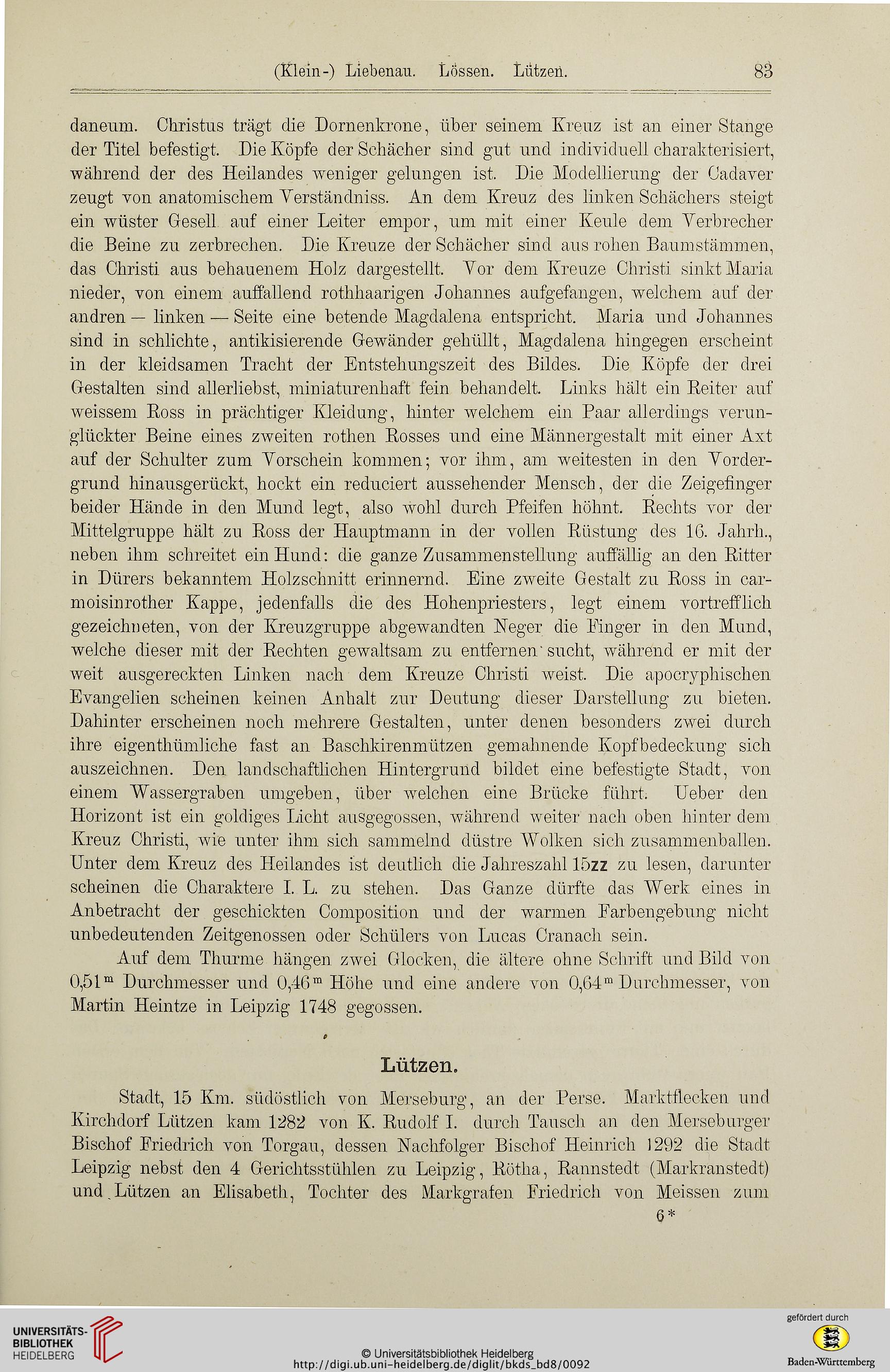83
(Klein-) Liebenau. Lossen. Lützen.
daneum. Christus trägt die Dornenkrone, über seinem Kreuz ist an einer Stange
der Titel befestigt. Die Köpfe der Schächer sind gut und individuell charakterisiert,
während der des Heilandes weniger gelungen ist. Die Modellierung der Oadaver
zeugt von anatomischem Yerständniss. An dem Kreuz des linken Schächers steigt
ein wüster Gesell auf einer Leiter empor, um mit einer Keule dem Verbrecher
die Beine zu zerbrechen. Die Kreuze der Schächer sind aus rohen Baumstämmen,
das Christi aus behauenem Holz dargestellt. Vor dem Kreuze Christi sinkt Maria
nieder, von einem auffallend rothhaarigen Johannes aufgefangen, welchem auf der
andren — linken — Seite eine betende Magdalena entspricht. Maria und Johannes
sind in schlichte, antikisierende Gewänder gehüllt, Magdalena hingegen erscheint
in der kleidsamen Tracht der Entstehungszeit des Bildes. Die Köpfe der drei
Gestalten sind allerliebst, miniaturenhaft fein behandelt. Links hält ein Reiter auf
weissem Ross in prächtiger Kleidung, hinter welchem ein Paar allerdings verun-
glückter Beine eines zweiten rothen Rosses und eine Männergestalt mit einer Axt
auf der Schulter zum Vorschein kommen; vor ihm, am weitesten in den Vorder-
grund hinausgerückt, hockt ein reduciert aussehender Mensch, der die Zeigefinger
beider Hände in den Mund legt, also wohl durch Pfeifen höhnt. Rechts vor der
Mittelgruppe hält zu Ross der Hauptmann in der vollen Rüstung des 16. Jahrh.,
neben ihm schreitet ein Hund: die ganze Zusammenstellung auffällig an den Ritter
in Dürers bekanntem Holzschnitt erinnernd. Eine zweite Gestalt zu Ross in car-
moisinrother Kappe, jedenfalls die des Hohenpriesters, legt einem vortrefflich
gezeichneten, von der Kreuzgruppe abgewandten Heger die Finger in den Mund,
welche dieser mit der Rechten gewaltsam zu entfernen' sucht, während er mit der
weit ausgereckten Linken nach dem Kreuze Christi weist. Die apocryphischen
Evangelien scheinen keinen Anhalt zur Deutung dieser Darstellung zu bieten.
Dahinter erscheinen noch mehrere Gestalten, unter denen besonders zwei durch
ihre eigenthümliche fast an Baschkirenmützen gemahnende Kopfbedeckung sich
auszeichnen. Den landschaftlichen Hintergrund bildet eine befestigte Stadt, von
einem Wassergraben umgeben, über welchen eine Brücke führt. Leber den
Horizont ist ein goldiges Licht ausgegossen, während weiter nach oben hinter dem
Kreuz Christi, wie unter ihm sich sammelnd düstre Wolken sich zusammenballen.
Unter dem Kreuz des Heilandes ist deutlich die Jahreszahl 15zz zu lesen, darunter
scheinen die Charaktere I. L. zu stehen. Das Ganze dürfte das Werk eines in
Anbetracht der geschickten Composition und der warmen Farbengebung nicht
unbedeutenden Zeitgenossen oder Schülers von Lucas Cranach sein.
Auf dem Thurme hängen zwei Glocken, die ältere ohne Schrift und Bild von
0,51m Durchmesser und 0,40m Höhe und eine andere von 0,64m Durchmesser, von
Martin Heintze in Leipzig 1748 gegossen.
Lützen.
Stadt, 15 Km. südöstlich von Merseburg, an der Perse. Marktflecken und
Kirchdorf Lützen kam 1282 von K. Rudolf I. durch Tausch an den Merseburger
Bischof Friedrich von Torgau, dessen Nachfolger Bischof Heinrich 1292 die Stadt
Leipzig nebst den 4 Gerichtsstühlen zu Leipzig, Rötha, Rannstedt (Markranstedt)
und.Lützen an Elisabeth, Tochter des Markgrafen Friedrich von Meissen zum
6*
(Klein-) Liebenau. Lossen. Lützen.
daneum. Christus trägt die Dornenkrone, über seinem Kreuz ist an einer Stange
der Titel befestigt. Die Köpfe der Schächer sind gut und individuell charakterisiert,
während der des Heilandes weniger gelungen ist. Die Modellierung der Oadaver
zeugt von anatomischem Yerständniss. An dem Kreuz des linken Schächers steigt
ein wüster Gesell auf einer Leiter empor, um mit einer Keule dem Verbrecher
die Beine zu zerbrechen. Die Kreuze der Schächer sind aus rohen Baumstämmen,
das Christi aus behauenem Holz dargestellt. Vor dem Kreuze Christi sinkt Maria
nieder, von einem auffallend rothhaarigen Johannes aufgefangen, welchem auf der
andren — linken — Seite eine betende Magdalena entspricht. Maria und Johannes
sind in schlichte, antikisierende Gewänder gehüllt, Magdalena hingegen erscheint
in der kleidsamen Tracht der Entstehungszeit des Bildes. Die Köpfe der drei
Gestalten sind allerliebst, miniaturenhaft fein behandelt. Links hält ein Reiter auf
weissem Ross in prächtiger Kleidung, hinter welchem ein Paar allerdings verun-
glückter Beine eines zweiten rothen Rosses und eine Männergestalt mit einer Axt
auf der Schulter zum Vorschein kommen; vor ihm, am weitesten in den Vorder-
grund hinausgerückt, hockt ein reduciert aussehender Mensch, der die Zeigefinger
beider Hände in den Mund legt, also wohl durch Pfeifen höhnt. Rechts vor der
Mittelgruppe hält zu Ross der Hauptmann in der vollen Rüstung des 16. Jahrh.,
neben ihm schreitet ein Hund: die ganze Zusammenstellung auffällig an den Ritter
in Dürers bekanntem Holzschnitt erinnernd. Eine zweite Gestalt zu Ross in car-
moisinrother Kappe, jedenfalls die des Hohenpriesters, legt einem vortrefflich
gezeichneten, von der Kreuzgruppe abgewandten Heger die Finger in den Mund,
welche dieser mit der Rechten gewaltsam zu entfernen' sucht, während er mit der
weit ausgereckten Linken nach dem Kreuze Christi weist. Die apocryphischen
Evangelien scheinen keinen Anhalt zur Deutung dieser Darstellung zu bieten.
Dahinter erscheinen noch mehrere Gestalten, unter denen besonders zwei durch
ihre eigenthümliche fast an Baschkirenmützen gemahnende Kopfbedeckung sich
auszeichnen. Den landschaftlichen Hintergrund bildet eine befestigte Stadt, von
einem Wassergraben umgeben, über welchen eine Brücke führt. Leber den
Horizont ist ein goldiges Licht ausgegossen, während weiter nach oben hinter dem
Kreuz Christi, wie unter ihm sich sammelnd düstre Wolken sich zusammenballen.
Unter dem Kreuz des Heilandes ist deutlich die Jahreszahl 15zz zu lesen, darunter
scheinen die Charaktere I. L. zu stehen. Das Ganze dürfte das Werk eines in
Anbetracht der geschickten Composition und der warmen Farbengebung nicht
unbedeutenden Zeitgenossen oder Schülers von Lucas Cranach sein.
Auf dem Thurme hängen zwei Glocken, die ältere ohne Schrift und Bild von
0,51m Durchmesser und 0,40m Höhe und eine andere von 0,64m Durchmesser, von
Martin Heintze in Leipzig 1748 gegossen.
Lützen.
Stadt, 15 Km. südöstlich von Merseburg, an der Perse. Marktflecken und
Kirchdorf Lützen kam 1282 von K. Rudolf I. durch Tausch an den Merseburger
Bischof Friedrich von Torgau, dessen Nachfolger Bischof Heinrich 1292 die Stadt
Leipzig nebst den 4 Gerichtsstühlen zu Leipzig, Rötha, Rannstedt (Markranstedt)
und.Lützen an Elisabeth, Tochter des Markgrafen Friedrich von Meissen zum
6*