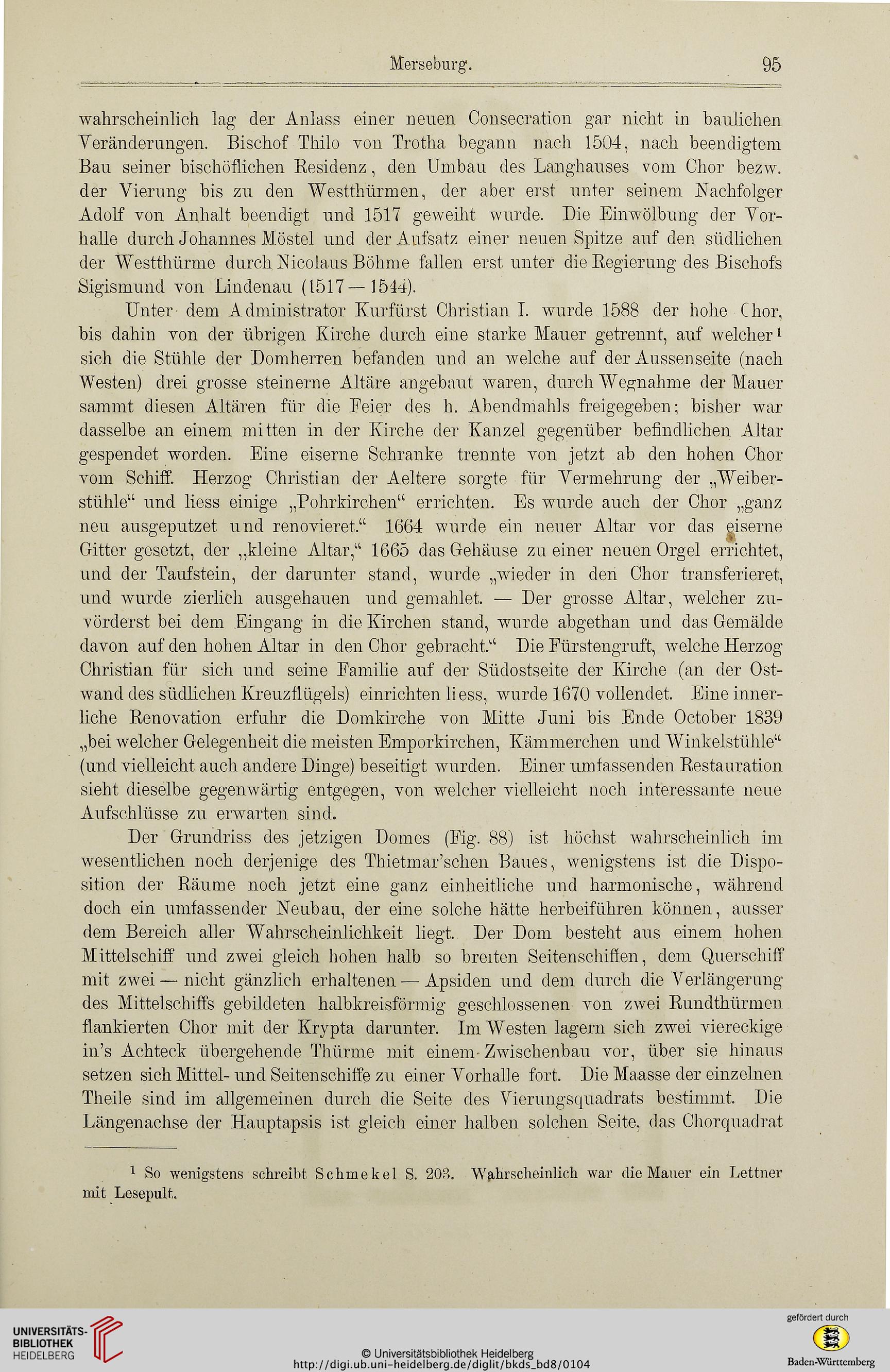Merseburg.
95
wahrscheinlich lag der Anlass einer neuen Consecration gar nicht in baulichen
Veränderungen. Bischof Thilo von Trotha begann nach 1504, nach beendigtem
Bau seiner bischöflichen Residenz, den Umbau des Langhauses vom Chor bezw.
der Vierung bis zu den Westthürmen, der aber erst unter seinem Nachfolger
Adolf von Anhalt beendigt und 1517 geweiht wurde. Die Einwölbung der Vor-
halle durch Johannes Möstel und der Aufsatz einer neuen Spitze auf den südlichen
der Westtlmrme durch Nicolaus Böhme fallen erst unter die Regierung des Bischofs
Sigismund von Lindenau (1517—1514).
Unter dem Administrator Kurfürst Christian I. wurde 1588 der hohe Chor,
bis dahin von der übrigen Kirche durch eine starke Mauer getrennt, auf welcher1
sich die Stühle der Domherren befanden und an welche auf der Aussenseite (nach
Westen) drei grosse steinerne Altäre an gebaut waren, durch Wegnahme der Mauer
sammt diesen Altären für die Eeier des h. Abendmahls freigegeben; bisher war
dasselbe an einem mitten in der Kirche der Kanzel gegenüber befindlichen Altar
gespendet worden. Eine eiserne Schranke trennte von jetzt ab den hohen Chor
vom Schiff. Herzog Christian der Aeltere sorgte für Vermehrung der „Weiber-
stühle“ und liess einige „Bohrkirchen“ errichten. Es wurde auch der Chor „ganz
neu ausgeputzet und renovieret.“ 1664 wurde ein neuer Altar vor das eiserne
Gitter gesetzt, der „kleine Altar,“ 1665 das Gehäuse zu einer neuen Orgel errichtet,
und der Taufstein, der darunter stand, wurde „wieder in den Chor transferieret,
und wurde zierlich ausgehauen und gemahlet. — Der grosse Altar, welcher zu-
vörderst bei dem Eingang in die Kirchen stand, wurde abgethan und das Gemälde
davon auf den hohen Altar in den Chor gebracht.“ Die Fürstengruft, welche Herzog
Christian für sich und seine Familie auf der Südostseite der Kirche (an der Ost-
wand des südlichen Kreuzflügels) einrichten liess, wurde 1670 vollendet. Eine inner-
liche Renovation erfuhr die Domkirche von Mitte Juni bis Ende October 1839
„bei welcher Gelegenheit die meisten Emporkirchen, Kämmerchen und Winkelstühle“
(und vielleicht auch andere Dinge) beseitigt wurden. Einer umfassenden Restauration
sieht dieselbe gegenwärtig entgegen, von welcher vielleicht noch interessante neue
Aufschlüsse zu erwarten sind.
Der Grundriss des jetzigen Domes (Fig. 88) ist höchst wahrscheinlich im
wesentlichen noch derjenige des Thietmar’schen Baues, wenigstens ist die Dispo-
sition der Räume noch jetzt eine ganz einheitliche und harmonische, während
doch ein umfassender Neubau, der eine solche hätte herbeiführen können, ausser
dem Bereich aller Wahrscheinlichkeit liegt. Der Dom besteht aus einem hohen
Mittelschiff und zwei gleich hohen halb so breiten Seitenschiffen, dem Querschiff
mit zwei—nicht gänzlich erhaltenen — Apsiden und dem durch die Verlängerung
des Mittelschiffs gebildeten halbkreisförmig geschlossenen von zwei Rundthürmen
flankierten Chor mit der Krypta darunter. Im Westen lagern sich zwei viereckige
in’s Achteck übergehende Thürme mit einem- Zwischenbau vor, über sie hinaus
setzen sich Mittel-und Seitenschiffe zu einer Vorhalle fort. Die Maasse der einzelnen
Tlieile sind im allgemeinen durch die Seite des Vierungsquadrats bestimmt. Die
Längenachse der Hauptapsis ist gleich einer halben solchen Seite, das Chorquadrat
1 So wenigstens schreibt Schraekel S. 203. Wahrscheinlich war die Mauer ein Lettner
mit Lesepult.
95
wahrscheinlich lag der Anlass einer neuen Consecration gar nicht in baulichen
Veränderungen. Bischof Thilo von Trotha begann nach 1504, nach beendigtem
Bau seiner bischöflichen Residenz, den Umbau des Langhauses vom Chor bezw.
der Vierung bis zu den Westthürmen, der aber erst unter seinem Nachfolger
Adolf von Anhalt beendigt und 1517 geweiht wurde. Die Einwölbung der Vor-
halle durch Johannes Möstel und der Aufsatz einer neuen Spitze auf den südlichen
der Westtlmrme durch Nicolaus Böhme fallen erst unter die Regierung des Bischofs
Sigismund von Lindenau (1517—1514).
Unter dem Administrator Kurfürst Christian I. wurde 1588 der hohe Chor,
bis dahin von der übrigen Kirche durch eine starke Mauer getrennt, auf welcher1
sich die Stühle der Domherren befanden und an welche auf der Aussenseite (nach
Westen) drei grosse steinerne Altäre an gebaut waren, durch Wegnahme der Mauer
sammt diesen Altären für die Eeier des h. Abendmahls freigegeben; bisher war
dasselbe an einem mitten in der Kirche der Kanzel gegenüber befindlichen Altar
gespendet worden. Eine eiserne Schranke trennte von jetzt ab den hohen Chor
vom Schiff. Herzog Christian der Aeltere sorgte für Vermehrung der „Weiber-
stühle“ und liess einige „Bohrkirchen“ errichten. Es wurde auch der Chor „ganz
neu ausgeputzet und renovieret.“ 1664 wurde ein neuer Altar vor das eiserne
Gitter gesetzt, der „kleine Altar,“ 1665 das Gehäuse zu einer neuen Orgel errichtet,
und der Taufstein, der darunter stand, wurde „wieder in den Chor transferieret,
und wurde zierlich ausgehauen und gemahlet. — Der grosse Altar, welcher zu-
vörderst bei dem Eingang in die Kirchen stand, wurde abgethan und das Gemälde
davon auf den hohen Altar in den Chor gebracht.“ Die Fürstengruft, welche Herzog
Christian für sich und seine Familie auf der Südostseite der Kirche (an der Ost-
wand des südlichen Kreuzflügels) einrichten liess, wurde 1670 vollendet. Eine inner-
liche Renovation erfuhr die Domkirche von Mitte Juni bis Ende October 1839
„bei welcher Gelegenheit die meisten Emporkirchen, Kämmerchen und Winkelstühle“
(und vielleicht auch andere Dinge) beseitigt wurden. Einer umfassenden Restauration
sieht dieselbe gegenwärtig entgegen, von welcher vielleicht noch interessante neue
Aufschlüsse zu erwarten sind.
Der Grundriss des jetzigen Domes (Fig. 88) ist höchst wahrscheinlich im
wesentlichen noch derjenige des Thietmar’schen Baues, wenigstens ist die Dispo-
sition der Räume noch jetzt eine ganz einheitliche und harmonische, während
doch ein umfassender Neubau, der eine solche hätte herbeiführen können, ausser
dem Bereich aller Wahrscheinlichkeit liegt. Der Dom besteht aus einem hohen
Mittelschiff und zwei gleich hohen halb so breiten Seitenschiffen, dem Querschiff
mit zwei—nicht gänzlich erhaltenen — Apsiden und dem durch die Verlängerung
des Mittelschiffs gebildeten halbkreisförmig geschlossenen von zwei Rundthürmen
flankierten Chor mit der Krypta darunter. Im Westen lagern sich zwei viereckige
in’s Achteck übergehende Thürme mit einem- Zwischenbau vor, über sie hinaus
setzen sich Mittel-und Seitenschiffe zu einer Vorhalle fort. Die Maasse der einzelnen
Tlieile sind im allgemeinen durch die Seite des Vierungsquadrats bestimmt. Die
Längenachse der Hauptapsis ist gleich einer halben solchen Seite, das Chorquadrat
1 So wenigstens schreibt Schraekel S. 203. Wahrscheinlich war die Mauer ein Lettner
mit Lesepult.