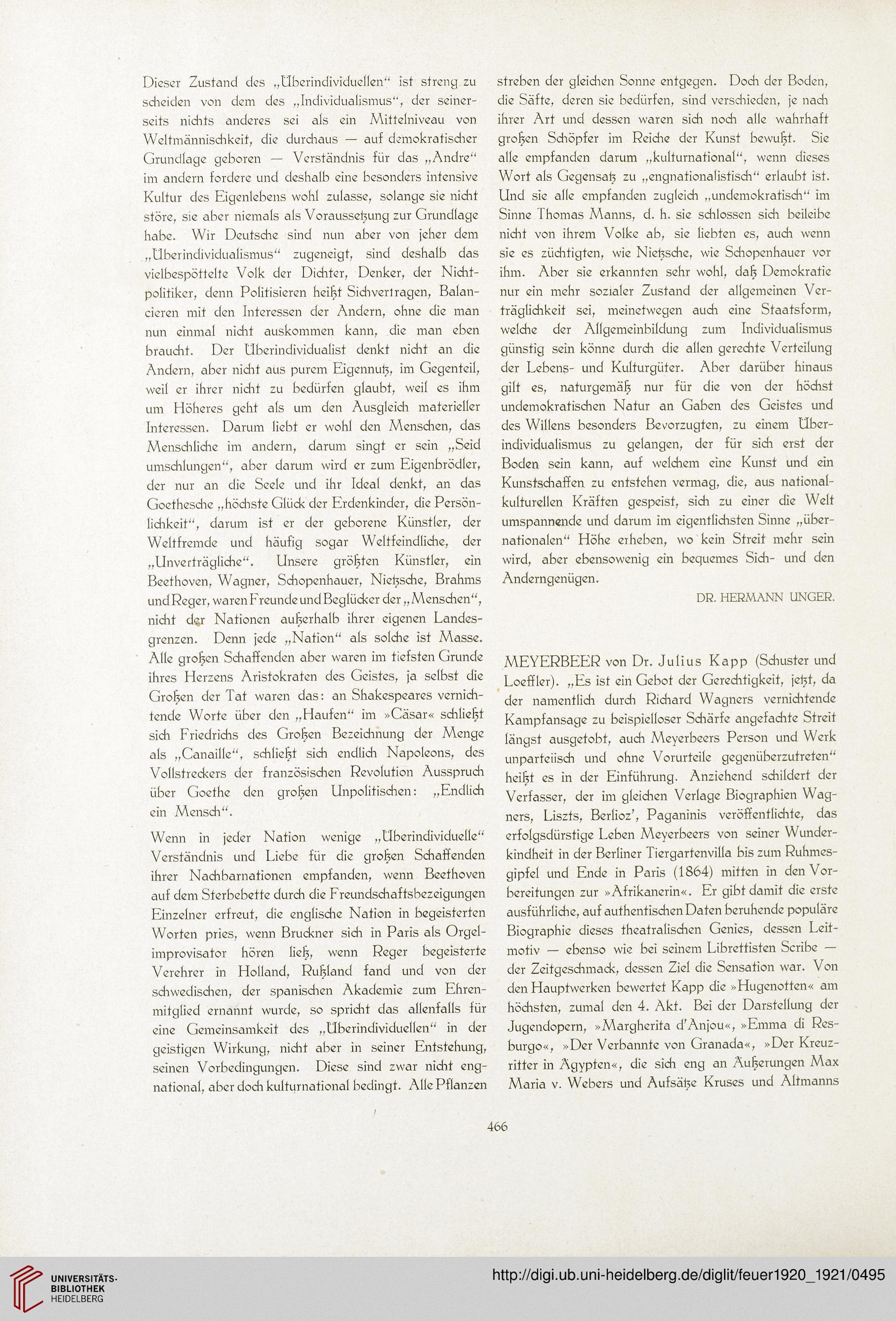Dieser Zustand des „überindividuellen“ ist streng zu
scheiden von dem des „Individualismus“, der seiner-
seits nichts anderes sei als ein Mittelniveau von
Weltmännisch keit, die durchaus — auf demokratisdrer
Grundlage geboren — Verständnis für das „Andre“
im andern fordere und deshalb eine besonders intensive
Kultur des Eigenlebens wohl zulasse, solange sie nicht
störe, sie aber niemals als Vorausseßung zur Grundlage
habe. Wir Deutsche sind nun aber von jeher dem
„Uberindividualismus“ zugeneigt, sind deshalb das
vielbespöttelte Volk der Dichter, Denker, der Nicht-
politiker, denn Politisieren heißt Sichvertragen, Balan-
cieren mit den Interessen der Andern, ohne die man
nun einmal nicht auskommen kann, die man eben
braucht. Der Uberindividualist denkt nicht an die
Andern, aber nidrt aus purem Eigennuß, im Gegenteil,
weil er ihrer nidit zu bedürfen glaubt, weil es ihm
um Höheres geht als um den Ausgleich materieller
Interessen. Darum liebt er wohl den Menschen, das
Menschliche im andern, darum singt er sein „Seid
umschlungen“, aber darum wird er zum Eigenbrödler,
der nur an die Seele und ihr Ideal denkt, an das
Goethesche „hödrste Glück der Erdenkinder, die Persön-
lichkeit“, darum ist er der geborene Künstler, der
Weltfremde und häufig sogar Weltfeindlkhe, der
„Unverträgliche“. Unsere größten Künstler, ein
Beethoven, Wagner, Schopenhauer, Nießsche, Brahms
und Reger, waren Freunde und Beglücker der „ Menschen“,
nldrt der Nationen außerhalb ihrer eigenen Landes-
grenzen. Denn jede „Nation“ als solche ist Masse.
Alle großen Schaffenden aber waren im tiefsten Grunde
ihres Herzens Aristokraten des Geistes, ja selbst die
Großen der Tat waren das: an Shakespeares vernich-
tende Worte über den „Haufen“ im »Cäsar« schließt
sich Friedrichs des Großen Bezeidmung der Menge
als „Canaille“, schließt sich endlich Napoleons, des
Vollstreckers der französischen Revolution Aussprudi
über Goethe den großen Unpolitischen: „Endlich
ein Mensch“.
Wenn in jeder Nation wenige „Uberindividuelle“
Verständnis und Liebe für die großen Schaffenden
ihrer Nachbarnationen empfanden, wenn Beethoven
auf dem Sterbebette durdr die Freundschaftsbezeigungen
Einzelner erfreut, die englische Nation in begeisterten
Worten pries, wenn Bruckner sich in Paris als Orgel-
improvisator hören ließ, wenn Reger begeisterte
Verehrer in Holland, Rußland fand und von der
schwedischen, der spanisdren Akademie zum Ehren-
mitglied ernannt wurde, so spricht das allenfalls für
eine Gemeinsamkeit des „überindividuellen“ in der
geistigen Wirkung, nidrt aber in seiner Entstehung,
seinen Vorbedingungen. Diese sind zwar nicht eng-
national, aber dodi kulturnational bedingt. Alle Pflanzen
streben der gleidren Sonne entgegen. Doch der Boden,
die Säfte, deren sie bedürfen, sind verschieden, je nach
ihrer Art und dessen waren sich noch alle wahrhaft
großen Schöpfer im Reiche der Kunst bewußt. Sie
alle empfanden darum „kulturnational“, wenn dieses
Wort als Gegensah zu „engnationalistisch“ erlaubt ist.
Und sie alle empfanden zugleich „undemokratisch“ im
Sinne Thomas Manns, d. h. sie sdrlossen sich beileibe
nicht von ihrem Volke ab, sie liebten es, auch wenn
sie es züchtigten, wie Nießsche, wie Schopenhauer vor
ihm. Aber sie erkannten sehr wohl, daß Demokratie
nur ein mehr sozialer Zustand der allgemeinen Ver-
träglichkeit sei, meinetwegen audi eine Staatsform,
welche der Allgemeinbildung zum Individualismus
günstig sein könne durch die allen gerechte Verteilung
der Lebens- und Kulturgüter. Aber darüber hinaus
gilt es, naturgemäß nur für die von der höchst
undemokratischen Natur an Gaben des Geistes und
des Willens besonders Bevorzugten, zu einem Über-
individualismus zu gelangen, der für sich erst der
Boden sein kann, auf welchem eine Kunst und ein
Kunstsdraffen zu entstehen vermag, die, aus national-
kulturellen Kräften gespeist, sich zu einer die Welt
umspannende und darum im eigentlichsten Sinne „über-
nationalen“ Höhe erheben, wo kein Streit mehr sein
wird, aber ebensowenig ein bequemes Sich- und den
Anderngenügen.
DR. HERMANN UNGER.
MEYERBEER von Dr. Julius Kapp (Schuster und
Loeffler). „Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, jeßt, da
der namentlich durch Richard Wagners vernichtende
Kampfansage zu beispielloser Schärfe angefachfe Streit
längst ausgetobt, auch Meyerbeers Person und Werk
unparteiisch und ohne Vorurteile gegenüberzutreten“
heißt es in der Einführung. Anziehend schildert der
Verfasser, der im gleidren Verlage Biographien Wag-
ners, Liszfs, Berlioz', Paganinis veröffentlichte, das
erfolgsdiirstige Leben Meyerbeers von seiner Wunder-
kindheit in der Berliner Tiergartenvilla bis zum Ruhmes-
gipfel und Ende in Paris (1864) mitten in den Vor-
bereitungen zur »Afrikanerin«. Er gibt damit die erste
ausführliche, auf authentischen Daten beruhende populäre
Biographie dieses theatralischen Genies, dessen Leit-
motiv — ebenso wie bei seinem Librettisten Scribe —
der Zeitgeschmack, dessen Ziel die Sensation war. Von
den Hauptwerken bewertet Kapp die »Hugenotten« am
höchsten, zumal den 4. Akt. Bei der Darstellung der
Jugendopern, »Marghcrita d'Anjou«, »Emma di Res-
burgo«, »Der Verbannte von Granada«, »Der Kreuz-
ritter in Ägypten«, die sich eng an Äußerungen Max
Maria v. Webers und Aufsäße Kruses und Altmanns
466
scheiden von dem des „Individualismus“, der seiner-
seits nichts anderes sei als ein Mittelniveau von
Weltmännisch keit, die durchaus — auf demokratisdrer
Grundlage geboren — Verständnis für das „Andre“
im andern fordere und deshalb eine besonders intensive
Kultur des Eigenlebens wohl zulasse, solange sie nicht
störe, sie aber niemals als Vorausseßung zur Grundlage
habe. Wir Deutsche sind nun aber von jeher dem
„Uberindividualismus“ zugeneigt, sind deshalb das
vielbespöttelte Volk der Dichter, Denker, der Nicht-
politiker, denn Politisieren heißt Sichvertragen, Balan-
cieren mit den Interessen der Andern, ohne die man
nun einmal nicht auskommen kann, die man eben
braucht. Der Uberindividualist denkt nicht an die
Andern, aber nidrt aus purem Eigennuß, im Gegenteil,
weil er ihrer nidit zu bedürfen glaubt, weil es ihm
um Höheres geht als um den Ausgleich materieller
Interessen. Darum liebt er wohl den Menschen, das
Menschliche im andern, darum singt er sein „Seid
umschlungen“, aber darum wird er zum Eigenbrödler,
der nur an die Seele und ihr Ideal denkt, an das
Goethesche „hödrste Glück der Erdenkinder, die Persön-
lichkeit“, darum ist er der geborene Künstler, der
Weltfremde und häufig sogar Weltfeindlkhe, der
„Unverträgliche“. Unsere größten Künstler, ein
Beethoven, Wagner, Schopenhauer, Nießsche, Brahms
und Reger, waren Freunde und Beglücker der „ Menschen“,
nldrt der Nationen außerhalb ihrer eigenen Landes-
grenzen. Denn jede „Nation“ als solche ist Masse.
Alle großen Schaffenden aber waren im tiefsten Grunde
ihres Herzens Aristokraten des Geistes, ja selbst die
Großen der Tat waren das: an Shakespeares vernich-
tende Worte über den „Haufen“ im »Cäsar« schließt
sich Friedrichs des Großen Bezeidmung der Menge
als „Canaille“, schließt sich endlich Napoleons, des
Vollstreckers der französischen Revolution Aussprudi
über Goethe den großen Unpolitischen: „Endlich
ein Mensch“.
Wenn in jeder Nation wenige „Uberindividuelle“
Verständnis und Liebe für die großen Schaffenden
ihrer Nachbarnationen empfanden, wenn Beethoven
auf dem Sterbebette durdr die Freundschaftsbezeigungen
Einzelner erfreut, die englische Nation in begeisterten
Worten pries, wenn Bruckner sich in Paris als Orgel-
improvisator hören ließ, wenn Reger begeisterte
Verehrer in Holland, Rußland fand und von der
schwedischen, der spanisdren Akademie zum Ehren-
mitglied ernannt wurde, so spricht das allenfalls für
eine Gemeinsamkeit des „überindividuellen“ in der
geistigen Wirkung, nidrt aber in seiner Entstehung,
seinen Vorbedingungen. Diese sind zwar nicht eng-
national, aber dodi kulturnational bedingt. Alle Pflanzen
streben der gleidren Sonne entgegen. Doch der Boden,
die Säfte, deren sie bedürfen, sind verschieden, je nach
ihrer Art und dessen waren sich noch alle wahrhaft
großen Schöpfer im Reiche der Kunst bewußt. Sie
alle empfanden darum „kulturnational“, wenn dieses
Wort als Gegensah zu „engnationalistisch“ erlaubt ist.
Und sie alle empfanden zugleich „undemokratisch“ im
Sinne Thomas Manns, d. h. sie sdrlossen sich beileibe
nicht von ihrem Volke ab, sie liebten es, auch wenn
sie es züchtigten, wie Nießsche, wie Schopenhauer vor
ihm. Aber sie erkannten sehr wohl, daß Demokratie
nur ein mehr sozialer Zustand der allgemeinen Ver-
träglichkeit sei, meinetwegen audi eine Staatsform,
welche der Allgemeinbildung zum Individualismus
günstig sein könne durch die allen gerechte Verteilung
der Lebens- und Kulturgüter. Aber darüber hinaus
gilt es, naturgemäß nur für die von der höchst
undemokratischen Natur an Gaben des Geistes und
des Willens besonders Bevorzugten, zu einem Über-
individualismus zu gelangen, der für sich erst der
Boden sein kann, auf welchem eine Kunst und ein
Kunstsdraffen zu entstehen vermag, die, aus national-
kulturellen Kräften gespeist, sich zu einer die Welt
umspannende und darum im eigentlichsten Sinne „über-
nationalen“ Höhe erheben, wo kein Streit mehr sein
wird, aber ebensowenig ein bequemes Sich- und den
Anderngenügen.
DR. HERMANN UNGER.
MEYERBEER von Dr. Julius Kapp (Schuster und
Loeffler). „Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, jeßt, da
der namentlich durch Richard Wagners vernichtende
Kampfansage zu beispielloser Schärfe angefachfe Streit
längst ausgetobt, auch Meyerbeers Person und Werk
unparteiisch und ohne Vorurteile gegenüberzutreten“
heißt es in der Einführung. Anziehend schildert der
Verfasser, der im gleidren Verlage Biographien Wag-
ners, Liszfs, Berlioz', Paganinis veröffentlichte, das
erfolgsdiirstige Leben Meyerbeers von seiner Wunder-
kindheit in der Berliner Tiergartenvilla bis zum Ruhmes-
gipfel und Ende in Paris (1864) mitten in den Vor-
bereitungen zur »Afrikanerin«. Er gibt damit die erste
ausführliche, auf authentischen Daten beruhende populäre
Biographie dieses theatralischen Genies, dessen Leit-
motiv — ebenso wie bei seinem Librettisten Scribe —
der Zeitgeschmack, dessen Ziel die Sensation war. Von
den Hauptwerken bewertet Kapp die »Hugenotten« am
höchsten, zumal den 4. Akt. Bei der Darstellung der
Jugendopern, »Marghcrita d'Anjou«, »Emma di Res-
burgo«, »Der Verbannte von Granada«, »Der Kreuz-
ritter in Ägypten«, die sich eng an Äußerungen Max
Maria v. Webers und Aufsäße Kruses und Altmanns
466