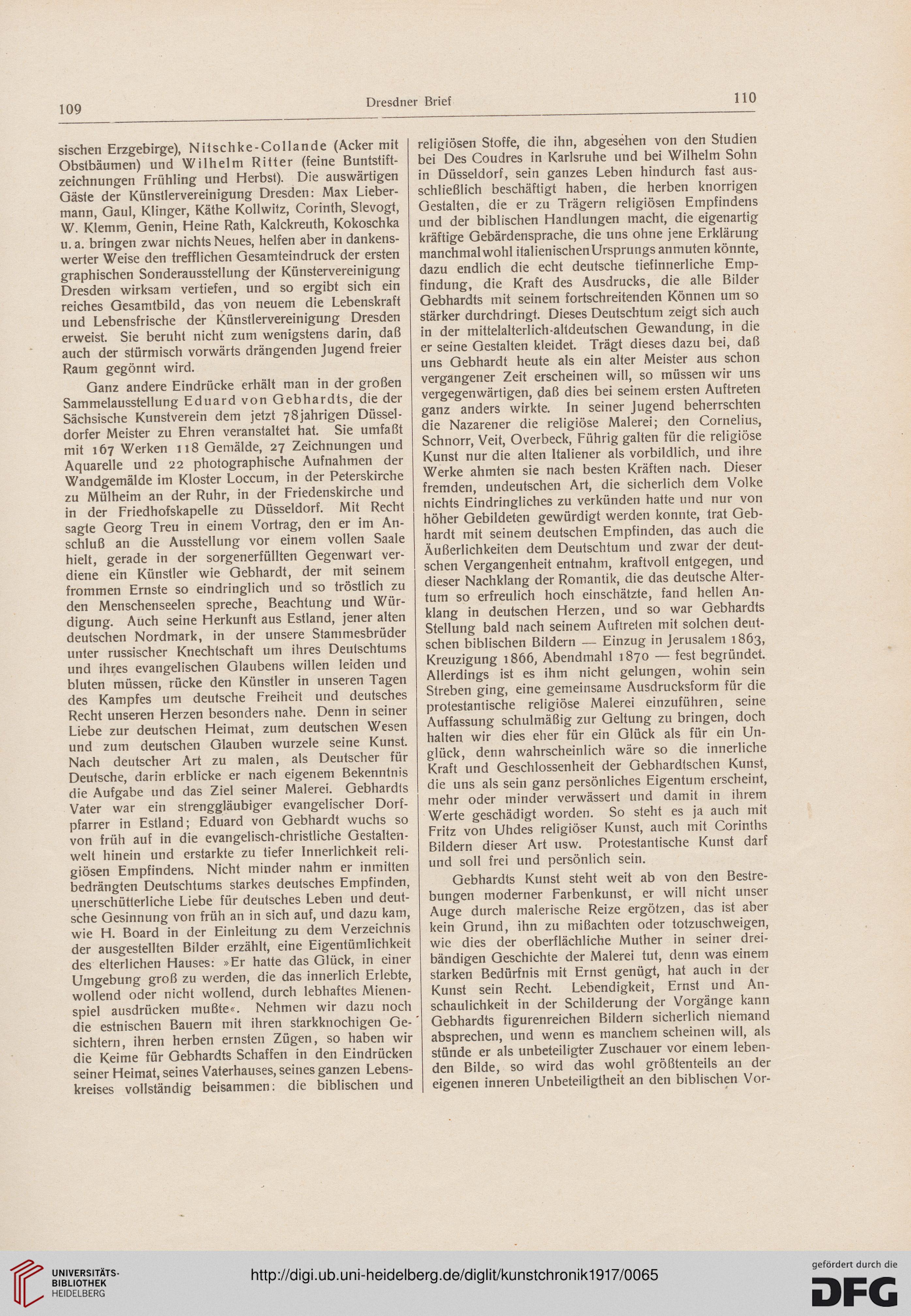109
Dresdner Brief
110
sischen Erzgebirge), Nitschke-Collande (Acker mit
Obstbäumen) und Wilhelm Ritter (feine Buntstift-
zeichnungen Frühling und Herbst). Die auswärtigen
Gäste der Künstlervereinigung Dresden: Max Lieber-
mann, Gaul, Klinger, Käthe Kollwifz, Corinth, Sievogt,
W. Klemm, Genin, Heine Rath, Kalckreuth, Kokoschka
u. a. bringen zwar nichts Neues, helfen aber in dankens-
werter Weise den trefflichen Gesamteindruck der ersten
graphischen Sonderausstellung der Künstervereinigung
Dresden wirksam vertiefen, und so ergibt sich ein
reiches Gesamtbild, das von neuem die Lebenskraft
und Lebensfrische der Künstlervereinigung Dresden
erweist. Sie beruht nicht zum wenigstens darin, daß
auch der stürmisch vorwärts drängenden Jugend freier
Raum gegönnt wird.
Ganz andere Eindrücke erhält man in der großen
Sammelausstellung Eduard von Gebhardts, die der
Sächsische Kunstverein dem jetzt 78jährigen Düssel-
dorfer Meister zu Ehren veranstaltet hat. Sie umfaßt
mit 167 Werken 118 Gemälde, 27 Zeichnungen und
Aquarelle und 22 photographische Aufnahmen der
Wandgemälde im Kloster Loccum, in der Peterskirche
zu Mülheim an der Ruhr, in der Friedenskirche und
in der Friedhofskapelle zu Düsseldorf. Mit Recht
sagte Georg Treu in einem Vortrag, den er im An-
schluß an die Ausstellung vor einem vollen Saale
hielt, gerade in der sorgenerfüllten Gegenwart ver-
diene ein Künstler wie Gebhardt, der mit seinem
frommen Ernste so eindringlich und so tröstlich zu
den Menschenseelen spreche, Beachtung und Wür-
digung. Auch seine Herkunft aus Estland, jener alten
deutschen Nordmark, in der unsere Stammesbrüder
unter russischer Knechtschaft um ihres Deutschtums
und ihres evangelischen Glaubens willen leiden und
bluten müssen, rücke den Künstler in unseren Tagen
des Kampfes um deutsche Freiheit und deutsches
Recht unseren Herzen besonders nahe. Denn in seiner
Liebe zur deutschen Heimat, zum deutschen Wesen
und zum deutschen Glauben wurzele seine Kunst.
Nach deutscher Art zu malen, als Deutscher für
Deutsche, darin erblicke er nach eigenem Bekenntnis
die Aufgabe und das Ziel seiner Malerei. Gebhardts
Vater war ein strenggläubiger evangelischer Dorf-
pfarrer in Estland; Eduard von Gebhardt wuchs so
von früh auf in die evangelisch-christliche Gestalten-
welt hinein und erstarkte zu tiefer Innerlichkeit reli-
giösen Empfindens. Nicht minder nahm er inmitten
bedrängten Deutschtums starkes deutsches Empfinden,
unerschütterliche Liebe für deutsches Leben und deut-
sche Gesinnung von früh an in sich auf, und dazu kam,
wie H. Board in der Einleitung zu dem Verzeichnis
der ausgestellten Bilder erzählt, eine Eigentümlichkeit
des elterlichen Hauses: »Er hatte das Glück, in einer
Umgebung groß zu werden, die das innerlich Erlebte,
wollend oder nicht wollend, durch lebhaftes Mienen-
spiel ausdrücken mußte«. Nehmen wir dazu noch
die estnischen Bauern mit ihren starkknochigen Ge-
sichtern, ihren herben ernsten Zügen, so haben wir
die Keime für Gebhardts Schaffen in den Eindrücken
seiner Heimat, seines Vaterhauses, seines ganzen Lebens-
kreises vollständig beisammen: die biblischen und
religiösen Stoffe, die ihn, abgesehen von den Studien
bei Des Coudres in Karlsruhe und bei Wilhelm Sohn
in Düsseldorf, sein ganzes Leben hindurch fast aus-
schließlich beschäftigt haben, die herben knorrigen
Gestalten, die er zu Trägern religiösen Empfindens
und der biblischen Handlungen macht, die eigenartig
kräftige Gebärdensprache, die uns ohne jene Erklärung
manchmal wohl italienischen Ursprungs anmuten könnte,
dazu endlich die echt deutsche tiefinnerliche Emp-
findung, die Kraft des Ausdrucks, die alle Bilder
Gebhardts mit seinem fortschreitenden Können um so
stärker durchdringt. Dieses Deutschtum zeigt sich auch
in der mittelalterlich-altdeutschen Gewandung, in die
er seine Gestalten kleidet. Trägt dieses dazu bei, daß
uns Gebhardt heute als ein alter Meister aus schon
vergangener Zeit erscheinen will, so müssen wir uns
vergegenwärtigen, daß dies bei seinem ersten Auftreten
ganz anders wirkte. In seiner Jugend beherrschten
die Nazarener die religiöse Malerei; den Cornelius,
Schnorr, Veit, Overbeck, Führig galten für die religiöse
Kunst nur die alten Italiener als vorbildlich, und ihre
Werke ahmten sie nach besten Kräften nach. Dieser
fremden, undeutschen Art, die sicherlich dem Volke
nichts Eindringliches zu verkünden hatte und nur von
höher Gebildeten gewürdigt werden konnte, trat Geb-
hardt mit seinem deutschen Empfinden, das auch die
Äußerlichkeiten dem Deutschtum und zwar der deut-
schen Vergangenheit entnahm, kraftvoll entgegen, und
dieser Nachklang der Romantik, die das deutsche Alter-
tum so erfreulich hoch einschätzte, fand hellen An-
klang in deutschen Herzen, und so war Gebhardts
Stellung bald nach seinem Auftreten mit solchen deut-
schen biblischen Bildern — Einzug in Jerusalem 1863,
Kreuzigung 1866, Abendmahl 1870 — fest begründet.
Allerdings ist es ihm nicht gelungen, wohin sein
Streben ging, eine gemeinsame Ausdrucksform für die
protestantische religiöse Malerei einzuführen, seine
Auffassung schulmäßig zur Geltung zu bringen, doch
halten wir dies eher für ein Glück als für ein Un-
glück, denn wahrscheinlich wäre so die innerliche
Kraft und Geschlossenheit der Gebhardtschen Kunst,
die uns als sein ganz persönliches Eigentum erscheint,
mehr oder minder verwässert und damit in ihrem
Werte geschädigt worden. So steht es ja auch mit
Fritz von Uhdes religiöser Kunst, auch mit Corinths
Bildern dieser Art usw. Protestantische Kunst darf
und soll frei und persönlich sein.
Gebhardts Kunst steht weit ab von den Bestre-
bungen moderner Farbenkunst, er will nicht unser
Auge durch malerische Reize ergötzen, das ist aber
kein Grund, ihn zu mißachten oder totzuschweigen,
wie dies der oberflächliche Muther in seiner drei-
bändigen Geschichte der Malerei tut, denn was einem
starken Bedürfnis mit Ernst genügt, hat auch in der
Kunst sein Recht. Lebendigkeit, Ernst und An-
schaulichkeit in der Schilderung der Vorgänge kann
Gebhardts figurenreichen Bildern sicherlich niemand
absprechen, und wenn es manchem scheinen will, als
stünde er als unbeteiligter Zuschauer vor einem leben-
den Bilde, so wird das wohl größtenteils an der
eigenen inneren Unbeteiligtheit an den biblischen Vor-
Dresdner Brief
110
sischen Erzgebirge), Nitschke-Collande (Acker mit
Obstbäumen) und Wilhelm Ritter (feine Buntstift-
zeichnungen Frühling und Herbst). Die auswärtigen
Gäste der Künstlervereinigung Dresden: Max Lieber-
mann, Gaul, Klinger, Käthe Kollwifz, Corinth, Sievogt,
W. Klemm, Genin, Heine Rath, Kalckreuth, Kokoschka
u. a. bringen zwar nichts Neues, helfen aber in dankens-
werter Weise den trefflichen Gesamteindruck der ersten
graphischen Sonderausstellung der Künstervereinigung
Dresden wirksam vertiefen, und so ergibt sich ein
reiches Gesamtbild, das von neuem die Lebenskraft
und Lebensfrische der Künstlervereinigung Dresden
erweist. Sie beruht nicht zum wenigstens darin, daß
auch der stürmisch vorwärts drängenden Jugend freier
Raum gegönnt wird.
Ganz andere Eindrücke erhält man in der großen
Sammelausstellung Eduard von Gebhardts, die der
Sächsische Kunstverein dem jetzt 78jährigen Düssel-
dorfer Meister zu Ehren veranstaltet hat. Sie umfaßt
mit 167 Werken 118 Gemälde, 27 Zeichnungen und
Aquarelle und 22 photographische Aufnahmen der
Wandgemälde im Kloster Loccum, in der Peterskirche
zu Mülheim an der Ruhr, in der Friedenskirche und
in der Friedhofskapelle zu Düsseldorf. Mit Recht
sagte Georg Treu in einem Vortrag, den er im An-
schluß an die Ausstellung vor einem vollen Saale
hielt, gerade in der sorgenerfüllten Gegenwart ver-
diene ein Künstler wie Gebhardt, der mit seinem
frommen Ernste so eindringlich und so tröstlich zu
den Menschenseelen spreche, Beachtung und Wür-
digung. Auch seine Herkunft aus Estland, jener alten
deutschen Nordmark, in der unsere Stammesbrüder
unter russischer Knechtschaft um ihres Deutschtums
und ihres evangelischen Glaubens willen leiden und
bluten müssen, rücke den Künstler in unseren Tagen
des Kampfes um deutsche Freiheit und deutsches
Recht unseren Herzen besonders nahe. Denn in seiner
Liebe zur deutschen Heimat, zum deutschen Wesen
und zum deutschen Glauben wurzele seine Kunst.
Nach deutscher Art zu malen, als Deutscher für
Deutsche, darin erblicke er nach eigenem Bekenntnis
die Aufgabe und das Ziel seiner Malerei. Gebhardts
Vater war ein strenggläubiger evangelischer Dorf-
pfarrer in Estland; Eduard von Gebhardt wuchs so
von früh auf in die evangelisch-christliche Gestalten-
welt hinein und erstarkte zu tiefer Innerlichkeit reli-
giösen Empfindens. Nicht minder nahm er inmitten
bedrängten Deutschtums starkes deutsches Empfinden,
unerschütterliche Liebe für deutsches Leben und deut-
sche Gesinnung von früh an in sich auf, und dazu kam,
wie H. Board in der Einleitung zu dem Verzeichnis
der ausgestellten Bilder erzählt, eine Eigentümlichkeit
des elterlichen Hauses: »Er hatte das Glück, in einer
Umgebung groß zu werden, die das innerlich Erlebte,
wollend oder nicht wollend, durch lebhaftes Mienen-
spiel ausdrücken mußte«. Nehmen wir dazu noch
die estnischen Bauern mit ihren starkknochigen Ge-
sichtern, ihren herben ernsten Zügen, so haben wir
die Keime für Gebhardts Schaffen in den Eindrücken
seiner Heimat, seines Vaterhauses, seines ganzen Lebens-
kreises vollständig beisammen: die biblischen und
religiösen Stoffe, die ihn, abgesehen von den Studien
bei Des Coudres in Karlsruhe und bei Wilhelm Sohn
in Düsseldorf, sein ganzes Leben hindurch fast aus-
schließlich beschäftigt haben, die herben knorrigen
Gestalten, die er zu Trägern religiösen Empfindens
und der biblischen Handlungen macht, die eigenartig
kräftige Gebärdensprache, die uns ohne jene Erklärung
manchmal wohl italienischen Ursprungs anmuten könnte,
dazu endlich die echt deutsche tiefinnerliche Emp-
findung, die Kraft des Ausdrucks, die alle Bilder
Gebhardts mit seinem fortschreitenden Können um so
stärker durchdringt. Dieses Deutschtum zeigt sich auch
in der mittelalterlich-altdeutschen Gewandung, in die
er seine Gestalten kleidet. Trägt dieses dazu bei, daß
uns Gebhardt heute als ein alter Meister aus schon
vergangener Zeit erscheinen will, so müssen wir uns
vergegenwärtigen, daß dies bei seinem ersten Auftreten
ganz anders wirkte. In seiner Jugend beherrschten
die Nazarener die religiöse Malerei; den Cornelius,
Schnorr, Veit, Overbeck, Führig galten für die religiöse
Kunst nur die alten Italiener als vorbildlich, und ihre
Werke ahmten sie nach besten Kräften nach. Dieser
fremden, undeutschen Art, die sicherlich dem Volke
nichts Eindringliches zu verkünden hatte und nur von
höher Gebildeten gewürdigt werden konnte, trat Geb-
hardt mit seinem deutschen Empfinden, das auch die
Äußerlichkeiten dem Deutschtum und zwar der deut-
schen Vergangenheit entnahm, kraftvoll entgegen, und
dieser Nachklang der Romantik, die das deutsche Alter-
tum so erfreulich hoch einschätzte, fand hellen An-
klang in deutschen Herzen, und so war Gebhardts
Stellung bald nach seinem Auftreten mit solchen deut-
schen biblischen Bildern — Einzug in Jerusalem 1863,
Kreuzigung 1866, Abendmahl 1870 — fest begründet.
Allerdings ist es ihm nicht gelungen, wohin sein
Streben ging, eine gemeinsame Ausdrucksform für die
protestantische religiöse Malerei einzuführen, seine
Auffassung schulmäßig zur Geltung zu bringen, doch
halten wir dies eher für ein Glück als für ein Un-
glück, denn wahrscheinlich wäre so die innerliche
Kraft und Geschlossenheit der Gebhardtschen Kunst,
die uns als sein ganz persönliches Eigentum erscheint,
mehr oder minder verwässert und damit in ihrem
Werte geschädigt worden. So steht es ja auch mit
Fritz von Uhdes religiöser Kunst, auch mit Corinths
Bildern dieser Art usw. Protestantische Kunst darf
und soll frei und persönlich sein.
Gebhardts Kunst steht weit ab von den Bestre-
bungen moderner Farbenkunst, er will nicht unser
Auge durch malerische Reize ergötzen, das ist aber
kein Grund, ihn zu mißachten oder totzuschweigen,
wie dies der oberflächliche Muther in seiner drei-
bändigen Geschichte der Malerei tut, denn was einem
starken Bedürfnis mit Ernst genügt, hat auch in der
Kunst sein Recht. Lebendigkeit, Ernst und An-
schaulichkeit in der Schilderung der Vorgänge kann
Gebhardts figurenreichen Bildern sicherlich niemand
absprechen, und wenn es manchem scheinen will, als
stünde er als unbeteiligter Zuschauer vor einem leben-
den Bilde, so wird das wohl größtenteils an der
eigenen inneren Unbeteiligtheit an den biblischen Vor-