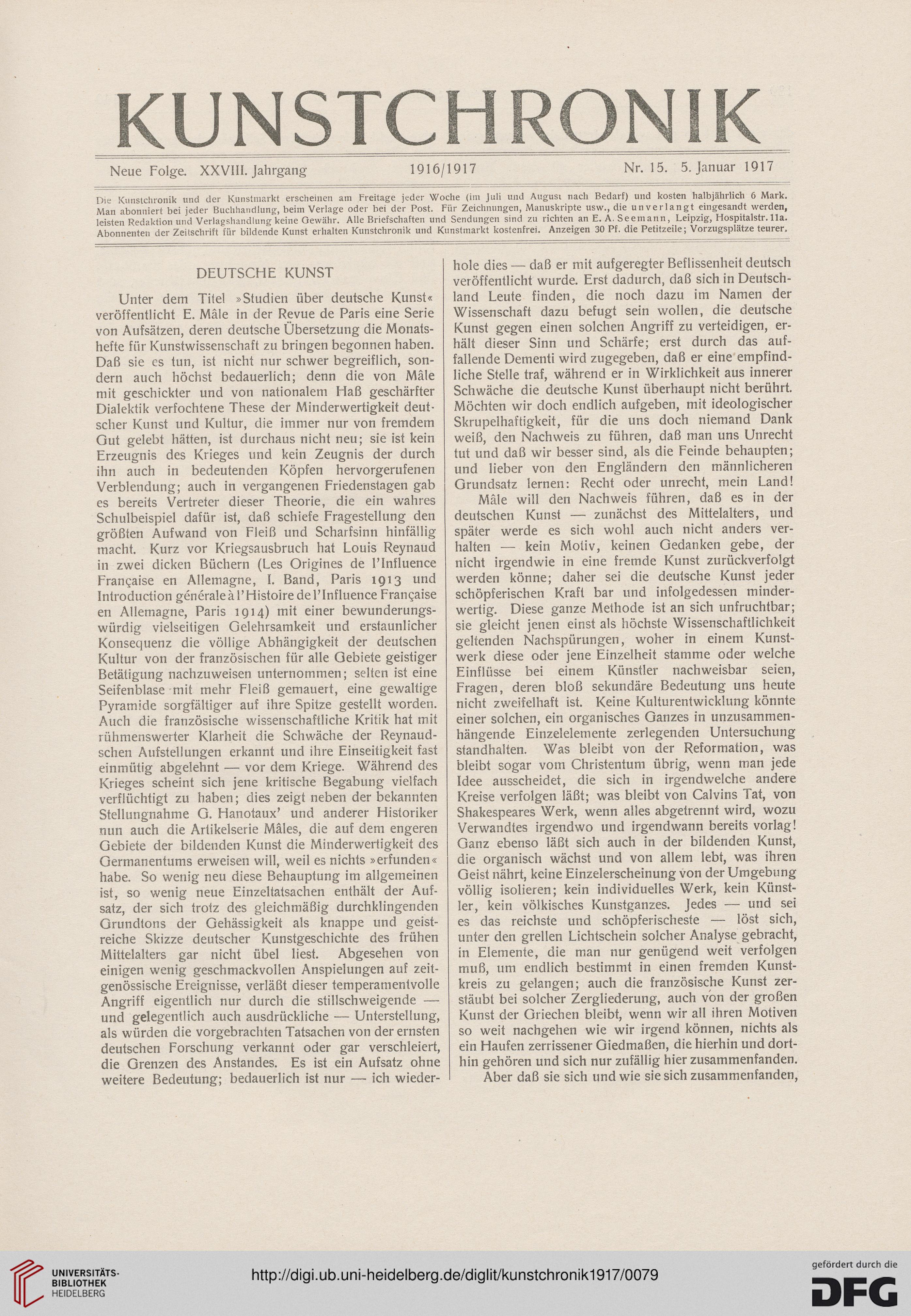KUNSTCHRONIK
Neue Folge. XXVIII. Jahrgang 1916/1917 Nr. 15. 5. Januar 1917
Die Kunstchronik und der Kunstmarkt erscheinen am Freitage jeder Woche (im Juli und August nach Bedarf) und kosten halbjährlich 6 Mark.
Man abonniert bei jeder Buchhandlung, beim Verlage oder bei der Post. Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden,
leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Hospitalstr. IIa.
Abonnenten der Zeitschrift für bildende Kunst erhalten Kunstchronik und Kunstmarkt kostenfrei. Anzeigen 30 Pf. die Petitzeile; Vorzugsplätze teurer.
DEUTSCHE KUNST
Unter dem Titel »Studien über deutsche Kunst«
veröffentlicht E. Male in der Revue de Paris eine Serie
von Aufsätzen, deren deutsche Übersetzung die Monats-
hefte für Kunstwissenschaft zu bringen begonnen haben.
Daß sie es tun, ist nicht nur schwer begreiflich, son-
dern auch höchst bedauerlich; denn die von Male
mit geschickter und von nationalem Haß geschärfter
Dialektik verfochfene These der Minderwertigkeit deut-
scher Kunst und Kultur, die immer nur von fremdem
Gut gelebt hätten, ist durchaus nicht neu; sie ist kein
Erzeugnis des Krieges und kein Zeugnis der durch
ihn auch in bedeutenden Köpfen hervorgerufenen
Verblendung; auch in vergangenen Friedenstagen gab
es bereits Vertreter dieser Theorie, die ein wahres
Schulbeispiel dafür ist, daß schiefe Fragestellung den
größten Aufwand von Fleiß und Scharfsinn hinfällig
macht. Kurz vor Kriegsausbruch hat Louis Reynaud
in zwei dicken Büchern (Les Origines de l'Influence
Franchise en Allemagne, I. Band, Paris 1913 und
Introduction generaleäl'Histoiredel'Influence Francaise
en Allemagne, Paris 1914) mit einer bewunderungs-
würdig vielseitigen Gelehrsamkeit und erstaunlicher
Konsequenz die völlige Abhängigkeit der deutschen
Kultur von der französischen für alle Gebiete geistiger
Betätigung nachzuweisen unternommen; selten ist eine
Seifenblase mit mehr Fleiß gemauert, eine gewaltige
Pyramide sorgfältiger auf ihre Spitze gestellt worden.
Auch die französische wissenschaftliche Kritik hat mit
rühmenswerter Klarheit die Schwäche der Reynaud-
schen Aufstellungen erkannt und ihre Einseitigkeit fast
einmütig abgelehnt — vor dem Kriege. Während des
Krieges scheint sich jene kritische Begabung vielfach
verflüchtigt zu haben; dies zeigt neben der bekannten
Stellungnahme G. Hanotaux' und anderer Historiker
nun auch die Artikelserie Males, die auf dem engeren
Gebiete der bildenden Kunst die Minderwertigkeit des
Germanentums erweisen will, weil es nichts »erfunden«
habe. So wenig neu diese Behauptung im allgemeinen
ist, so wenig neue Einzeltatsachen enthält der Auf-
satz, der sich trotz des gleichmäßig durchklingenden
Grundtons der Gehässigkeit als knappe und geist-
reiche Skizze deutscher Kunstgeschichte des frühen
Mittelalters gar nicht übel liest. Abgesehen von
einigen wenig geschmackvollen Anspielungen auf zeit-
genössische Ereignisse, verläßt dieser temperamentvolle
Angriff eigentlich nur durch die stillschweigende —
und gelegentlich auch ausdrückliche — Unterstellung,
als würden die vorgebrachten Tatsachen von der ernsten
deutschen Forschung verkannt oder gar verschleiert,
die Grenzen des Anstandes. Es ist ein Aufsatz ohne
weitere Bedeutung; bedauerlich ist nur — ich wieder-
hole dies — daß er mit aufgeregter Beflissenheit deutsch
veröffentlicht wurde. Erst dadurch, daß sich in Deutsch-
land Leute finden, die noch dazu im Namen der
Wissenschaft dazu befugt sein wollen, die deutsche
Kunst gegen einen solchen Angriff zu verteidigen, er-
hält dieser Sinn und Schärfe; erst durch das auf-
fallende Dementi wird zugegeben, daß er eine empfind-
liche Stelle traf, während er in Wirklichkeit aus innerer
Schwäche die deutsche Kunst überhaupt nicht berührt.
Möchten wir doch endlich aufgeben, mit ideologischer
Skrupelhaftigkeit, für die uns doch niemand Dank
weiß, den Nachweis zu führen, daß man uns Unrecht
tut und daß wir besser sind, als die Feinde behaupten;
und lieber von den Engländern den männlicheren
Grundsatz lernen: Recht oder unrecht, mein Land!
Male will den Nachweis führen, daß es in der
deutschen Kunst — zunächst des Mittelalters, und
später werde es sich wohl auch nicht anders ver-
halten — kein Motiv, keinen Gedanken gebe, der
nicht irgendwie in eine fremde Kunst zurückverfolgt
werden könne; daher sei die deutsche Kunst jeder
schöpferischen Kraft bar und infolgedessen minder-
wertig. Diese ganze Methode ist an sich unfruchtbar;
sie gleicht jenen einst als höchste Wissenschaftlichkeit
geltenden Nachspürungen, woher in einem Kunst-
werk diese oder jene Einzelheit stamme oder welche
Einflüsse bei einem Künstler nachweisbar seien,
Fragen, deren bloß sekundäre Bedeutung uns heute
nicht zweifelhaft ist. Keine Kulturentwicklung könnte
einer solchen, ein organisches Ganzes in unzusammen-
hängende Einzelelemente zerlegenden Untersuchung
standhalten. Was bleibt von der Reformation, was
bleibt sogar vom Christentum übrig, wenn man jede
Idee ausscheidet, die sich in irgendwelche andere
Kreise verfolgen läßt; was bleibt von Calvins Tat, von
Shakespeares Werk, wenn alles abgetrennt wird, wozu
Verwandtes irgendwo und irgendwann bereits vorlag!
Ganz ebenso läßt sich auch in der bildenden Kunst,
die organisch wächst und von allem lebt, was ihren
Geist nährt, keine Einzelerscheinung von der Umgebung
völlig isolieren; kein individuelles Werk, kein Künst-
ler, kein völkisches Kunstganzes. Jedes — und sei
es das reichste und schöpferischeste — löst sich,
unter den grellen Lichtschein solcher Analyse gebracht,
in Elemente, die man nur genügend weit verfolgen
muß, um endlich bestimmt in einen fremden Kunst-
kreis zu gelangen; auch die französische Kunst zer-
stäubt bei solcher Zergliederung, auch von der großen
Kunst der Griechen bleibt, wenn wir all ihren Motiven
so weit nachgehen wie wir irgend können, nichts als
ein Haufen zerrissener Giedmaßen, die hierhin und dort-
hin gehören und sich nur zufällig hier zusammenfanden.
Aber daß sie sich und wie sie sich zusammenfanden,
Neue Folge. XXVIII. Jahrgang 1916/1917 Nr. 15. 5. Januar 1917
Die Kunstchronik und der Kunstmarkt erscheinen am Freitage jeder Woche (im Juli und August nach Bedarf) und kosten halbjährlich 6 Mark.
Man abonniert bei jeder Buchhandlung, beim Verlage oder bei der Post. Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden,
leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Hospitalstr. IIa.
Abonnenten der Zeitschrift für bildende Kunst erhalten Kunstchronik und Kunstmarkt kostenfrei. Anzeigen 30 Pf. die Petitzeile; Vorzugsplätze teurer.
DEUTSCHE KUNST
Unter dem Titel »Studien über deutsche Kunst«
veröffentlicht E. Male in der Revue de Paris eine Serie
von Aufsätzen, deren deutsche Übersetzung die Monats-
hefte für Kunstwissenschaft zu bringen begonnen haben.
Daß sie es tun, ist nicht nur schwer begreiflich, son-
dern auch höchst bedauerlich; denn die von Male
mit geschickter und von nationalem Haß geschärfter
Dialektik verfochfene These der Minderwertigkeit deut-
scher Kunst und Kultur, die immer nur von fremdem
Gut gelebt hätten, ist durchaus nicht neu; sie ist kein
Erzeugnis des Krieges und kein Zeugnis der durch
ihn auch in bedeutenden Köpfen hervorgerufenen
Verblendung; auch in vergangenen Friedenstagen gab
es bereits Vertreter dieser Theorie, die ein wahres
Schulbeispiel dafür ist, daß schiefe Fragestellung den
größten Aufwand von Fleiß und Scharfsinn hinfällig
macht. Kurz vor Kriegsausbruch hat Louis Reynaud
in zwei dicken Büchern (Les Origines de l'Influence
Franchise en Allemagne, I. Band, Paris 1913 und
Introduction generaleäl'Histoiredel'Influence Francaise
en Allemagne, Paris 1914) mit einer bewunderungs-
würdig vielseitigen Gelehrsamkeit und erstaunlicher
Konsequenz die völlige Abhängigkeit der deutschen
Kultur von der französischen für alle Gebiete geistiger
Betätigung nachzuweisen unternommen; selten ist eine
Seifenblase mit mehr Fleiß gemauert, eine gewaltige
Pyramide sorgfältiger auf ihre Spitze gestellt worden.
Auch die französische wissenschaftliche Kritik hat mit
rühmenswerter Klarheit die Schwäche der Reynaud-
schen Aufstellungen erkannt und ihre Einseitigkeit fast
einmütig abgelehnt — vor dem Kriege. Während des
Krieges scheint sich jene kritische Begabung vielfach
verflüchtigt zu haben; dies zeigt neben der bekannten
Stellungnahme G. Hanotaux' und anderer Historiker
nun auch die Artikelserie Males, die auf dem engeren
Gebiete der bildenden Kunst die Minderwertigkeit des
Germanentums erweisen will, weil es nichts »erfunden«
habe. So wenig neu diese Behauptung im allgemeinen
ist, so wenig neue Einzeltatsachen enthält der Auf-
satz, der sich trotz des gleichmäßig durchklingenden
Grundtons der Gehässigkeit als knappe und geist-
reiche Skizze deutscher Kunstgeschichte des frühen
Mittelalters gar nicht übel liest. Abgesehen von
einigen wenig geschmackvollen Anspielungen auf zeit-
genössische Ereignisse, verläßt dieser temperamentvolle
Angriff eigentlich nur durch die stillschweigende —
und gelegentlich auch ausdrückliche — Unterstellung,
als würden die vorgebrachten Tatsachen von der ernsten
deutschen Forschung verkannt oder gar verschleiert,
die Grenzen des Anstandes. Es ist ein Aufsatz ohne
weitere Bedeutung; bedauerlich ist nur — ich wieder-
hole dies — daß er mit aufgeregter Beflissenheit deutsch
veröffentlicht wurde. Erst dadurch, daß sich in Deutsch-
land Leute finden, die noch dazu im Namen der
Wissenschaft dazu befugt sein wollen, die deutsche
Kunst gegen einen solchen Angriff zu verteidigen, er-
hält dieser Sinn und Schärfe; erst durch das auf-
fallende Dementi wird zugegeben, daß er eine empfind-
liche Stelle traf, während er in Wirklichkeit aus innerer
Schwäche die deutsche Kunst überhaupt nicht berührt.
Möchten wir doch endlich aufgeben, mit ideologischer
Skrupelhaftigkeit, für die uns doch niemand Dank
weiß, den Nachweis zu führen, daß man uns Unrecht
tut und daß wir besser sind, als die Feinde behaupten;
und lieber von den Engländern den männlicheren
Grundsatz lernen: Recht oder unrecht, mein Land!
Male will den Nachweis führen, daß es in der
deutschen Kunst — zunächst des Mittelalters, und
später werde es sich wohl auch nicht anders ver-
halten — kein Motiv, keinen Gedanken gebe, der
nicht irgendwie in eine fremde Kunst zurückverfolgt
werden könne; daher sei die deutsche Kunst jeder
schöpferischen Kraft bar und infolgedessen minder-
wertig. Diese ganze Methode ist an sich unfruchtbar;
sie gleicht jenen einst als höchste Wissenschaftlichkeit
geltenden Nachspürungen, woher in einem Kunst-
werk diese oder jene Einzelheit stamme oder welche
Einflüsse bei einem Künstler nachweisbar seien,
Fragen, deren bloß sekundäre Bedeutung uns heute
nicht zweifelhaft ist. Keine Kulturentwicklung könnte
einer solchen, ein organisches Ganzes in unzusammen-
hängende Einzelelemente zerlegenden Untersuchung
standhalten. Was bleibt von der Reformation, was
bleibt sogar vom Christentum übrig, wenn man jede
Idee ausscheidet, die sich in irgendwelche andere
Kreise verfolgen läßt; was bleibt von Calvins Tat, von
Shakespeares Werk, wenn alles abgetrennt wird, wozu
Verwandtes irgendwo und irgendwann bereits vorlag!
Ganz ebenso läßt sich auch in der bildenden Kunst,
die organisch wächst und von allem lebt, was ihren
Geist nährt, keine Einzelerscheinung von der Umgebung
völlig isolieren; kein individuelles Werk, kein Künst-
ler, kein völkisches Kunstganzes. Jedes — und sei
es das reichste und schöpferischeste — löst sich,
unter den grellen Lichtschein solcher Analyse gebracht,
in Elemente, die man nur genügend weit verfolgen
muß, um endlich bestimmt in einen fremden Kunst-
kreis zu gelangen; auch die französische Kunst zer-
stäubt bei solcher Zergliederung, auch von der großen
Kunst der Griechen bleibt, wenn wir all ihren Motiven
so weit nachgehen wie wir irgend können, nichts als
ein Haufen zerrissener Giedmaßen, die hierhin und dort-
hin gehören und sich nur zufällig hier zusammenfanden.
Aber daß sie sich und wie sie sich zusammenfanden,