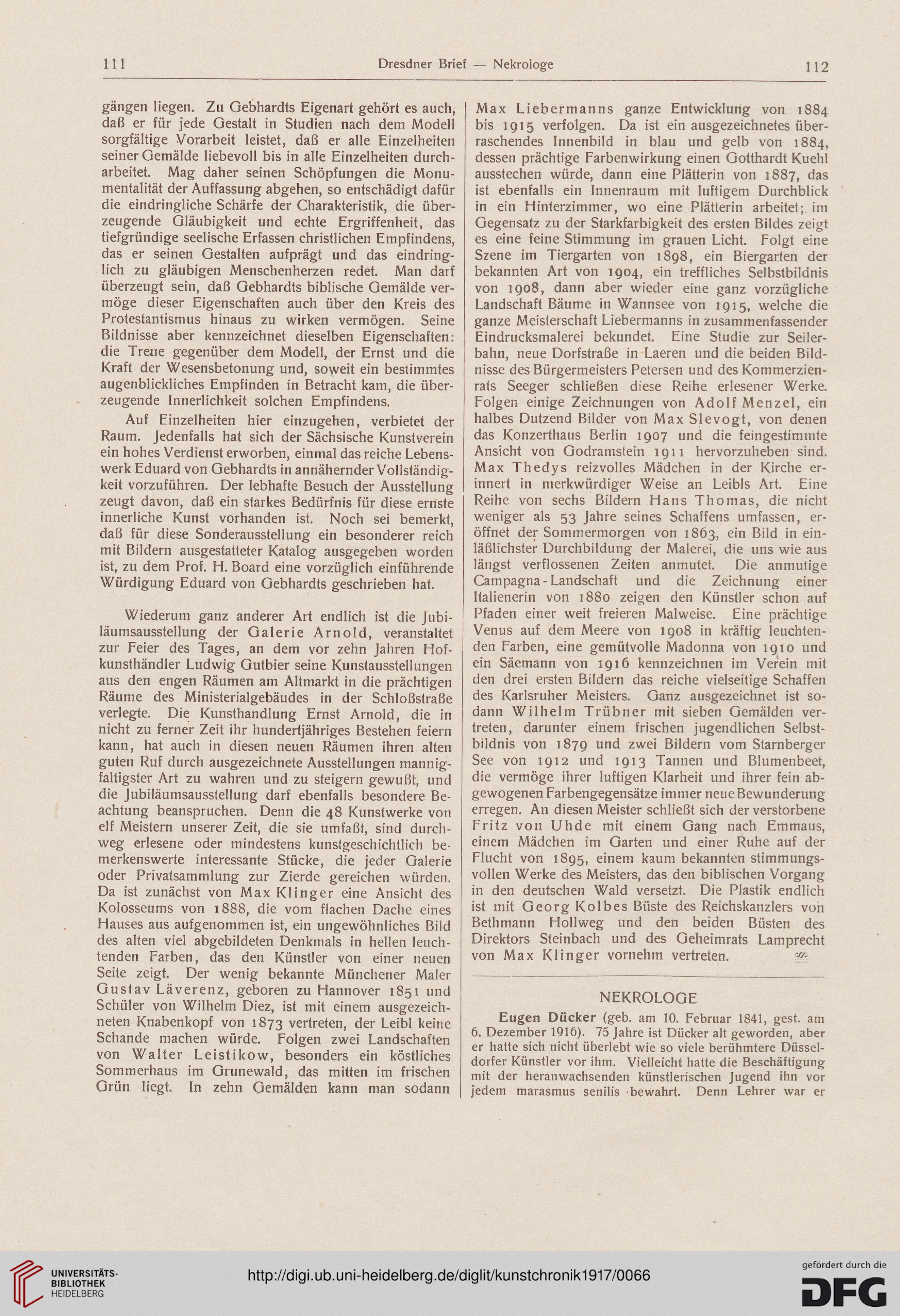111
Dresdner Brief — Nekrologe
112
gängen liegen. Zu Gebhardts Eigenart gehört es auch,
daß er für jede Gestalt in Studien nach dem Modell
sorgfältige Vorarbeit leistet, daß er alle Einzelheiten
seiner Gemälde liebevoll bis in alle Einzelheiten durch-
arbeitet. Mag daher seinen Schöpfungen die Monu-
mentalität der Auffassung abgehen, so entschädigt dafür
die eindringliche Schärfe der Charakteristik, die über-
zeugende Gläubigkeit und echte Ergriffenheit, das
tiefgründige seelische Erfassen christlichen Empfindens,
das er seinen Gestalten aufprägt und das eindring-
lich zu gläubigen Menschenherzen redet. Man darf
überzeugt sein, daß Gebhardts biblische Gemälde ver-
möge dieser Eigenschaften auch über den Kreis des
Protestantismus hinaus zu wirken vermögen. Seine
Bildnisse aber kennzeichnet dieselben Eigenschaften:
die Treue gegenüber dem Modell, der Ernst und die
Kraft der Wesensbetonung und, soweit ein bestimmtes
augenblickliches Empfinden in Betracht kam, die über-
zeugende Innerlichkeit solchen Empfindens.
Auf Einzelheiten hier einzugehen, verbietet der
Raum. Jedenfalls hat sich der Sächsische Kunstverein
ein hohes Verdienst erworben, einmal das reiche Lebens-
werk Eduard von Gebhardts in annähernder Vollständig-
keit vorzuführen. Der lebhafte Besuch der Ausstellung
zeugt davon, daß ein starkes Bedürfnis für diese ernste
innerliche Kunst vorhanden ist. Noch sei bemerkt,
daß für diese Sonderausstellung ein besonderer reich
mit Bildern ausgestatteter Katalog ausgegeben worden
ist, zu dem Prof. H. Board eine vorzüglich einführende
Würdigung Eduard von Gebhardts geschrieben hat.
Wiederum ganz anderer Art endlich ist die Jubi-
läumsausstellung der Galerie Arnold, veranstaltet
zur Feier des Tages, an dem vor zehn Jahren Hof-
kunsthändler Ludwig Gutbier seine Kunstausstellungen
aus den engen Räumen am Altmarkt in die prächtigen
Räume des Ministerialgebäudes in der Schloßstraße
verlegte. Die Kunsthandlung Ernst Arnold, die in
nicht zu ferner Zeit ihr hundertjähriges Bestehen feiern
kann, hat auch in diesen neuen Räumen ihren alten
guten Ruf durch ausgezeichnete Ausstellungen mannig-
faltigster Art zu wahren und zu steigern gewußt, und
die Jubiläumsausstellung darf ebenfalls besondere Be-
achtung beanspruchen. Denn die 48 Kunstwerke von
elf Meistern unserer Zeit, die sie umfaßt, sind durch-
weg erlesene oder mindestens kunstgeschichtlich be-
merkenswerte interessante Stücke, die jeder Galerie
oder Privatsammlung zur Zierde gereichen würden.
Da ist zunächst von Max Klinger eine Ansicht des
Kolosseums von 1888, die vom flachen Dache eines
Hauses aus aufgenommen ist, ein ungewöhnliches Bild
des alten viel abgebildeten Denkmals in hellen leuch-
tenden Farben, das den Künstler von einer neuen
Seite zeigt. Der wenig bekannte Münchener Maler
Gustav Läverenz, geboren zu Hannover 1851 und
Schüler von Wilhelm Diez, ist mit einem ausgezeich-
neten Knabenkopf von 1873 vertreten, der Leibi keine
Schande machen würde. Folgen zwei Landschaften
von Walter Leistikow, besonders ein köstliches
Sommerhaus im Grunewald, das mitten im frischen
Grün liegt. In zehn Gemälden kann man sodann
Max Liebermanns ganze Entwicklung von 1884
bis 1915 verfolgen. Da ist ein ausgezeichnetes über-
raschendes Innenbild in blau und gelb von 1884,
dessen prächtige Farbenwirkung einen Gotthardt Kuehl
ausstechen würde, dann eine Plätterin von 1887, das
ist ebenfalls ein Innenraum mit luftigem Durchblick
in ein Hinterzimmer, wo eine Plätterin arbeitet; im
Gegensatz zu der Starkfarbigkeit des ersten Bildes zeigt
es eine feine Stimmung im grauen Licht. Folgt eine
Szene im Tiergarten von 1898, ein Biergarten der
bekannten Art von 1904, ein treffliches Selbstbildnis
von 1908, dann aber wieder eine ganz vorzügliche
Landschaft Bäume in Wannsee von 1915, welche die
ganze Meisterschaft Liebermanns in zusammenfassender
Eindrucksmalerei bekundet. Eine Studie zur Seiler-
bahn, neue Dorfstraße in Laeren und die beiden Bild-
nisse des Bürgermeisters Petersen und des Kommerzien-
rats Seeger schließen diese Reihe erlesener Werke.
Folgen einige Zeichnungen von Adolf Menzel, ein
halbes Dutzend Bilder von Max Slevogt, von denen
das Konzerthaus Berlin 1907 und die feingestimmte
Ansicht von Godramstein 1911 hervorzuheben sind.
Max Thedys reizvolles Mädchen in der Kirche er-
innert in merkwürdiger Weise an Leibis Art. Eine
Reihe von sechs Bildern Hans Thomas, die nicht
weniger als 53 Jahre seines Schaffens umfassen, er-
öffnet der Sommermorgen von 1863, ein Bild in ein-
läßlichster Durchbildung der Malerei, die uns wie aus
längst verflossenen Zeiten anmutet. Die anmutige
Campagna-Landschaft und die Zeichnung einer
Italienerin von 1880 zeigen den Künstler schon auf
Pfaden einer weit freieren Malweise. Eine prächtige
Venus auf dem Meere von 1908 in kräftig leuchten-
den Farben, eine gemütvolle Madonna von 1910 und
ein Säemann von 1916 kennzeichnen im Verein mit
den drei ersten Bildern das reiche vielseitige Schaffen
des Karlsruher Meisters. Ganz ausgezeichnet ist so-
dann Wilhelm Trübner mit sieben Gemälden ver-
treten, darunter einem frischen jugendlichen Selbst-
bildnis von 1879 ur|d zwei Bildern vom Starnberger
See von 1912 und 1913 Tannen und Blumenbeet,
die vermöge ihrer luftigen Klarheit und ihrer fein ab-
gewogenen Farbengegensätze immer neue Bewunderung
erregen. An diesen Meister schließt sich der verstorbene
Fritz von Uhde mit einem Gang nach Emmaus,
einem Mädchen im Garten und einer Ruhe auf der
Flucht von 1895, einem kaum bekannten stimmungs-
vollen Werke des Meisters, das den biblischen Vorgang
in den deutschen Wald versetzt. Die Plastik endlich
ist mit Georg Kolbes Büste des Reichskanzlers von
Bethmann Hollweg und den beiden Büsten des
Direktors Steinbach und des Geheimrats Lamprecht
von Max Klinger vornehm vertreten.
NEKROLOGE
Eugen Dücker (geb. am 10. Februar 1841, gest. am
6. Dezember 1916). 75 Jahre ist Dücker alt geworden, aber
er hatte sich nicht überlebt wie so viele berühmtere Düssel-
dorfer Künstler vor ihm. Vielleicht hatte die Beschäftigung
mit der heranwachsenden künstlerischen Jugend ihn vor
jedem marasmus senilis bewahrt. Denn Lehrer war er
Dresdner Brief — Nekrologe
112
gängen liegen. Zu Gebhardts Eigenart gehört es auch,
daß er für jede Gestalt in Studien nach dem Modell
sorgfältige Vorarbeit leistet, daß er alle Einzelheiten
seiner Gemälde liebevoll bis in alle Einzelheiten durch-
arbeitet. Mag daher seinen Schöpfungen die Monu-
mentalität der Auffassung abgehen, so entschädigt dafür
die eindringliche Schärfe der Charakteristik, die über-
zeugende Gläubigkeit und echte Ergriffenheit, das
tiefgründige seelische Erfassen christlichen Empfindens,
das er seinen Gestalten aufprägt und das eindring-
lich zu gläubigen Menschenherzen redet. Man darf
überzeugt sein, daß Gebhardts biblische Gemälde ver-
möge dieser Eigenschaften auch über den Kreis des
Protestantismus hinaus zu wirken vermögen. Seine
Bildnisse aber kennzeichnet dieselben Eigenschaften:
die Treue gegenüber dem Modell, der Ernst und die
Kraft der Wesensbetonung und, soweit ein bestimmtes
augenblickliches Empfinden in Betracht kam, die über-
zeugende Innerlichkeit solchen Empfindens.
Auf Einzelheiten hier einzugehen, verbietet der
Raum. Jedenfalls hat sich der Sächsische Kunstverein
ein hohes Verdienst erworben, einmal das reiche Lebens-
werk Eduard von Gebhardts in annähernder Vollständig-
keit vorzuführen. Der lebhafte Besuch der Ausstellung
zeugt davon, daß ein starkes Bedürfnis für diese ernste
innerliche Kunst vorhanden ist. Noch sei bemerkt,
daß für diese Sonderausstellung ein besonderer reich
mit Bildern ausgestatteter Katalog ausgegeben worden
ist, zu dem Prof. H. Board eine vorzüglich einführende
Würdigung Eduard von Gebhardts geschrieben hat.
Wiederum ganz anderer Art endlich ist die Jubi-
läumsausstellung der Galerie Arnold, veranstaltet
zur Feier des Tages, an dem vor zehn Jahren Hof-
kunsthändler Ludwig Gutbier seine Kunstausstellungen
aus den engen Räumen am Altmarkt in die prächtigen
Räume des Ministerialgebäudes in der Schloßstraße
verlegte. Die Kunsthandlung Ernst Arnold, die in
nicht zu ferner Zeit ihr hundertjähriges Bestehen feiern
kann, hat auch in diesen neuen Räumen ihren alten
guten Ruf durch ausgezeichnete Ausstellungen mannig-
faltigster Art zu wahren und zu steigern gewußt, und
die Jubiläumsausstellung darf ebenfalls besondere Be-
achtung beanspruchen. Denn die 48 Kunstwerke von
elf Meistern unserer Zeit, die sie umfaßt, sind durch-
weg erlesene oder mindestens kunstgeschichtlich be-
merkenswerte interessante Stücke, die jeder Galerie
oder Privatsammlung zur Zierde gereichen würden.
Da ist zunächst von Max Klinger eine Ansicht des
Kolosseums von 1888, die vom flachen Dache eines
Hauses aus aufgenommen ist, ein ungewöhnliches Bild
des alten viel abgebildeten Denkmals in hellen leuch-
tenden Farben, das den Künstler von einer neuen
Seite zeigt. Der wenig bekannte Münchener Maler
Gustav Läverenz, geboren zu Hannover 1851 und
Schüler von Wilhelm Diez, ist mit einem ausgezeich-
neten Knabenkopf von 1873 vertreten, der Leibi keine
Schande machen würde. Folgen zwei Landschaften
von Walter Leistikow, besonders ein köstliches
Sommerhaus im Grunewald, das mitten im frischen
Grün liegt. In zehn Gemälden kann man sodann
Max Liebermanns ganze Entwicklung von 1884
bis 1915 verfolgen. Da ist ein ausgezeichnetes über-
raschendes Innenbild in blau und gelb von 1884,
dessen prächtige Farbenwirkung einen Gotthardt Kuehl
ausstechen würde, dann eine Plätterin von 1887, das
ist ebenfalls ein Innenraum mit luftigem Durchblick
in ein Hinterzimmer, wo eine Plätterin arbeitet; im
Gegensatz zu der Starkfarbigkeit des ersten Bildes zeigt
es eine feine Stimmung im grauen Licht. Folgt eine
Szene im Tiergarten von 1898, ein Biergarten der
bekannten Art von 1904, ein treffliches Selbstbildnis
von 1908, dann aber wieder eine ganz vorzügliche
Landschaft Bäume in Wannsee von 1915, welche die
ganze Meisterschaft Liebermanns in zusammenfassender
Eindrucksmalerei bekundet. Eine Studie zur Seiler-
bahn, neue Dorfstraße in Laeren und die beiden Bild-
nisse des Bürgermeisters Petersen und des Kommerzien-
rats Seeger schließen diese Reihe erlesener Werke.
Folgen einige Zeichnungen von Adolf Menzel, ein
halbes Dutzend Bilder von Max Slevogt, von denen
das Konzerthaus Berlin 1907 und die feingestimmte
Ansicht von Godramstein 1911 hervorzuheben sind.
Max Thedys reizvolles Mädchen in der Kirche er-
innert in merkwürdiger Weise an Leibis Art. Eine
Reihe von sechs Bildern Hans Thomas, die nicht
weniger als 53 Jahre seines Schaffens umfassen, er-
öffnet der Sommermorgen von 1863, ein Bild in ein-
läßlichster Durchbildung der Malerei, die uns wie aus
längst verflossenen Zeiten anmutet. Die anmutige
Campagna-Landschaft und die Zeichnung einer
Italienerin von 1880 zeigen den Künstler schon auf
Pfaden einer weit freieren Malweise. Eine prächtige
Venus auf dem Meere von 1908 in kräftig leuchten-
den Farben, eine gemütvolle Madonna von 1910 und
ein Säemann von 1916 kennzeichnen im Verein mit
den drei ersten Bildern das reiche vielseitige Schaffen
des Karlsruher Meisters. Ganz ausgezeichnet ist so-
dann Wilhelm Trübner mit sieben Gemälden ver-
treten, darunter einem frischen jugendlichen Selbst-
bildnis von 1879 ur|d zwei Bildern vom Starnberger
See von 1912 und 1913 Tannen und Blumenbeet,
die vermöge ihrer luftigen Klarheit und ihrer fein ab-
gewogenen Farbengegensätze immer neue Bewunderung
erregen. An diesen Meister schließt sich der verstorbene
Fritz von Uhde mit einem Gang nach Emmaus,
einem Mädchen im Garten und einer Ruhe auf der
Flucht von 1895, einem kaum bekannten stimmungs-
vollen Werke des Meisters, das den biblischen Vorgang
in den deutschen Wald versetzt. Die Plastik endlich
ist mit Georg Kolbes Büste des Reichskanzlers von
Bethmann Hollweg und den beiden Büsten des
Direktors Steinbach und des Geheimrats Lamprecht
von Max Klinger vornehm vertreten.
NEKROLOGE
Eugen Dücker (geb. am 10. Februar 1841, gest. am
6. Dezember 1916). 75 Jahre ist Dücker alt geworden, aber
er hatte sich nicht überlebt wie so viele berühmtere Düssel-
dorfer Künstler vor ihm. Vielleicht hatte die Beschäftigung
mit der heranwachsenden künstlerischen Jugend ihn vor
jedem marasmus senilis bewahrt. Denn Lehrer war er