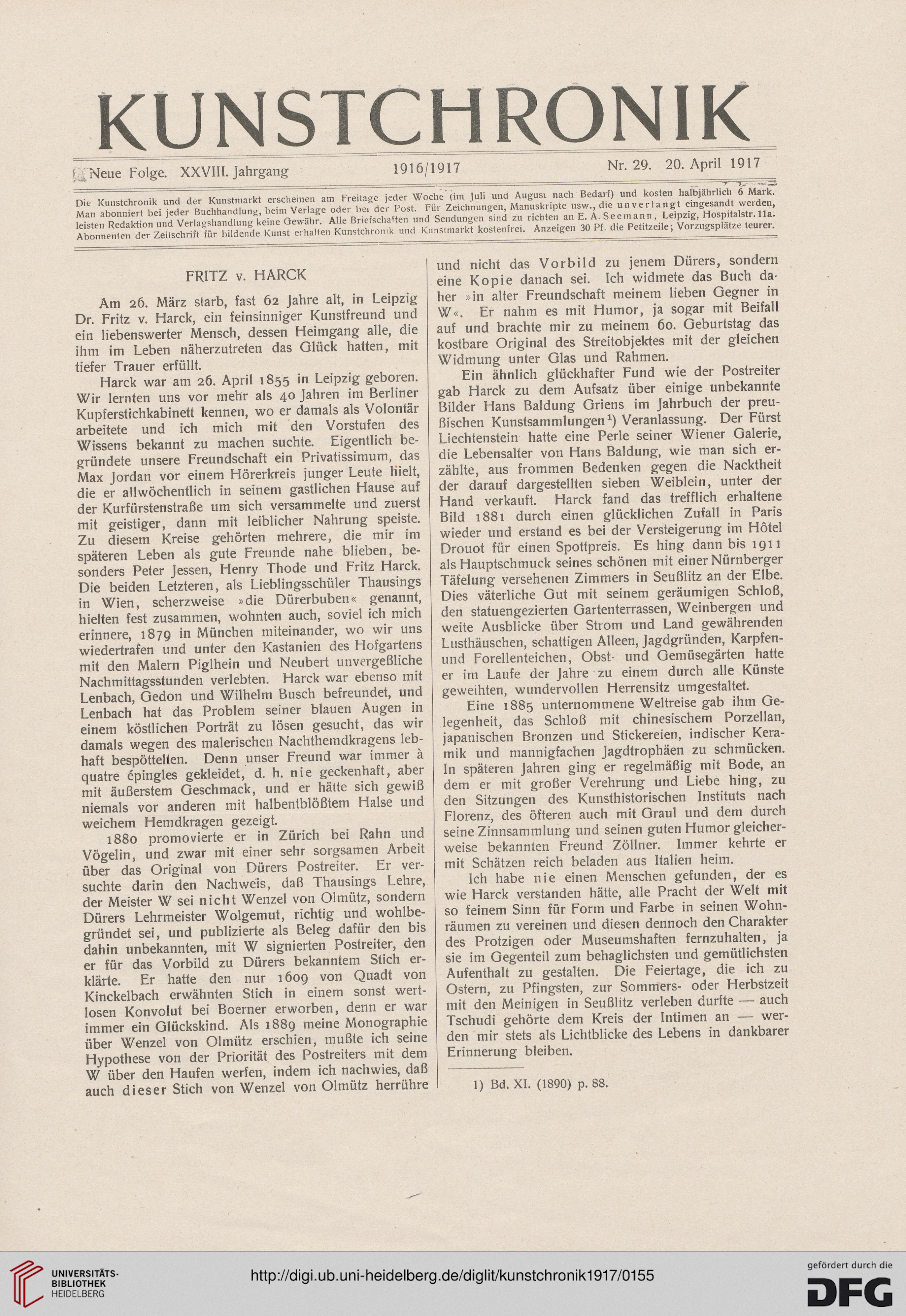KU N STCHRONIK
l'i Neue Folge. XXVIII. Jahrgang 1916/1917 Nr. 29. 20. April 1917
Die Kunstchronik und der Kunstmarkt erscheinen am Freitage jeder Woche (im Juli und Augusi nach Bedarf) und kosten halbjährlich 6* Mark.
Man abonniert bei jeder Buchhandlung, beim Verlage oder bei der Post. Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden,
leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Hospitalstr. IIa.
Abonnenlen der Zeitschrift für bildende Kunst erhalten Kunstchronik und Kunstmarkt kostenfrei. Anzeigen 30 Pf. die Petitzeile; Vorzugsplätze teurer.
FRITZ v. HARCK
Am 26. März starb, fast 62 Jahre alt, in Leipzig
Dr. Fritz v. Harck, ein feinsinniger Kunstfreund und
ein liebenswerter Mensch, dessen Heimgang alle, die
ihm im Leben näherzutreten das Glück hatten, mit
tiefer Trauer erfüllt.
Harck war am 26. April 1855 in Leipzig geboren.
Wir lernten uns vor mehr als 40 Jahren im Berliner
Kupferstichkabinett kennen, wo er damals als Volontär
arbeitete und ich mich mit den Vorstufen des
Wissens bekannt zu machen suchte. Eigentlich be-
gründete unsere Freundschaft ein Privatissimum, das
Max Jordan vor einem Hörerkreis junger Leute Hielt,
die er allwöchentlich in seinem gastlichen Hause auf
der Kurfürstenstraße um sich versammelte und zuerst
mit geistiger, dann mit leiblicher Nahrung speiste.
Zu diesem Kreise gehörten mehrere, die mir im
späteren Leben als gute Freunde nahe blieben, be-
sonders Peter Jessen, Henry Thode und Fritz Harck.
Die beiden Letzteren, als Lieblingsschüler Thausings
in Wien, scherzweise »die Dürerbuben« genannt,
hielten fest zusammen, wohnten auch, soviel ich mich
erinnere, 1879 in München miteinander, wo wir uns
wiedertrafen und unter den Kastanien des Hofgartens
mit den Malern Piglhein und Neubert unvergeßliche
Nachmittagsstunden verlebten. Harck war ebenso mit
Lenbach, Oedon und Wilhelm Busch befreundet, und
Lenbach hat das Problem seiner blauen Augen in
einem köstlichen Porträt zu lösen gesucht, das wir
damals wegen des malerischen Nachthemdkragens leb-
haft bespöttelten. Denn unser Freund war immer ä
quatre epingles gekleidet, d. h. nie geckenhaft, aber
mit äußerstem Geschmack, und er hätte sich gewiß
niemals vor anderen mit halbentblößtem Halse und
weichem Hemdkragen gezeigt.
1880 promovierte er in Zürich bei Rahn und
Vögelin, und zwar mit einer sehr sorgsamen Arbeit
über das Original von Dürers Postreiter. Er ver-
suchte darin den Nachweis, daß Thausings Lehre,
der Meister W sei nicht Wenzel von Olmütz, sondern
Dürers Lehrmeister Wolgemut, richtig und wohlbe-
gründet sei, und publizierte als Beleg dafür den bis
dahin unbekannten, mit W signierten Postreiter, den
er für das Vorbild zu Dürers bekanntem Stich er-
klärte. Er hatte den nur 1609 von Quadt von
Kinckelbach erwähnten Stich in einem sonst wert-
losen Konvolut bei Boerner erworben, denn er war
immer ein Glückskind. Als 1889 meine Monographie
über Wenzel von Olmütz erschien, mußte ich seine
Hypothese von der Priorität des Postreiters mit dem
W über den Haufen werfen, indem ich nachwies, daß
auch dieser Stich von Wenzel von Olmütz herrühre
und nicht das Vorbild zu jenem Dürers, sondern
eine Kopie danach sei. Ich widmete das Buch da-
her »in alter Freundschaft meinem lieben Gegner in
W«. Er nahm es mit Humor, ja sogar mit Beifall
auf und brachte mir zu meinem 60. Geburtstag das
kostbare Original des Streitobjektes mit der gleichen
Widmung unter Glas und Rahmen.
Ein ähnlich glückhafter Fund wie der Postreiter
gab Harck zu dem Aufsatz über einige unbekannte
Bilder Hans Baidung Griens im Jahrbuch der preu-
ßischen Kunstsammlungen1) Veranlassung. Der Fürst
Liechtenstein hatte eine Perle seiner Wiener Galerie,
die Lebensalter von Hans Baidung, wie man sich er-
zählte, aus frommen Bedenken gegen die Nacktheit
der darauf dargestellten sieben Weiblein, unter der
Hand verkauft. Harck fand das trefflich erhaltene
Bild 1881 durch einen glücklichen Zufall in Paris
wieder und erstand es bei der Versteigerung im Hotel
Drouot für einen Spottpreis. Es hing dann bis 1911
als Hauptschmuck seines schönen mit einer Nürnberger
Täfelung versehenen Zimmers in Seußlitz an der Elbe.
Dies väterliche Gut mit seinem geräumigen Schloß,
den statuengezierten Gartenterrassen, Weinbergen und
weite Ausblicke über Strom und Land gewährenden
Lusthäuschen, schattigen Alleen, Jagdgründen, Karpfen-
und Forellenteichen, Obst- und Gemüsegärten hatte
er im Laufe der Jahre zu einem durch alle Künste
geweihten, wundervollen Herrensitz umgestaltet.
Eine 1885 unternommene Weltreise gab ihm Ge-
legenheit, das Schloß mit chinesischem Porzellan,
japanischen Bronzen und Stickereien, indischer Kera-
mik und mannigfachen Jagdtrophäen zu schmücken.
In späteren Jahren ging er regelmäßig mit Bode, an
dem er mit großer Verehrung und Liebe hing, zu
den Sitzungen des Kunsthistorischen Instituts nach
Florenz, des öfteren auch mit Graul und dem durch
seine Zinnsammlung und seinen guten Humor gleicher-
weise bekannten Freund Zöllner. Immer kehrte er
mit Schätzen reich beladen aus Italien heim.
Ich habe nie einen Menschen gefunden, der es
wie Harck verstanden hätte, alle Pracht der Welt mit
so feinem Sinn für Form und Farbe in seinen Wohn-
räumen zu vereinen und diesen dennoch den Charakter
des Protzigen oder Museumshaften fernzuhalten, ja
sie im Gegenteil zum behaglichsten und gemütlichsten
Aufenthalt zu gestalten. Die Feiertage, die ich zu
Ostern, zu Pfingsten, zur Sommers- oder Herbstzeit
mit den Meinigen in Seußlitz verleben durfte — auch
Tschudi gehörte dem Kreis der Intimen an — wer-
den mir stets als Lichtblicke des Lebens in dankbarer
Erinnerung bleiben.
1) Bd. XI. (1890) p. 88.
l'i Neue Folge. XXVIII. Jahrgang 1916/1917 Nr. 29. 20. April 1917
Die Kunstchronik und der Kunstmarkt erscheinen am Freitage jeder Woche (im Juli und Augusi nach Bedarf) und kosten halbjährlich 6* Mark.
Man abonniert bei jeder Buchhandlung, beim Verlage oder bei der Post. Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden,
leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Hospitalstr. IIa.
Abonnenlen der Zeitschrift für bildende Kunst erhalten Kunstchronik und Kunstmarkt kostenfrei. Anzeigen 30 Pf. die Petitzeile; Vorzugsplätze teurer.
FRITZ v. HARCK
Am 26. März starb, fast 62 Jahre alt, in Leipzig
Dr. Fritz v. Harck, ein feinsinniger Kunstfreund und
ein liebenswerter Mensch, dessen Heimgang alle, die
ihm im Leben näherzutreten das Glück hatten, mit
tiefer Trauer erfüllt.
Harck war am 26. April 1855 in Leipzig geboren.
Wir lernten uns vor mehr als 40 Jahren im Berliner
Kupferstichkabinett kennen, wo er damals als Volontär
arbeitete und ich mich mit den Vorstufen des
Wissens bekannt zu machen suchte. Eigentlich be-
gründete unsere Freundschaft ein Privatissimum, das
Max Jordan vor einem Hörerkreis junger Leute Hielt,
die er allwöchentlich in seinem gastlichen Hause auf
der Kurfürstenstraße um sich versammelte und zuerst
mit geistiger, dann mit leiblicher Nahrung speiste.
Zu diesem Kreise gehörten mehrere, die mir im
späteren Leben als gute Freunde nahe blieben, be-
sonders Peter Jessen, Henry Thode und Fritz Harck.
Die beiden Letzteren, als Lieblingsschüler Thausings
in Wien, scherzweise »die Dürerbuben« genannt,
hielten fest zusammen, wohnten auch, soviel ich mich
erinnere, 1879 in München miteinander, wo wir uns
wiedertrafen und unter den Kastanien des Hofgartens
mit den Malern Piglhein und Neubert unvergeßliche
Nachmittagsstunden verlebten. Harck war ebenso mit
Lenbach, Oedon und Wilhelm Busch befreundet, und
Lenbach hat das Problem seiner blauen Augen in
einem köstlichen Porträt zu lösen gesucht, das wir
damals wegen des malerischen Nachthemdkragens leb-
haft bespöttelten. Denn unser Freund war immer ä
quatre epingles gekleidet, d. h. nie geckenhaft, aber
mit äußerstem Geschmack, und er hätte sich gewiß
niemals vor anderen mit halbentblößtem Halse und
weichem Hemdkragen gezeigt.
1880 promovierte er in Zürich bei Rahn und
Vögelin, und zwar mit einer sehr sorgsamen Arbeit
über das Original von Dürers Postreiter. Er ver-
suchte darin den Nachweis, daß Thausings Lehre,
der Meister W sei nicht Wenzel von Olmütz, sondern
Dürers Lehrmeister Wolgemut, richtig und wohlbe-
gründet sei, und publizierte als Beleg dafür den bis
dahin unbekannten, mit W signierten Postreiter, den
er für das Vorbild zu Dürers bekanntem Stich er-
klärte. Er hatte den nur 1609 von Quadt von
Kinckelbach erwähnten Stich in einem sonst wert-
losen Konvolut bei Boerner erworben, denn er war
immer ein Glückskind. Als 1889 meine Monographie
über Wenzel von Olmütz erschien, mußte ich seine
Hypothese von der Priorität des Postreiters mit dem
W über den Haufen werfen, indem ich nachwies, daß
auch dieser Stich von Wenzel von Olmütz herrühre
und nicht das Vorbild zu jenem Dürers, sondern
eine Kopie danach sei. Ich widmete das Buch da-
her »in alter Freundschaft meinem lieben Gegner in
W«. Er nahm es mit Humor, ja sogar mit Beifall
auf und brachte mir zu meinem 60. Geburtstag das
kostbare Original des Streitobjektes mit der gleichen
Widmung unter Glas und Rahmen.
Ein ähnlich glückhafter Fund wie der Postreiter
gab Harck zu dem Aufsatz über einige unbekannte
Bilder Hans Baidung Griens im Jahrbuch der preu-
ßischen Kunstsammlungen1) Veranlassung. Der Fürst
Liechtenstein hatte eine Perle seiner Wiener Galerie,
die Lebensalter von Hans Baidung, wie man sich er-
zählte, aus frommen Bedenken gegen die Nacktheit
der darauf dargestellten sieben Weiblein, unter der
Hand verkauft. Harck fand das trefflich erhaltene
Bild 1881 durch einen glücklichen Zufall in Paris
wieder und erstand es bei der Versteigerung im Hotel
Drouot für einen Spottpreis. Es hing dann bis 1911
als Hauptschmuck seines schönen mit einer Nürnberger
Täfelung versehenen Zimmers in Seußlitz an der Elbe.
Dies väterliche Gut mit seinem geräumigen Schloß,
den statuengezierten Gartenterrassen, Weinbergen und
weite Ausblicke über Strom und Land gewährenden
Lusthäuschen, schattigen Alleen, Jagdgründen, Karpfen-
und Forellenteichen, Obst- und Gemüsegärten hatte
er im Laufe der Jahre zu einem durch alle Künste
geweihten, wundervollen Herrensitz umgestaltet.
Eine 1885 unternommene Weltreise gab ihm Ge-
legenheit, das Schloß mit chinesischem Porzellan,
japanischen Bronzen und Stickereien, indischer Kera-
mik und mannigfachen Jagdtrophäen zu schmücken.
In späteren Jahren ging er regelmäßig mit Bode, an
dem er mit großer Verehrung und Liebe hing, zu
den Sitzungen des Kunsthistorischen Instituts nach
Florenz, des öfteren auch mit Graul und dem durch
seine Zinnsammlung und seinen guten Humor gleicher-
weise bekannten Freund Zöllner. Immer kehrte er
mit Schätzen reich beladen aus Italien heim.
Ich habe nie einen Menschen gefunden, der es
wie Harck verstanden hätte, alle Pracht der Welt mit
so feinem Sinn für Form und Farbe in seinen Wohn-
räumen zu vereinen und diesen dennoch den Charakter
des Protzigen oder Museumshaften fernzuhalten, ja
sie im Gegenteil zum behaglichsten und gemütlichsten
Aufenthalt zu gestalten. Die Feiertage, die ich zu
Ostern, zu Pfingsten, zur Sommers- oder Herbstzeit
mit den Meinigen in Seußlitz verleben durfte — auch
Tschudi gehörte dem Kreis der Intimen an — wer-
den mir stets als Lichtblicke des Lebens in dankbarer
Erinnerung bleiben.
1) Bd. XI. (1890) p. 88.