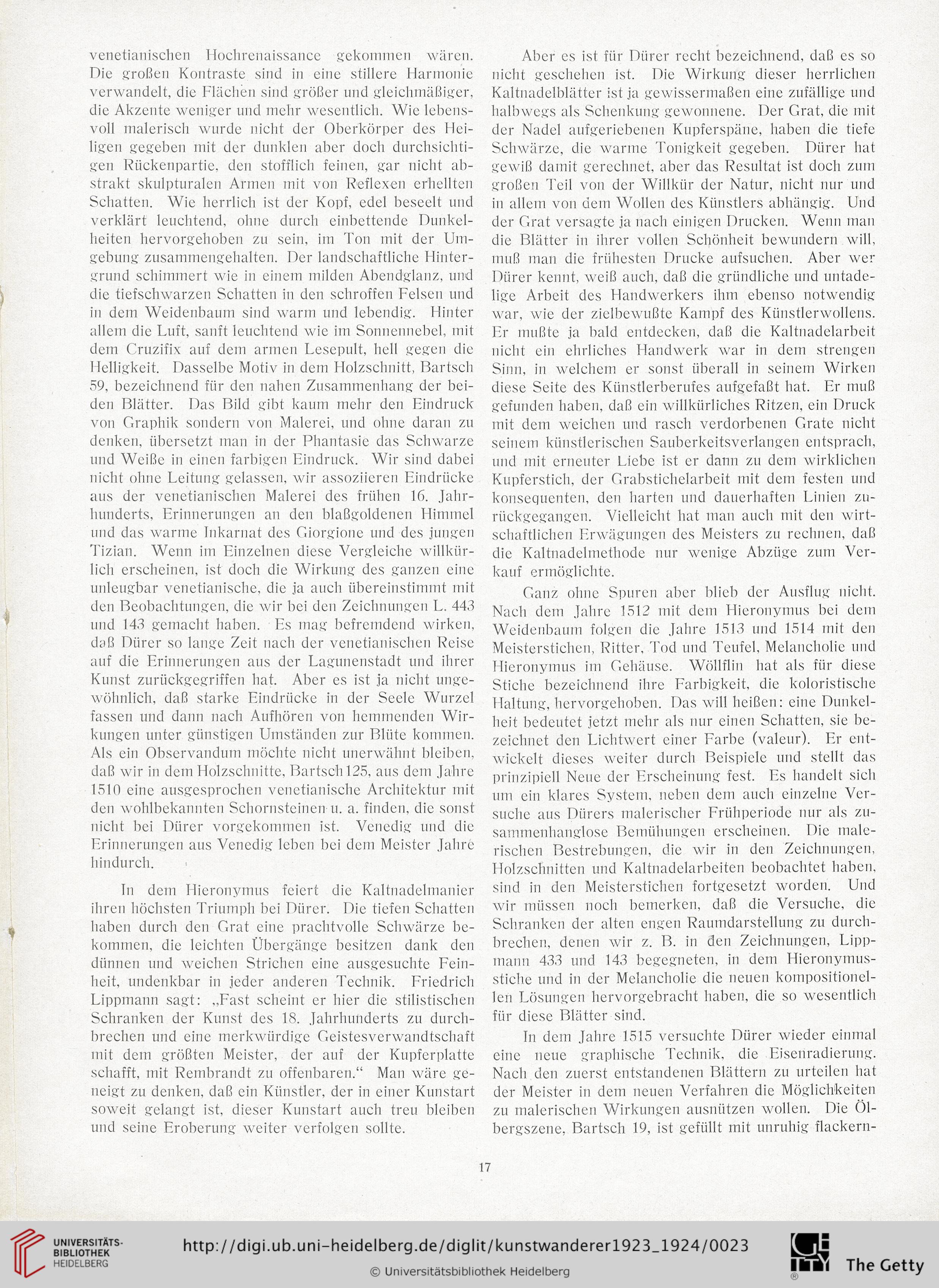venetianischen Hochrenaissance gekommen wären.
Die großen Kontraste sind in eine stillere Harmonie
verwandelt, die Flächen sind größer und gleichmäßiger,
die Akzente weniger und mehr wesentlich. Wie lebens-
voll malerisch wurde nicht der Oberkörper des Hei-
ligen gegeben mit dcr dunklen aber doch durchsichti-
gen Rückenpartie, den stofflich feinen, gar nicht ab-
strakt skulpturalen Armen mit von Reflexen erhellten
Schatten. Wie herrlich ist der Kopf, edel beseelt und
verklärt leuchtend, ohne durcli einbettende Dunkel-
lieiten hervorgehoben zu sein, im Ton mit der Um-
gebung zusammengehalten. Der landschaftliche Hinter-
grund schimmert wie in einem milden Abendglanz, und
die tiefschwarzen Schatten in den schroffen Felsen und
in dem Weidenbaum sind warm und lebendig. Hinter
allem die Luft, sanft leuchtend wie im Sonnennebel, mit
dem Cruzifix auf dem armen Lesepult, hell gegen die
Helligkeit. Dasselbe Motiv in dem Holzschnitt, Bartsch
59, bezeichnend für den nahen Zusammenhang der bei-
den Blätter. Das Bild gibt kaum mehr den Eindruck
von Graphik sondern von Malerei, und ohne daran zu
denken, übersetzt man in der Phantasie das Schwarze
und Weiße in einen farbigen Eindruck. Wir sind dabei
nicht ohne Leitung gelassen, wir assoziieren Eindrücke
aus der venetianischen Malerei des friihen 16. Jahr-
hunderts, Erinnerungen an den blaßgoldenen Himmel
und das warme Inkarnat des Giorgione und des jungen
Tizian. Wenn im Einzelnen diese Vergleiche willkür-
lich erscheinen, ist doch die Wirkung des ganzen eine
unleugbar venetianische, die ja auch iibereinstimmt mit
den Beobachtungen, die wir bei den Zeichnungen L. 443
und 143 gemacht haben. Es mag befremdcnd wirken,
daß Diirer so lange Zeit nach der venetianischen Reise
auf die Erinnerungen aus der Lagunenstadt und ihrer
Kunst zurückgegriffen hat. Aber es ist ja nicht unge-
wöhnlich, daß starke Eindriicke in der Seelc Wurzel
fassen und dann nach Aufhören von hemmenden Wir-
kungen unter giinstigen Umständen zur Bliite kommen.
Als ein Observandum möchte nicht unerwähnt bleiben,
daß wir in dem Holzschnitte, Bartsch125, aus dem Jahre
1510 eine ausgesprochen venetianische Architektur mit
den wohlbekannten Schornsteinen u. a. finden, die sonst
nicht bei Diirer vorgekommen ist. Venedig und die
Erinncrungen aus Venedig leben bei dem Meister Jahre
hindurch.
In dem IJieronymus feicrt die Kaltnadelmanier
ihren höchsten Triumph bei Dürer. Die tiefen Schatten
haben durch den Grat eine prachtvolle Schwärze be-
kommen, die leichten Übergänge besitzen dank den
dünnen und weichen Strichen eine ausgesuchte Fein-
heit, undenkbar in jeder anderen Technik. Friedrich
Lippmann sagt: „Fast scheint er hier die stilistischen
Schranken der Kunst des 18. Jahrhunderts zu durch-
brechen und eine merkwürdige Geistesverwandtscliaft
mit dem größten Meister, der auf der Kupferplatte
scliafft, mit Rembrandt zu offenbaren.“ Man wäre ge-
neigt zu denken, daß ein Künstler, der in einer Kunstart
soweit gelangt ist, dieser Kunstart auch treu bleiben
und seine Eroberung weiter verfolgen sollte.
Aber es ist für Dürer recht bezeichnend, daß es so
nicht geschehen ist. Die Wirkung dieser herrlichen
Kaltnadelblätter ist ja gewissermaßen eine zufällige und
halbwegs als Schenkung gewonnene. Der Grat, die mit
der Nadel aufgeriebenen Kupferspäne, haben die tiefe
Schwärze, die wanne Tonigkeit gegeben. Dürer hat
gewiß damit gerechnet, aber das Resultat ist doch zum
großen Teil von der Willkür der Natur, nicht nur und
in allem von dem Wollen des Künstlcrs abhängig. Und
der Grat versagte ja nach einigen Drucken. Wenu man
die Blätter in ihrer vollen Schönheit bewundern will,
muß man die frühesten Drucke aufsuchen. Aber wer
Dürer kennt, weiß auch, daß die gründliche und untade-
lige Arbeit des Handwerkers ihm ebenso notwendig
war, wie der zielbewußte Kampf des Künstlerwollens.
Er mußte ja bald entdecken, daß die Kaltnadelarbeit
nicht ein ehrliches Handwerk war in dem strengen
Sinn, in welchem er sonst überall in seinem Wirken
diese Seite des Künstlerberufes aufgefaßt hat. Er muß
gefunden haben, daß ein willkürliches Ritzen, ein Druck
mit dem weichen und rasch verdorbenen Grate nicht
seinem künstlerischen Saubcrkeitsverlangen entsprach,
und mit erneuter Liebe ist er dann zu dem wirklichen
Kupferstich, der Grabstichelarbeit mit dcm festen und
konsequenten, den harten und dauerhaften Linien zu-
rückgegangen. Vielleicht hat man auch mit den wirt-
schaftlichcn Erwägungen des Meisters zu rechnen, daß
die Kaltnadclmethode nur wenige Abzüge zum Ver-
kauf ermöglichte.
Ganz ohne Spuren aber blieb der Ausflug nicht.
Nacli dem Jahre 1512 mit dem Hieronymus bei dem
Weidenbaum folgen die Jahre 1513 und 1514 mit den
Meisterstichen, Ritter, Tod und Teufel, Melancholie und
Hieronymus im Gehäuse. Wöllflin hat als für diese
Stichc bezeichnend ihre Farbigkeit, die koloristische
Haltung, hervorgehoben. Das will heißen: eine Dunkel-
heit bcdeutet jetzt mehr als nur einen Schatten, sie be-
zeichnet den Lichtwert einer Farbe (valeur). Er ent-
wickelt dieses weiter durch Beispiele und stellt das
prinzipiell Neue dcr Erscheinung fest. Es handelt sicli
um ein klares System, neben dem auch einzelne Ver-
suche aus Dürers malerischer Frühperiode nur als zu-
sammenhanglose Bemühungen erscheinen. Die male-
rischen Bestrebungen, die wir in den Zeichnungen,
Holzschnitten und Kaltnadelarbeiten beobaclitet haben,
sind in den Meisterstichen fortgesetzt worden. Und
wir rnüssen noch bemerken, daß die Versuche, die
Schranken der alten engen Raumdarstellung zu durch-
brechen, denen wir z. B. in den Zeichnungen, Lipp-
mann 433 und 143 begegneten, in dem Hieronymus-
stiche und in der Melancholie die neuen kompositionel-
len Lösungen hervorgebracht haben, die so wesentlich
für diese Blätter sind.
In dcm Jahre 1515 versuchte Dürer wieder einmal
eine ncue graphische Technik, die Eiseriradierung.
Nach den zuerst entstandenen Blättern zu urteilen hat
der Meister in dem neuen Verfahren die Möglichkeiten
zu malerischen Wirkungen ausnützen wollen. Die Öl-
bergszene, Bartsch 19, ist gefüllt mit unruhig flackern-
Die großen Kontraste sind in eine stillere Harmonie
verwandelt, die Flächen sind größer und gleichmäßiger,
die Akzente weniger und mehr wesentlich. Wie lebens-
voll malerisch wurde nicht der Oberkörper des Hei-
ligen gegeben mit dcr dunklen aber doch durchsichti-
gen Rückenpartie, den stofflich feinen, gar nicht ab-
strakt skulpturalen Armen mit von Reflexen erhellten
Schatten. Wie herrlich ist der Kopf, edel beseelt und
verklärt leuchtend, ohne durcli einbettende Dunkel-
lieiten hervorgehoben zu sein, im Ton mit der Um-
gebung zusammengehalten. Der landschaftliche Hinter-
grund schimmert wie in einem milden Abendglanz, und
die tiefschwarzen Schatten in den schroffen Felsen und
in dem Weidenbaum sind warm und lebendig. Hinter
allem die Luft, sanft leuchtend wie im Sonnennebel, mit
dem Cruzifix auf dem armen Lesepult, hell gegen die
Helligkeit. Dasselbe Motiv in dem Holzschnitt, Bartsch
59, bezeichnend für den nahen Zusammenhang der bei-
den Blätter. Das Bild gibt kaum mehr den Eindruck
von Graphik sondern von Malerei, und ohne daran zu
denken, übersetzt man in der Phantasie das Schwarze
und Weiße in einen farbigen Eindruck. Wir sind dabei
nicht ohne Leitung gelassen, wir assoziieren Eindrücke
aus der venetianischen Malerei des friihen 16. Jahr-
hunderts, Erinnerungen an den blaßgoldenen Himmel
und das warme Inkarnat des Giorgione und des jungen
Tizian. Wenn im Einzelnen diese Vergleiche willkür-
lich erscheinen, ist doch die Wirkung des ganzen eine
unleugbar venetianische, die ja auch iibereinstimmt mit
den Beobachtungen, die wir bei den Zeichnungen L. 443
und 143 gemacht haben. Es mag befremdcnd wirken,
daß Diirer so lange Zeit nach der venetianischen Reise
auf die Erinnerungen aus der Lagunenstadt und ihrer
Kunst zurückgegriffen hat. Aber es ist ja nicht unge-
wöhnlich, daß starke Eindriicke in der Seelc Wurzel
fassen und dann nach Aufhören von hemmenden Wir-
kungen unter giinstigen Umständen zur Bliite kommen.
Als ein Observandum möchte nicht unerwähnt bleiben,
daß wir in dem Holzschnitte, Bartsch125, aus dem Jahre
1510 eine ausgesprochen venetianische Architektur mit
den wohlbekannten Schornsteinen u. a. finden, die sonst
nicht bei Diirer vorgekommen ist. Venedig und die
Erinncrungen aus Venedig leben bei dem Meister Jahre
hindurch.
In dem IJieronymus feicrt die Kaltnadelmanier
ihren höchsten Triumph bei Dürer. Die tiefen Schatten
haben durch den Grat eine prachtvolle Schwärze be-
kommen, die leichten Übergänge besitzen dank den
dünnen und weichen Strichen eine ausgesuchte Fein-
heit, undenkbar in jeder anderen Technik. Friedrich
Lippmann sagt: „Fast scheint er hier die stilistischen
Schranken der Kunst des 18. Jahrhunderts zu durch-
brechen und eine merkwürdige Geistesverwandtscliaft
mit dem größten Meister, der auf der Kupferplatte
scliafft, mit Rembrandt zu offenbaren.“ Man wäre ge-
neigt zu denken, daß ein Künstler, der in einer Kunstart
soweit gelangt ist, dieser Kunstart auch treu bleiben
und seine Eroberung weiter verfolgen sollte.
Aber es ist für Dürer recht bezeichnend, daß es so
nicht geschehen ist. Die Wirkung dieser herrlichen
Kaltnadelblätter ist ja gewissermaßen eine zufällige und
halbwegs als Schenkung gewonnene. Der Grat, die mit
der Nadel aufgeriebenen Kupferspäne, haben die tiefe
Schwärze, die wanne Tonigkeit gegeben. Dürer hat
gewiß damit gerechnet, aber das Resultat ist doch zum
großen Teil von der Willkür der Natur, nicht nur und
in allem von dem Wollen des Künstlcrs abhängig. Und
der Grat versagte ja nach einigen Drucken. Wenu man
die Blätter in ihrer vollen Schönheit bewundern will,
muß man die frühesten Drucke aufsuchen. Aber wer
Dürer kennt, weiß auch, daß die gründliche und untade-
lige Arbeit des Handwerkers ihm ebenso notwendig
war, wie der zielbewußte Kampf des Künstlerwollens.
Er mußte ja bald entdecken, daß die Kaltnadelarbeit
nicht ein ehrliches Handwerk war in dem strengen
Sinn, in welchem er sonst überall in seinem Wirken
diese Seite des Künstlerberufes aufgefaßt hat. Er muß
gefunden haben, daß ein willkürliches Ritzen, ein Druck
mit dem weichen und rasch verdorbenen Grate nicht
seinem künstlerischen Saubcrkeitsverlangen entsprach,
und mit erneuter Liebe ist er dann zu dem wirklichen
Kupferstich, der Grabstichelarbeit mit dcm festen und
konsequenten, den harten und dauerhaften Linien zu-
rückgegangen. Vielleicht hat man auch mit den wirt-
schaftlichcn Erwägungen des Meisters zu rechnen, daß
die Kaltnadclmethode nur wenige Abzüge zum Ver-
kauf ermöglichte.
Ganz ohne Spuren aber blieb der Ausflug nicht.
Nacli dem Jahre 1512 mit dem Hieronymus bei dem
Weidenbaum folgen die Jahre 1513 und 1514 mit den
Meisterstichen, Ritter, Tod und Teufel, Melancholie und
Hieronymus im Gehäuse. Wöllflin hat als für diese
Stichc bezeichnend ihre Farbigkeit, die koloristische
Haltung, hervorgehoben. Das will heißen: eine Dunkel-
heit bcdeutet jetzt mehr als nur einen Schatten, sie be-
zeichnet den Lichtwert einer Farbe (valeur). Er ent-
wickelt dieses weiter durch Beispiele und stellt das
prinzipiell Neue dcr Erscheinung fest. Es handelt sicli
um ein klares System, neben dem auch einzelne Ver-
suche aus Dürers malerischer Frühperiode nur als zu-
sammenhanglose Bemühungen erscheinen. Die male-
rischen Bestrebungen, die wir in den Zeichnungen,
Holzschnitten und Kaltnadelarbeiten beobaclitet haben,
sind in den Meisterstichen fortgesetzt worden. Und
wir rnüssen noch bemerken, daß die Versuche, die
Schranken der alten engen Raumdarstellung zu durch-
brechen, denen wir z. B. in den Zeichnungen, Lipp-
mann 433 und 143 begegneten, in dem Hieronymus-
stiche und in der Melancholie die neuen kompositionel-
len Lösungen hervorgebracht haben, die so wesentlich
für diese Blätter sind.
In dcm Jahre 1515 versuchte Dürer wieder einmal
eine ncue graphische Technik, die Eiseriradierung.
Nach den zuerst entstandenen Blättern zu urteilen hat
der Meister in dem neuen Verfahren die Möglichkeiten
zu malerischen Wirkungen ausnützen wollen. Die Öl-
bergszene, Bartsch 19, ist gefüllt mit unruhig flackern-