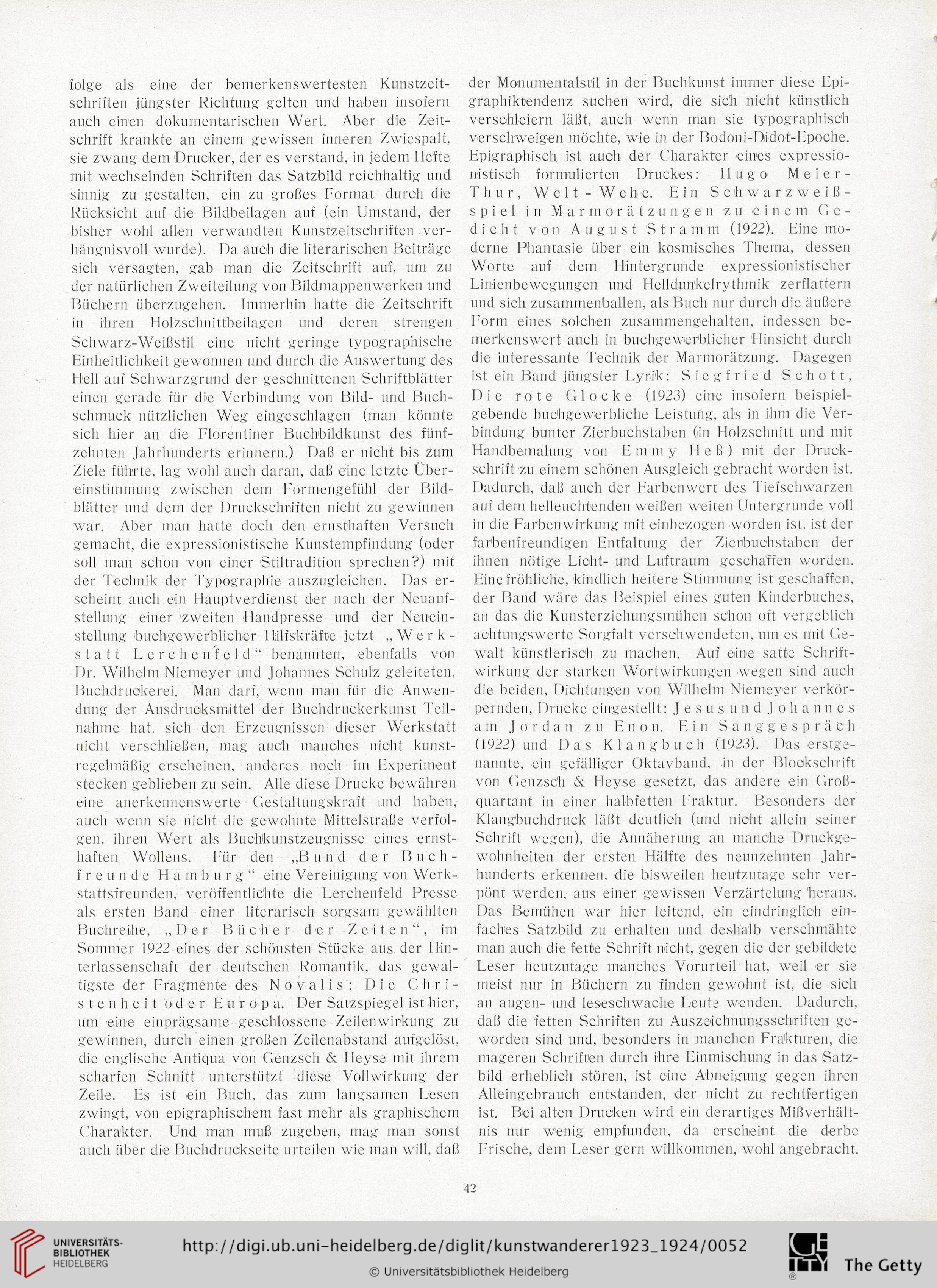folge als eine der bemerkenswertesten Kunstzeit-
schriften jüngster Richtung gelten und haben insofern
auch einen dokumentarischen Wert. Aber die Zeit-
schrift krankte an einem gewissen inneren Zwiespalt,
sie zwang dem Drucker, der es verstand, in jedem Hefte
mit wechselnden Schriften das Satzbild reichhaltig und
sinnig zu gestalten, ein zu großes Format durch die
Rücksicht auf die Bildbeilagen auf (ein Umstand, der
bisher wohl allen verwandten Kunstzeitschriften ver-
hängnisyoll wurde). Da auch die literarischen Beiträge
sich versagten, gab rnan die Zeitschrift auf, um zu
der natürlichen Zweiteilung von Bildmappenwerken und
Büchern überzugehen. Immerhin hatte die Zeitschrift
in ihren Holzschnittbeilagen und deren strengen
Schwarz-Weißstil eine nicht geringe typographische
Hinheitlichkeit gewonnen und durch die Auswertung des
I iell auf Schwarzgrund der geschnittenen Schriftblätter
einen gerade für die Verbindung von Bild- und Buch-
schmuck nützlichen Weg eingeschlagen (man könnte
sicli hier an die Florentiner BuchbildkunSt des fünf-
zehnten Jahrhunderts erinnern.) Daß er niclit bis zum
Ziele führte, lag wolil auch daran, daß eine letzte Über-
einstimmung zwischen dem Formengefühl der Bild-
blätter und dem der Druckschriften nicht zu gewinnen
war. Aber man hatte docli den ernsthaften Versuch
gemacht, die expressionistische Kunstempfindung (oder
soll man schon von einer Stiltradition sprechen?) mit
der Teehnik der Typographie auszugleichen. Das er-
scheint auch eiin Hauptverdienst der nach der Neuauf-
stellung einer zweiten Handpresse und der Neuein-
stellung buchgewerblicher 11 ilfskräfte jetzt „Werk-
statt Lerchenfeld“ benannten, ebenfalls von
Dr. Wilhelm Niemeyer und Johannes Schulz geleiteten,
Buchdruckerei. Man darf, wenn man für die Anwen-
dung der Ausdrucksmittel der Buchdruckerkunst Teil-
nahme hat, sich den Erzeugnissen dieser Werkstatt
nicht verschließen, mag auch manches nicht kunst-
regelmäßig erscheinen, anderes tioch im Experiment
stecken geblieben zu sein. Alle diese Drucke bewähren
eine anerkennenswerte Gestaltungskraft und haben,
auch wenn sie nicht dic gewohnte Mittelstraße verfol-
gen, iliren Wert als Buchkunstzeugnisse eines ernst-
haften Wollens. Für den „B n n d der Buch-
freu n d e Hämburg “ eine Vereinigung von Werk-
stattsfreunden, veröffentlichte die Lerchenfeld Presse
als ersten Band einer literarisch sorgsam gewählten
Buohreihe, „ D e r B ü c h e r d e r Z e i t e n “ , im
Sommer 1922 eines der schönsten Stticke aus der Hin-
terlassenschaft der deutschen Romantik, das gewal-
tigste der Fragmente des N o v a I i s : D i e C h r i -
s t e n h e i t o d e r E u r o p a. Der Satzspiiegel ist hier,
um eine einprägsame geschlossene Zeilenwirkung zu
gewinnen, durch einen großen Zeilenabstand aufgelöst,
die englische Antiqua von Genzsch & Heyse mit ihrem
scharfen Schnitt unterstützt diese Vollwirkung der
Zeile. Es ist ein Buch, das zum langsamen Lesen
zwingt, von epigraphischem fast mehr als graphischem
C-harakter. Und man muß zugeben, mag man sonst
auch über die Buchdruckseite urteilen wie man will, daß
der Monumentalstil in der Buchkunst immer diese Epi-
graphiktendenz suchen wird, die sic’h nicht künstlich
verschleiern läßt, auch wenn man sie typographisch
verschweigen möchte, wie in der Bodoni-Didot-Epoche.
Epigraphisch ist auch der Charakter eines expressio-
nistisch formulierten Druckes: Hugo Meier-
T h u r , Welt - Wehe. E i n S c h w a r z w e i ß -
s p i e 1 i n Marmorätzungen z u e i n e m C, e -
d i c h t v o n A u g u s t 'Stramm (1922). Eine mo-
derne Phantasie über ein kosmisches Thema, dessen
Worte auf dem Hintergrunde expressionistischer
Linienbewegungen und Helldunkelrythmik zerflattern
und sich zusammenballen, als Buch nur durch die äußere
Form eines solchen zusammengehalten, indessen be-
inerkcnswert auch in buchgewerblicher Hinsicht durch
die interessante Technik der Marmorätzung. Dagegen
ist ein Band jüngster Lyrik: S i e g f r i e d S c h o 11,
Die rote Glocke (1923) eine insofern beispiel-
gebende buchgewerbliche Leistung, ais in ihm die Ver-
bindung bunter Zierbuchstaben (in Holzschnitt und mit
Handbemalung von E m m y H e ß ) mit der Druok-
schrift 'zu einem schönen Ausgleich gebracht worden ist.
Dadurch, daß aucli der Farbenwert des Tiefschwarzen
auf dem liellcuchteiiden weißen weiten Untergrunde voll
in die Farbenwirkung mit einbezogen worden ist, ist der
farbenfreundigen Entfaltung der Zienbuchstaben der
ihnen nötige Licht- und Luftraum geschaffen worden.
Eine fröhliche, kindlich heitere Stimmung ist geschaffen,
der Band wäre das Beispiel eines guten Kinderbuches,
an das die Kunsterziehungsmühen sc’hon oft vergeblich
achtung'swerte Sorgfalt verschwendeten, um es mit Ge-
walt künstlerisch zu machen. Auf eine satte Schrift-
wirkung der starken Wortwirkungen wegen sind auch
die beiden, Dichtungen von Wilhelm Niemeyer verkör-
pernden, Drucke eingestellt: Jesusund Johannes
a m J o r d a n z u E n o n. E i n Sanggespräch
(1922) und Das Kiangbuch (1923). Das erstge-
nannte, ein gefälliger Oktavband, in der Blocksclvrift
von Genzsch & Heyse gesetzt, das andere ein Groß-
quartant in einer halbfettcn Fraktur. Bcsonders der
Klangbuchdruck läßt deutlich (und nicht allein seiner
Schrift wegen), die Annäherung an manche Druckge-
wohnheiten der ersten Hälfte des neunzehnten Jahr-
hunderts erkennen, die bisweilen heutzutage sehr ver-
pönt werden, aus einer gewissen Verzärtelung ’heraus.
Das Bemühen war hier leitend, ein eindringlich ein-
faches Satzbild zu erhalten und deshalb verschmähte
man auch die fette Schrift mioht, gegen die der gebildete
Leser heutzutage manches Vorurteil hat, weil er sie
meist nur in Büchern zu finden gewohnt ist, die sich
an augen- und leseschwache Leute wenden. Dadurch,
daß die fetten Schriften zu Auszaichnungsschriften ge-
worden sind und, besonders in manchen Frakturen, die
mageren Schriften durcli ihre Einmischung in das Satz-
bild erheblich stören, ist eiine Abneigung gegen ihren
Alleingebrauch entstanden, der nicht zu rechtfertigen
ist. Bei alten Drucken wird ein derartiges Mißverhält-
nis nur wenig empfunden, da erscheint die derbe
Frische, dem Leser gern willkommen, wohl angebracht.
42
schriften jüngster Richtung gelten und haben insofern
auch einen dokumentarischen Wert. Aber die Zeit-
schrift krankte an einem gewissen inneren Zwiespalt,
sie zwang dem Drucker, der es verstand, in jedem Hefte
mit wechselnden Schriften das Satzbild reichhaltig und
sinnig zu gestalten, ein zu großes Format durch die
Rücksicht auf die Bildbeilagen auf (ein Umstand, der
bisher wohl allen verwandten Kunstzeitschriften ver-
hängnisyoll wurde). Da auch die literarischen Beiträge
sich versagten, gab rnan die Zeitschrift auf, um zu
der natürlichen Zweiteilung von Bildmappenwerken und
Büchern überzugehen. Immerhin hatte die Zeitschrift
in ihren Holzschnittbeilagen und deren strengen
Schwarz-Weißstil eine nicht geringe typographische
Hinheitlichkeit gewonnen und durch die Auswertung des
I iell auf Schwarzgrund der geschnittenen Schriftblätter
einen gerade für die Verbindung von Bild- und Buch-
schmuck nützlichen Weg eingeschlagen (man könnte
sicli hier an die Florentiner BuchbildkunSt des fünf-
zehnten Jahrhunderts erinnern.) Daß er niclit bis zum
Ziele führte, lag wolil auch daran, daß eine letzte Über-
einstimmung zwischen dem Formengefühl der Bild-
blätter und dem der Druckschriften nicht zu gewinnen
war. Aber man hatte docli den ernsthaften Versuch
gemacht, die expressionistische Kunstempfindung (oder
soll man schon von einer Stiltradition sprechen?) mit
der Teehnik der Typographie auszugleichen. Das er-
scheint auch eiin Hauptverdienst der nach der Neuauf-
stellung einer zweiten Handpresse und der Neuein-
stellung buchgewerblicher 11 ilfskräfte jetzt „Werk-
statt Lerchenfeld“ benannten, ebenfalls von
Dr. Wilhelm Niemeyer und Johannes Schulz geleiteten,
Buchdruckerei. Man darf, wenn man für die Anwen-
dung der Ausdrucksmittel der Buchdruckerkunst Teil-
nahme hat, sich den Erzeugnissen dieser Werkstatt
nicht verschließen, mag auch manches nicht kunst-
regelmäßig erscheinen, anderes tioch im Experiment
stecken geblieben zu sein. Alle diese Drucke bewähren
eine anerkennenswerte Gestaltungskraft und haben,
auch wenn sie nicht dic gewohnte Mittelstraße verfol-
gen, iliren Wert als Buchkunstzeugnisse eines ernst-
haften Wollens. Für den „B n n d der Buch-
freu n d e Hämburg “ eine Vereinigung von Werk-
stattsfreunden, veröffentlichte die Lerchenfeld Presse
als ersten Band einer literarisch sorgsam gewählten
Buohreihe, „ D e r B ü c h e r d e r Z e i t e n “ , im
Sommer 1922 eines der schönsten Stticke aus der Hin-
terlassenschaft der deutschen Romantik, das gewal-
tigste der Fragmente des N o v a I i s : D i e C h r i -
s t e n h e i t o d e r E u r o p a. Der Satzspiiegel ist hier,
um eine einprägsame geschlossene Zeilenwirkung zu
gewinnen, durch einen großen Zeilenabstand aufgelöst,
die englische Antiqua von Genzsch & Heyse mit ihrem
scharfen Schnitt unterstützt diese Vollwirkung der
Zeile. Es ist ein Buch, das zum langsamen Lesen
zwingt, von epigraphischem fast mehr als graphischem
C-harakter. Und man muß zugeben, mag man sonst
auch über die Buchdruckseite urteilen wie man will, daß
der Monumentalstil in der Buchkunst immer diese Epi-
graphiktendenz suchen wird, die sic’h nicht künstlich
verschleiern läßt, auch wenn man sie typographisch
verschweigen möchte, wie in der Bodoni-Didot-Epoche.
Epigraphisch ist auch der Charakter eines expressio-
nistisch formulierten Druckes: Hugo Meier-
T h u r , Welt - Wehe. E i n S c h w a r z w e i ß -
s p i e 1 i n Marmorätzungen z u e i n e m C, e -
d i c h t v o n A u g u s t 'Stramm (1922). Eine mo-
derne Phantasie über ein kosmisches Thema, dessen
Worte auf dem Hintergrunde expressionistischer
Linienbewegungen und Helldunkelrythmik zerflattern
und sich zusammenballen, als Buch nur durch die äußere
Form eines solchen zusammengehalten, indessen be-
inerkcnswert auch in buchgewerblicher Hinsicht durch
die interessante Technik der Marmorätzung. Dagegen
ist ein Band jüngster Lyrik: S i e g f r i e d S c h o 11,
Die rote Glocke (1923) eine insofern beispiel-
gebende buchgewerbliche Leistung, ais in ihm die Ver-
bindung bunter Zierbuchstaben (in Holzschnitt und mit
Handbemalung von E m m y H e ß ) mit der Druok-
schrift 'zu einem schönen Ausgleich gebracht worden ist.
Dadurch, daß aucli der Farbenwert des Tiefschwarzen
auf dem liellcuchteiiden weißen weiten Untergrunde voll
in die Farbenwirkung mit einbezogen worden ist, ist der
farbenfreundigen Entfaltung der Zienbuchstaben der
ihnen nötige Licht- und Luftraum geschaffen worden.
Eine fröhliche, kindlich heitere Stimmung ist geschaffen,
der Band wäre das Beispiel eines guten Kinderbuches,
an das die Kunsterziehungsmühen sc’hon oft vergeblich
achtung'swerte Sorgfalt verschwendeten, um es mit Ge-
walt künstlerisch zu machen. Auf eine satte Schrift-
wirkung der starken Wortwirkungen wegen sind auch
die beiden, Dichtungen von Wilhelm Niemeyer verkör-
pernden, Drucke eingestellt: Jesusund Johannes
a m J o r d a n z u E n o n. E i n Sanggespräch
(1922) und Das Kiangbuch (1923). Das erstge-
nannte, ein gefälliger Oktavband, in der Blocksclvrift
von Genzsch & Heyse gesetzt, das andere ein Groß-
quartant in einer halbfettcn Fraktur. Bcsonders der
Klangbuchdruck läßt deutlich (und nicht allein seiner
Schrift wegen), die Annäherung an manche Druckge-
wohnheiten der ersten Hälfte des neunzehnten Jahr-
hunderts erkennen, die bisweilen heutzutage sehr ver-
pönt werden, aus einer gewissen Verzärtelung ’heraus.
Das Bemühen war hier leitend, ein eindringlich ein-
faches Satzbild zu erhalten und deshalb verschmähte
man auch die fette Schrift mioht, gegen die der gebildete
Leser heutzutage manches Vorurteil hat, weil er sie
meist nur in Büchern zu finden gewohnt ist, die sich
an augen- und leseschwache Leute wenden. Dadurch,
daß die fetten Schriften zu Auszaichnungsschriften ge-
worden sind und, besonders in manchen Frakturen, die
mageren Schriften durcli ihre Einmischung in das Satz-
bild erheblich stören, ist eiine Abneigung gegen ihren
Alleingebrauch entstanden, der nicht zu rechtfertigen
ist. Bei alten Drucken wird ein derartiges Mißverhält-
nis nur wenig empfunden, da erscheint die derbe
Frische, dem Leser gern willkommen, wohl angebracht.
42