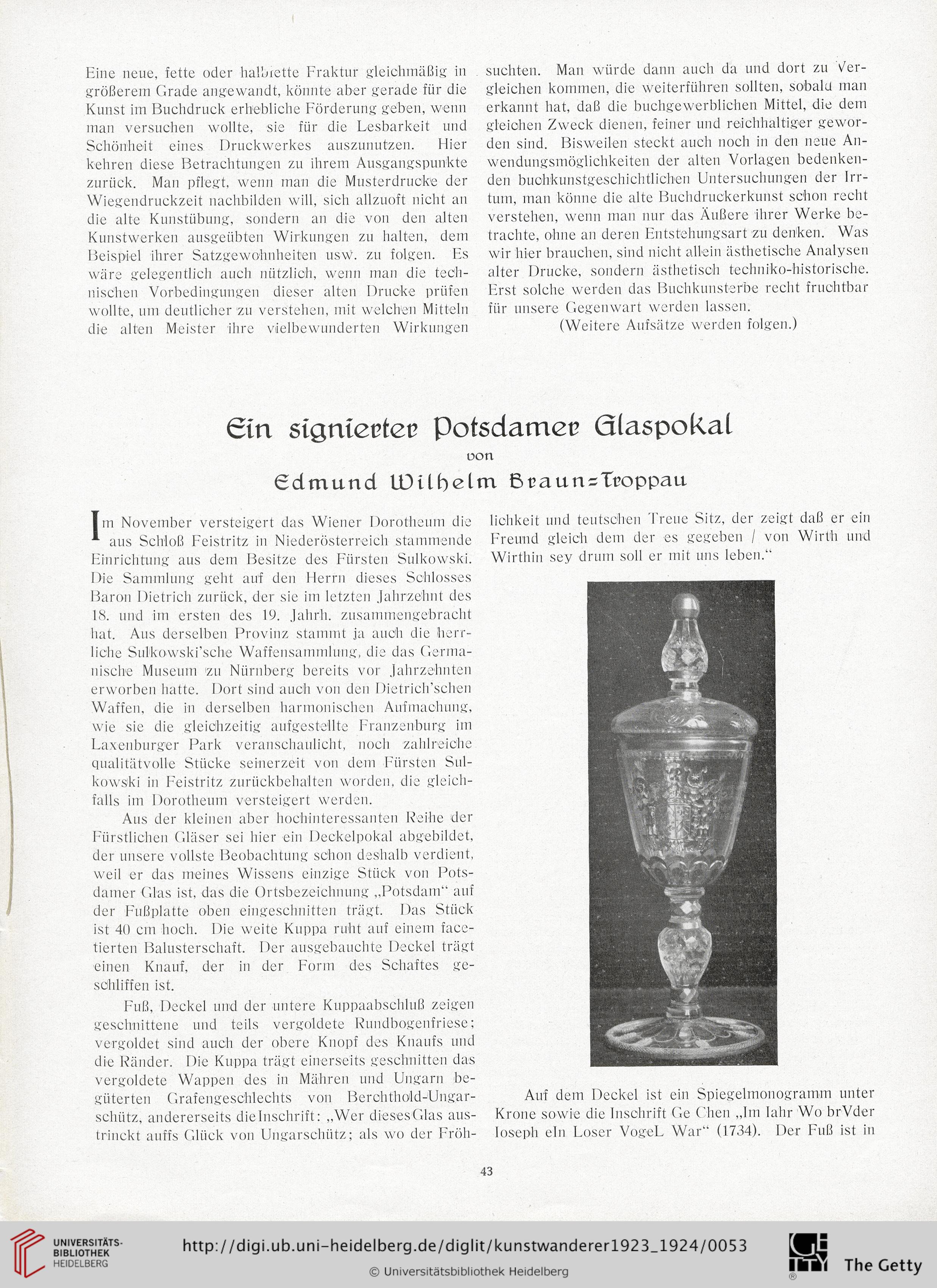Eine neue, fette oder halbiette Fraktur gleichmäßig in
größerem Grade angewandt, könnte aber gerade für die
Kunst im Buchdruck erhebliche Förderung ge'ben, wenn
man versuchen wollte, sie für die Lesbarkeit und
Schönhe-it eines Druckwerkes auszunutzen. Hier
kehren diese Betrachtungen zu ihrem Ausgangspunkte
zurück. Man pflegt, wenn man die Musterdrucke der
Wiegendruckzeit nachbilden will, sich allzuoft nicht an
die alte Kunstübung, sondern an die von den alten
Kunstwerken ausgeübten Wirkungen zu halten, dem
Beispiel ihrer Satzgewohnheiten usw. zu folgen. Es
wäre gelegentlich aucli nützlich, wenn man die tecii-
nischen Vorbedingungen dieser alten Drucke prüfen
wollte, um deutlicher zu verstehen, mit welchen Mitteln
die alten Meister ilire vielbewunderten Wirkungen
suchten. Man würde dann auch da und dort zu Ver-
gleichen kommen, die weiterführen sollten, sobalü man
erkannt hat, daß die buchgewerblichen Mittel, die dem
gleiohen Zweck dienen, feiner und reichhaltiger gewor-
den sind. Bisweilen steckt aucli noch in den neue An-
wendungsmöglichkeiten der alten Vorlagen bedenken-
den buohkunstgeschichtlichen Untersuchungen der lrr-
tum, man könne die alte Buchdruckerkunst schon recht
verstehen, wenn man nur das Äußere ihrer Werke be-
tracbte, ohne an deren Entstehungsart zu denken. Was
wir hier brauchen, sind nicht allein ästhetische Analysen
alter Drucke, sondern ästhetisoh techniko-historische.
Erst solche werden das Buchkunsterbe recht fruohtbar
fiir unsere Gegenwart werden lassen.
(Weitere Aufsätze werden folgen.)
Stn stQntet?tcv Potsdameü Qlaspokat
oon
Sdmund IDltbettn Bt?auncTt?oppau
|m November versteigert das Wiener Dorotheum die
aus Schloß Feistritz in Niederösterreich stammende
Einrichtung aus dem Besitze des Fürsten Sulkowski.
Die Sammlung geht auf den Herrn dieses Schlosses
Baron Dietrich zurück, der sie im letzten Jahrzehnt des
18. und iin ersten des 19. Jahrh. zusammengebracht
hat. Aus derselben Provinz stammt ja auch die herr-
liche Sulkowski’sche Waffensammlung, die das Germa-
nische Museum 'zu Nürnberg bereits vor Jahrzehnten
erworben liatte. Dort sind auch von den Dietrich’schen
Waffen, die in derselben harmonischen Aufmaohung,
wie sie die gleichzeitig aufgestellte Franzenburg im
Laxenburger Park veranschaulicht, noch zahlreiche
qualitatvolle Stücke seinerzeit von dem Fürsten Sul-
kowski in Feistritz zurückbehalten worden, die gleich-
falls im Dorotheum versteigert werden.
Aus der kleinen aber hochinteressanten Reihe der
Fürstlichen Gläs.er sei hier ein Deckelpokal abgebildet,
der unsere vollste Beobachtüng sc'hon deshalb verdient,
weil er das meines Wissens einzige Stück von Pots-
damer Glas ist, das die Ortsbezeichnung „Potsdam“ auf
der Fußplatte oben eingeschnitten trägt. Das Stiick
ist 40 cm hoch. Die weite Kuppa ruht auf einem face-
tierten Balusterschaft. Der ausgebauchte Deckel trägt
einen Knauf, der in der Form des Schaftes ge-
schliffen ist.
Fuß, Deckel und der untere Kuppaabschluß zeigen
geschnittene und teils vergoldete Rundbogenfriese;
vergoldet sind auch der obere Knopf des Knaufs und
die Ränder. Die Kuppa trägt einerseits geschnitten das
vergoldete Wappen des in Mähren und Ungarn be-
güterten Grafengeschlechts von Berchthold-Ungar-
schütz, andererseits dielnschrift: „Wer diesesGlas aus-
trinckt auffs Glück von Ungarschütz; als wo der Fröh-
lichkeit und teutschen Treue Sitz, der zeigt daß er ein
Freund gleich dem der es gegeben / von Wirth und
Wirthin sey drum soll er mit uns leben.“
Auf dem Deckel ist ein Spiegelmonogramm unter
Krone sowie die Inschrift Ge Chen „Im Iahr Wo brVder
Ioseph eln Loser VogeL War“ (1734). Der Fuß ist in
43
größerem Grade angewandt, könnte aber gerade für die
Kunst im Buchdruck erhebliche Förderung ge'ben, wenn
man versuchen wollte, sie für die Lesbarkeit und
Schönhe-it eines Druckwerkes auszunutzen. Hier
kehren diese Betrachtungen zu ihrem Ausgangspunkte
zurück. Man pflegt, wenn man die Musterdrucke der
Wiegendruckzeit nachbilden will, sich allzuoft nicht an
die alte Kunstübung, sondern an die von den alten
Kunstwerken ausgeübten Wirkungen zu halten, dem
Beispiel ihrer Satzgewohnheiten usw. zu folgen. Es
wäre gelegentlich aucli nützlich, wenn man die tecii-
nischen Vorbedingungen dieser alten Drucke prüfen
wollte, um deutlicher zu verstehen, mit welchen Mitteln
die alten Meister ilire vielbewunderten Wirkungen
suchten. Man würde dann auch da und dort zu Ver-
gleichen kommen, die weiterführen sollten, sobalü man
erkannt hat, daß die buchgewerblichen Mittel, die dem
gleiohen Zweck dienen, feiner und reichhaltiger gewor-
den sind. Bisweilen steckt aucli noch in den neue An-
wendungsmöglichkeiten der alten Vorlagen bedenken-
den buohkunstgeschichtlichen Untersuchungen der lrr-
tum, man könne die alte Buchdruckerkunst schon recht
verstehen, wenn man nur das Äußere ihrer Werke be-
tracbte, ohne an deren Entstehungsart zu denken. Was
wir hier brauchen, sind nicht allein ästhetische Analysen
alter Drucke, sondern ästhetisoh techniko-historische.
Erst solche werden das Buchkunsterbe recht fruohtbar
fiir unsere Gegenwart werden lassen.
(Weitere Aufsätze werden folgen.)
Stn stQntet?tcv Potsdameü Qlaspokat
oon
Sdmund IDltbettn Bt?auncTt?oppau
|m November versteigert das Wiener Dorotheum die
aus Schloß Feistritz in Niederösterreich stammende
Einrichtung aus dem Besitze des Fürsten Sulkowski.
Die Sammlung geht auf den Herrn dieses Schlosses
Baron Dietrich zurück, der sie im letzten Jahrzehnt des
18. und iin ersten des 19. Jahrh. zusammengebracht
hat. Aus derselben Provinz stammt ja auch die herr-
liche Sulkowski’sche Waffensammlung, die das Germa-
nische Museum 'zu Nürnberg bereits vor Jahrzehnten
erworben liatte. Dort sind auch von den Dietrich’schen
Waffen, die in derselben harmonischen Aufmaohung,
wie sie die gleichzeitig aufgestellte Franzenburg im
Laxenburger Park veranschaulicht, noch zahlreiche
qualitatvolle Stücke seinerzeit von dem Fürsten Sul-
kowski in Feistritz zurückbehalten worden, die gleich-
falls im Dorotheum versteigert werden.
Aus der kleinen aber hochinteressanten Reihe der
Fürstlichen Gläs.er sei hier ein Deckelpokal abgebildet,
der unsere vollste Beobachtüng sc'hon deshalb verdient,
weil er das meines Wissens einzige Stück von Pots-
damer Glas ist, das die Ortsbezeichnung „Potsdam“ auf
der Fußplatte oben eingeschnitten trägt. Das Stiick
ist 40 cm hoch. Die weite Kuppa ruht auf einem face-
tierten Balusterschaft. Der ausgebauchte Deckel trägt
einen Knauf, der in der Form des Schaftes ge-
schliffen ist.
Fuß, Deckel und der untere Kuppaabschluß zeigen
geschnittene und teils vergoldete Rundbogenfriese;
vergoldet sind auch der obere Knopf des Knaufs und
die Ränder. Die Kuppa trägt einerseits geschnitten das
vergoldete Wappen des in Mähren und Ungarn be-
güterten Grafengeschlechts von Berchthold-Ungar-
schütz, andererseits dielnschrift: „Wer diesesGlas aus-
trinckt auffs Glück von Ungarschütz; als wo der Fröh-
lichkeit und teutschen Treue Sitz, der zeigt daß er ein
Freund gleich dem der es gegeben / von Wirth und
Wirthin sey drum soll er mit uns leben.“
Auf dem Deckel ist ein Spiegelmonogramm unter
Krone sowie die Inschrift Ge Chen „Im Iahr Wo brVder
Ioseph eln Loser VogeL War“ (1734). Der Fuß ist in
43