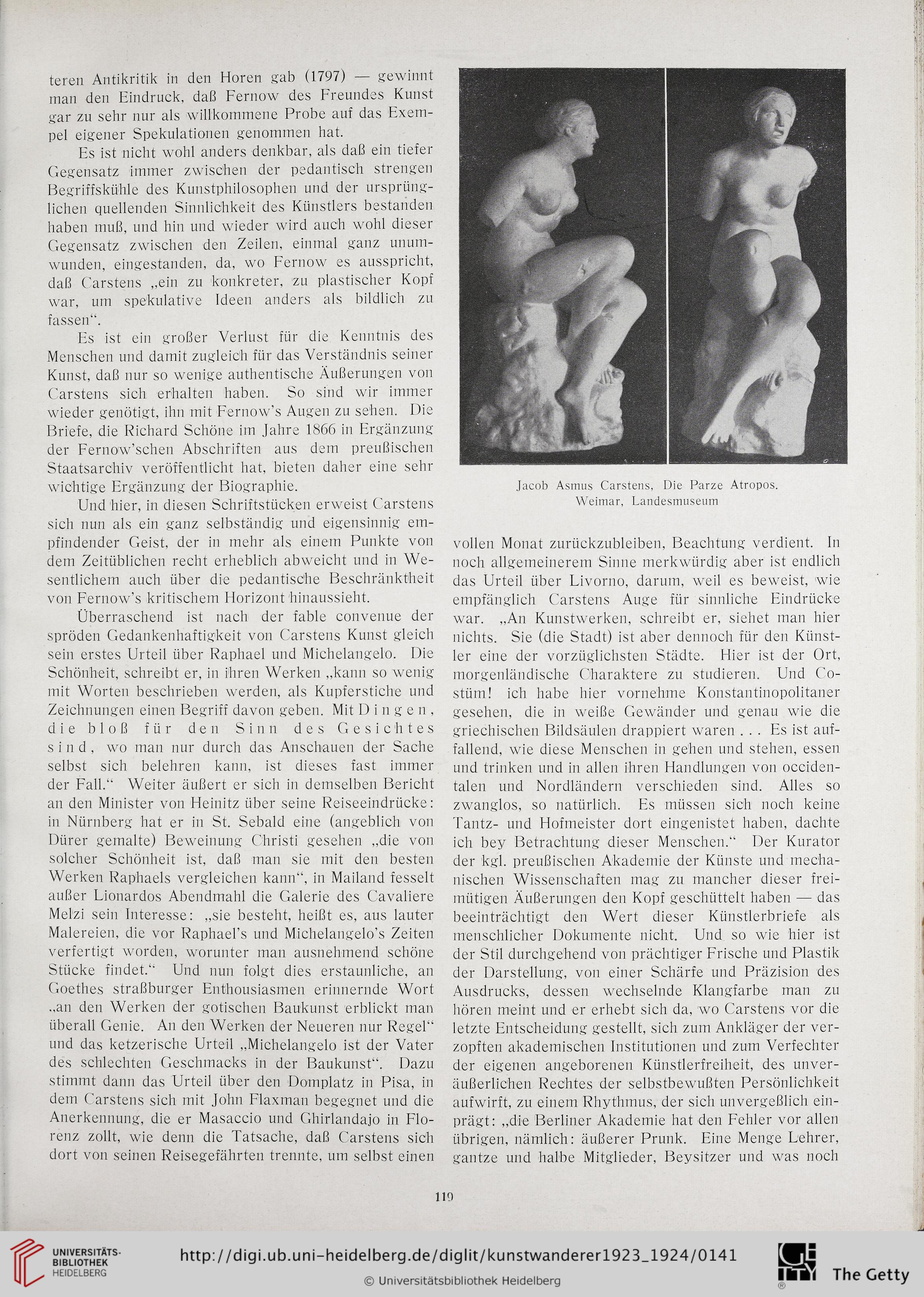teren Antikritik in den Horen gab (1797) — gewinnt
man den Eindruck, daß Fernow des Freundes Kunst
gar zu sehr nur als willkommene Probe auf das Exem-
pel eigener Spekulationen genommen hat.
Es ist nicht wohl anders denkbar, als daß ein tiefer
Gegensatz immer zwischen der pedantisch strengen
Begriffskühle des Kunstphilosophen und der ursprüng-
lichen quellenden Sinnlichkeit des Kiinstlers bestanden
haben muß, und hin und wieder wird auch wohl dieser
Gegensatz zwischen den Zeilen, eintnal ganz unum-
wunden, eingestanden, da, wo Fernow es ausspricht,
daß Carstens „ein zu konkreter, zu plastischer Kopf
war, um spekulative Ideen anders als bildlich zu
fassen“.
Es ist ein großer Verlust für die Kenntnis des
Menschen und damit zugleich für das Verständnis seiner
Kunst, daß nur so wenige authentische Äußerungen von
Carstens sich erhalten haben. So sind wir immer
wieder genötigt, ihn mit Fernow’s Augen zu sehen. Die
Briefe, die Richard Schöne im Jahre 1866 iti Ergänzung
der Fernow’schen Abschriften aus dem preußischen
Staatsarchiv veröffentlicht hat, bieten daher eine sehr
wichtige Ergänzung der Biographie.
Und hier, in diesen Schriftstücken erweist Carstens
sich nun als ein ganz selbständig und eigensinnig ern-
pfindender Geist, der in mehr als einem Punkte von
dem Zeitüblichen recht erheblich abweicht und in We-
sentlichem auch über die pedantisc'he Beschränktheit
von Fernow’s kritischem Horizont hinaussieht.
Überraschend ist nach der fable convenue der
spröden Gedankenhaftigkeit von Carstens Kunst gleich
sein erstes Urteil über Raphael und Michelangelo. Die
Schönheit, schreibt er, in ihren Werken „kann so wenig
mit Worten beschrieben werden, als Kupferstiche und
Zeichnungen einen Begriff davon geben. Mit D i n g e n ,
aie bloß für den Sinn des Gesichtes
s i n d, wo man nur durch das Anschauen der Sache
selbst sich belehren kann, ist dieses fast immer
der Fall.“ Weiter äußert er sich in demselben Bericht
an den Minister von Heinitz über seine Reiseeindrücke:
in Nürnberg hat er in St. Sebald eine (angeblich von
Dürer gemalte) Beweinung Christi gesehen „die von
solcher Schönheit ist, daß man sie mit den besten
Werken Raphaels vergleichen kann“, in Mailand fesselt
außer Lionardos Abendmahl die Galerie des Cavaliere
Melzi sein Interesse: „sie besteht, heißt es, aus lauter
Malereien, die vor Raphael’s und Michelangelo’s Zeiten
verfertigt worden, worunter man ausnehmend schöne
Stücke findet.“ Und nun folgt dies erstaunliche, an
Goethes straßburger Enthousiasmen erinnernde Wort
.,an den Werken der gotischen Baukunst erblickt man
überall Genie. An den Werken der Neueren nur Regel“
und das ketzerische Urteil „Michelangelo ist der Vater
des schlechten Geschmacks in der Baukunst“. Dazu
stimmt dann das Urteil über den Domplatz in Pisa, in
dem Carstens sich mit John Flaxman begegnet und die
Anerkennung, die er Masaccio und Ghirlandajo in Flo-
renz zollt, wie denn die Tatsache, daß Carstens sich
dort von seinen Reisegefährten trennte, um selbst einen
Jacob Asmus Carstens, Die Parze Atropos.
Weimar, Landesmuseum
vollen Monat zurückzubleiben, Beachtung verdient. In
noch allgemeinerem Sinne merkwürdig aber ist endlich
das Urteil über Livorno, darum, weil es beweist, wie
empfänglich Carstens Auge für sinnliche Eindrücke
war. „An Kunstwerken, schreibt er, siehet man hier
nichts. Sie (die Stadt) ist aber dennoch für den Künst-
ler eine der vorzüglichsten Städte. Hier ist der Ort,
morgenländische Charaktere zu studieren. Und Co-
stüm! ich habe hier vornehme Konstantinopolitaner
gesehen, die in weiße Gewänder und genau wie die
griechischen Bildsäulen drappiert waren . . . Es ist auf-
fallend, wie diese Menschen in gehen und stehen, essen
und trinken und in allen ihren Handlungen von occiden-
talen und Nordländern verschieden sind. Alles so
zwanglos, so natürlich. Es müssen sich noch keine
Tantz- und Hofmeister dort eingenistet haben, dachte
ich bey Betrachtung dieser Menschen.“ Der Kurator
der kgl. preußischen Akademie der Künste und mecha-
nischen Wissenschaften mag zu mancher dieser frei-
mütigen Äußerungen den Kopf geschüttelt haben — das
beeinträchtigt den Wert dieser Künstlerbriefe als
menschlicher Dokumente nicht. Und so wie hier ist
der Stil durchgehend von prächtiger Frische und Plastik
der Darstellung, von einer Schärfe und Präzision des
Ausdrucks, dessen wechselnde Klangfarbe man zu
hören meint und er erhebt sich da, wo Carstens vor die
letzte Entscheidung gestellt, sich zum Ankläger der ver-
zopften akademischen Institutionen und zum Verfechter
der eigenen angeborenen Künstlerfreiheit, des unver-
äußerlichen Rechtes der selbstbewußten Persönlichkeit
aufwirft, zu einem Rhythmus, der sich unvergeßlich ein-
prägt: „die Berliner Akademie hat den Fehler vor allen
übrigen, nämlich: äußerer Prunk. Eine Menge Lehrer,
gantze und halbe Mitglieder, Beysitzer und was noch
119
man den Eindruck, daß Fernow des Freundes Kunst
gar zu sehr nur als willkommene Probe auf das Exem-
pel eigener Spekulationen genommen hat.
Es ist nicht wohl anders denkbar, als daß ein tiefer
Gegensatz immer zwischen der pedantisch strengen
Begriffskühle des Kunstphilosophen und der ursprüng-
lichen quellenden Sinnlichkeit des Kiinstlers bestanden
haben muß, und hin und wieder wird auch wohl dieser
Gegensatz zwischen den Zeilen, eintnal ganz unum-
wunden, eingestanden, da, wo Fernow es ausspricht,
daß Carstens „ein zu konkreter, zu plastischer Kopf
war, um spekulative Ideen anders als bildlich zu
fassen“.
Es ist ein großer Verlust für die Kenntnis des
Menschen und damit zugleich für das Verständnis seiner
Kunst, daß nur so wenige authentische Äußerungen von
Carstens sich erhalten haben. So sind wir immer
wieder genötigt, ihn mit Fernow’s Augen zu sehen. Die
Briefe, die Richard Schöne im Jahre 1866 iti Ergänzung
der Fernow’schen Abschriften aus dem preußischen
Staatsarchiv veröffentlicht hat, bieten daher eine sehr
wichtige Ergänzung der Biographie.
Und hier, in diesen Schriftstücken erweist Carstens
sich nun als ein ganz selbständig und eigensinnig ern-
pfindender Geist, der in mehr als einem Punkte von
dem Zeitüblichen recht erheblich abweicht und in We-
sentlichem auch über die pedantisc'he Beschränktheit
von Fernow’s kritischem Horizont hinaussieht.
Überraschend ist nach der fable convenue der
spröden Gedankenhaftigkeit von Carstens Kunst gleich
sein erstes Urteil über Raphael und Michelangelo. Die
Schönheit, schreibt er, in ihren Werken „kann so wenig
mit Worten beschrieben werden, als Kupferstiche und
Zeichnungen einen Begriff davon geben. Mit D i n g e n ,
aie bloß für den Sinn des Gesichtes
s i n d, wo man nur durch das Anschauen der Sache
selbst sich belehren kann, ist dieses fast immer
der Fall.“ Weiter äußert er sich in demselben Bericht
an den Minister von Heinitz über seine Reiseeindrücke:
in Nürnberg hat er in St. Sebald eine (angeblich von
Dürer gemalte) Beweinung Christi gesehen „die von
solcher Schönheit ist, daß man sie mit den besten
Werken Raphaels vergleichen kann“, in Mailand fesselt
außer Lionardos Abendmahl die Galerie des Cavaliere
Melzi sein Interesse: „sie besteht, heißt es, aus lauter
Malereien, die vor Raphael’s und Michelangelo’s Zeiten
verfertigt worden, worunter man ausnehmend schöne
Stücke findet.“ Und nun folgt dies erstaunliche, an
Goethes straßburger Enthousiasmen erinnernde Wort
.,an den Werken der gotischen Baukunst erblickt man
überall Genie. An den Werken der Neueren nur Regel“
und das ketzerische Urteil „Michelangelo ist der Vater
des schlechten Geschmacks in der Baukunst“. Dazu
stimmt dann das Urteil über den Domplatz in Pisa, in
dem Carstens sich mit John Flaxman begegnet und die
Anerkennung, die er Masaccio und Ghirlandajo in Flo-
renz zollt, wie denn die Tatsache, daß Carstens sich
dort von seinen Reisegefährten trennte, um selbst einen
Jacob Asmus Carstens, Die Parze Atropos.
Weimar, Landesmuseum
vollen Monat zurückzubleiben, Beachtung verdient. In
noch allgemeinerem Sinne merkwürdig aber ist endlich
das Urteil über Livorno, darum, weil es beweist, wie
empfänglich Carstens Auge für sinnliche Eindrücke
war. „An Kunstwerken, schreibt er, siehet man hier
nichts. Sie (die Stadt) ist aber dennoch für den Künst-
ler eine der vorzüglichsten Städte. Hier ist der Ort,
morgenländische Charaktere zu studieren. Und Co-
stüm! ich habe hier vornehme Konstantinopolitaner
gesehen, die in weiße Gewänder und genau wie die
griechischen Bildsäulen drappiert waren . . . Es ist auf-
fallend, wie diese Menschen in gehen und stehen, essen
und trinken und in allen ihren Handlungen von occiden-
talen und Nordländern verschieden sind. Alles so
zwanglos, so natürlich. Es müssen sich noch keine
Tantz- und Hofmeister dort eingenistet haben, dachte
ich bey Betrachtung dieser Menschen.“ Der Kurator
der kgl. preußischen Akademie der Künste und mecha-
nischen Wissenschaften mag zu mancher dieser frei-
mütigen Äußerungen den Kopf geschüttelt haben — das
beeinträchtigt den Wert dieser Künstlerbriefe als
menschlicher Dokumente nicht. Und so wie hier ist
der Stil durchgehend von prächtiger Frische und Plastik
der Darstellung, von einer Schärfe und Präzision des
Ausdrucks, dessen wechselnde Klangfarbe man zu
hören meint und er erhebt sich da, wo Carstens vor die
letzte Entscheidung gestellt, sich zum Ankläger der ver-
zopften akademischen Institutionen und zum Verfechter
der eigenen angeborenen Künstlerfreiheit, des unver-
äußerlichen Rechtes der selbstbewußten Persönlichkeit
aufwirft, zu einem Rhythmus, der sich unvergeßlich ein-
prägt: „die Berliner Akademie hat den Fehler vor allen
übrigen, nämlich: äußerer Prunk. Eine Menge Lehrer,
gantze und halbe Mitglieder, Beysitzer und was noch
119