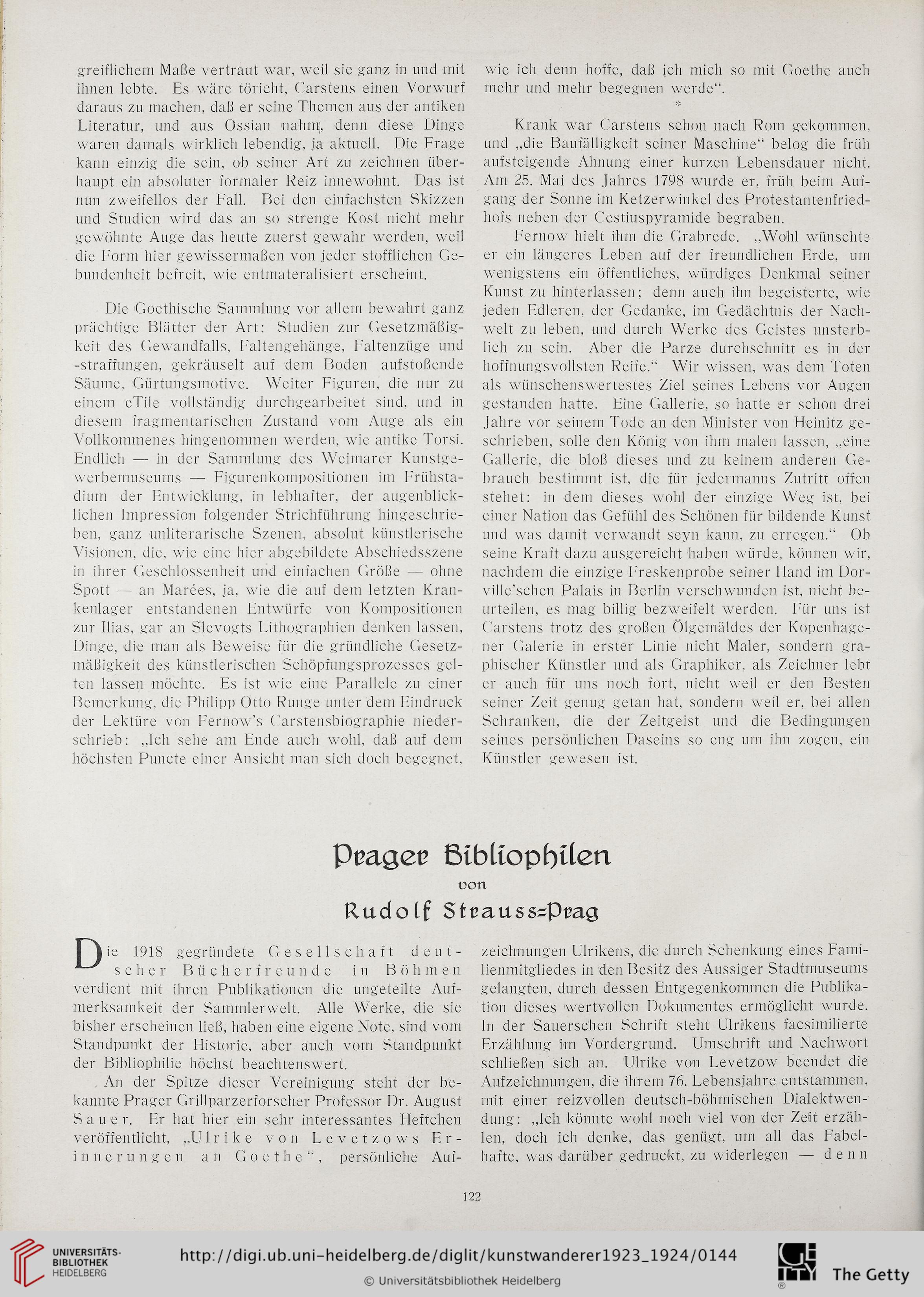greiflichem Maße vertraut war, weil sie ganz in und mit
ihnen lebte. Es wäre töricht, Carstens einen Yorwurf
daraus zu machen, daß er seine Themen aus der antiken
Literatur, und aus Ossian nahmj, denn diese Dinge
waren damals wirklich lebendig, ja aktuell. Die Frage
kann einzig die sein, ob seiner Art zu zeichnen über-
haupt ein absoluter formaler Reiz innewohnt. Das ist
nun zweifellos der Fall. Bei den einfachsten Skizzen
und Studien wird das an so strenge Kost nicht mehr
gewöhnte Auge das heute zuerst gewahr werden, weil
die Form hier gewissermaßen von jeder stofflichen Ge-
bundenheit befreit, wie entmateralisiert erscheint.
Die Goethische Sammlung vor allem bewahrt ganz
prächtige Blätter der Art: Studien zur Gesetzmäßig-
keit des Gewandfalls, Faltengehänge, Faltenzüge und
-straffungen, gekräuselt auf dem Boden aufstoßende
Säume, Gürtungsmotive. Weiter Figuren, die nur zu
einem eTile vollständig durchgearbeitet sind, und in
diesem fragmentarischen Zustand vom Auge als ein
Vollkommenes hingenommen werden, wie antike Torsi.
Endlich — in der Sammlung des Weimarer Kunstge-
werbemuseums — Figurenkompositionen im Frühsta-
dium der Entwicklung, in lebhafter, der augenblick-
lichen Impression folgender Strichführung hingeschrie-
ben, ganz unliterarische Szenen, absolut künstlerische
Yisionen, die, wie eine hier abgebildete Abschiedsszene
in ihrer Geschlossenheit und einfachen Größe — ohne
Spott — an Marees, ja, wie die auf dem letzten Kran-
kenlager entstandenen Entwürfe von Kompositionen
zur Ilias, gar an Slevogts Lithographien denken lassen,
Dinge, die man als Beweise für die gründliche Gesetz-
mäßigkeit des künstlerischen Schöpfungsprozesses gel-
ten lassen möchte. Es ist wie eine Parallele zu einer
Bemerkung, die Philipp Otto Runge unter dem Eindruck
der Lektüre von Fernow’s Carstensbiographie nieder-
schrieb: „Ich sehe am Ende auch wohl, daß auf dem
höchsten Puncte einer Ansicht man sich doch begegnet,
wie ich denn hoffe, daß ich mich so mit Goethe auch
mehr und mehr begegnen werde“.
Krank war Carstens schon nach Rom gekommen,
und ,,die Baufälligkeit seiner Maschine“ belog die früh
aufsteigende Ahnung einer kurzen Lebensdauer nicht.
Am 25. Mai des Jahres 1798 wurde er, früh beim Auf-
gang der Sonne im Ketzerwinkel des Protestantenfried-
hofs neben der Cestiuspyramide begraben.
Fernow hielt ihm die Grabrede. „Wohl wünschte
er ein längeres Leben auf der freundlichen Erde, uin
wenigstens ein öffentliches, würdiges Denkmal seiner
Kunst zu hinterlassen; denn auch ihn begeisterte, wie
jeden Edleren, der C.edanke, im Gedächtnis der Nach-
welt izu leben, und durch Werke des Geistes unsterb-
lich zu sein. Aber die Parze durchschnitt es in der
hoffnungsvollsten Reife.“ Wir wissen, was dem Toten
als wünschenswertestes Ziel seines Lebens vor Augen
gestanden hatte. Eine Gallerie, so hatte er schon drei
Jahre vor seinem Tode an den Minister von Heinitz ge-
schrieben, solle den König von ihm malen lassen, „eine
Gallerie, die bloß dieses und zu keinem anderen Ge-
brauch bestimmt ist, die für jedermanns Zutritt offen
stehet: in dem dieses wohl der einzige Weg ist, bei
einer Nation das Gefühl des Schönen für bildende Kunst
und was damit verwandt seyn kann, zu erregen.“ Ob
seine Kraft dazu ausgereicht haben würde, können wir,
nachdem die einzige Freskenprobe seiner Hand im Dor-
ville’schen Palais in Berlin verschwunden ist, nicht be-
urteilen, es mag billig bezweifelt werden. Für uns ist
Carstens trotz des großen Ölgemäldes der Kopenhage-
ner Galerie in erster Linie nicht Maler, sondern gra-
phischer Künstler und als Graphiker, als Zeichner lebt
er auch für uns noch fort, nicht weil er den Besten
seiner Zeit genug getan hat, sondern weil er, bei allen
Schranken, die der Zeitgeist und die Bedingungen
seines persönlichen Daseins so eng um ihn zogen, ein
Künstler gewesen ist.
Pvagev ßtbltopbtlen
oon
Rudotf StüausscPt?ag
| ie 1918 gegründete Gesellschaft deut-
scher Bücherfreunde in Böhmen
verdient mit ihren Publikationen die ungeteilte Auf-
merksamkeit der Sammlerwelt. Alle Werke, die sie
bisher erscheinen ließ, haben eine eigene Note, sind vom
Standpunkt der Historie, aber auch vom Standpunkt
der Bibliophilie höchst beachtenswert.
An der Spitze dieser Vereinigung steht der be-
kannte Prager Grillparzerforscher Professor Dr. August
S a u e r. Er hat hier ein sehr interessantes Heftchen
veröffentlicht, „Ulrike von Levetzows Er-
innerungen a n G o e t h e “ , persönliche Auf-
zeichnungeu Ulrikens, die durch Schenkung eines Fami-
lienmitgliedes in den Besitz des Aussiger Stadtmuseums
gelangten, durch dessen Entgegenkommen die Publika-
tion dieses wertvollen Dokumentes ermöglicht wurde.
In der Sauerschen Schrift steht Ulri'kens facsimilierte
Erzählung im Vordergrund. Umschrift und Nachwort
schließen sich an. Ulrike von Levetzow beendet die
Aufzeichnungen, die ihrem 76. Lebensjahre entstammen,
mit einer reizvollen deutsch-böhmischen Dialektwen-
dung: „Ich könnte wohl noch viel von der Zeit erzäh-
len, doch ich denke, das genügt, um all das Fabel-
hafte, was darüber gedruckt, zu widerlegen — denn
122
ihnen lebte. Es wäre töricht, Carstens einen Yorwurf
daraus zu machen, daß er seine Themen aus der antiken
Literatur, und aus Ossian nahmj, denn diese Dinge
waren damals wirklich lebendig, ja aktuell. Die Frage
kann einzig die sein, ob seiner Art zu zeichnen über-
haupt ein absoluter formaler Reiz innewohnt. Das ist
nun zweifellos der Fall. Bei den einfachsten Skizzen
und Studien wird das an so strenge Kost nicht mehr
gewöhnte Auge das heute zuerst gewahr werden, weil
die Form hier gewissermaßen von jeder stofflichen Ge-
bundenheit befreit, wie entmateralisiert erscheint.
Die Goethische Sammlung vor allem bewahrt ganz
prächtige Blätter der Art: Studien zur Gesetzmäßig-
keit des Gewandfalls, Faltengehänge, Faltenzüge und
-straffungen, gekräuselt auf dem Boden aufstoßende
Säume, Gürtungsmotive. Weiter Figuren, die nur zu
einem eTile vollständig durchgearbeitet sind, und in
diesem fragmentarischen Zustand vom Auge als ein
Vollkommenes hingenommen werden, wie antike Torsi.
Endlich — in der Sammlung des Weimarer Kunstge-
werbemuseums — Figurenkompositionen im Frühsta-
dium der Entwicklung, in lebhafter, der augenblick-
lichen Impression folgender Strichführung hingeschrie-
ben, ganz unliterarische Szenen, absolut künstlerische
Yisionen, die, wie eine hier abgebildete Abschiedsszene
in ihrer Geschlossenheit und einfachen Größe — ohne
Spott — an Marees, ja, wie die auf dem letzten Kran-
kenlager entstandenen Entwürfe von Kompositionen
zur Ilias, gar an Slevogts Lithographien denken lassen,
Dinge, die man als Beweise für die gründliche Gesetz-
mäßigkeit des künstlerischen Schöpfungsprozesses gel-
ten lassen möchte. Es ist wie eine Parallele zu einer
Bemerkung, die Philipp Otto Runge unter dem Eindruck
der Lektüre von Fernow’s Carstensbiographie nieder-
schrieb: „Ich sehe am Ende auch wohl, daß auf dem
höchsten Puncte einer Ansicht man sich doch begegnet,
wie ich denn hoffe, daß ich mich so mit Goethe auch
mehr und mehr begegnen werde“.
Krank war Carstens schon nach Rom gekommen,
und ,,die Baufälligkeit seiner Maschine“ belog die früh
aufsteigende Ahnung einer kurzen Lebensdauer nicht.
Am 25. Mai des Jahres 1798 wurde er, früh beim Auf-
gang der Sonne im Ketzerwinkel des Protestantenfried-
hofs neben der Cestiuspyramide begraben.
Fernow hielt ihm die Grabrede. „Wohl wünschte
er ein längeres Leben auf der freundlichen Erde, uin
wenigstens ein öffentliches, würdiges Denkmal seiner
Kunst zu hinterlassen; denn auch ihn begeisterte, wie
jeden Edleren, der C.edanke, im Gedächtnis der Nach-
welt izu leben, und durch Werke des Geistes unsterb-
lich zu sein. Aber die Parze durchschnitt es in der
hoffnungsvollsten Reife.“ Wir wissen, was dem Toten
als wünschenswertestes Ziel seines Lebens vor Augen
gestanden hatte. Eine Gallerie, so hatte er schon drei
Jahre vor seinem Tode an den Minister von Heinitz ge-
schrieben, solle den König von ihm malen lassen, „eine
Gallerie, die bloß dieses und zu keinem anderen Ge-
brauch bestimmt ist, die für jedermanns Zutritt offen
stehet: in dem dieses wohl der einzige Weg ist, bei
einer Nation das Gefühl des Schönen für bildende Kunst
und was damit verwandt seyn kann, zu erregen.“ Ob
seine Kraft dazu ausgereicht haben würde, können wir,
nachdem die einzige Freskenprobe seiner Hand im Dor-
ville’schen Palais in Berlin verschwunden ist, nicht be-
urteilen, es mag billig bezweifelt werden. Für uns ist
Carstens trotz des großen Ölgemäldes der Kopenhage-
ner Galerie in erster Linie nicht Maler, sondern gra-
phischer Künstler und als Graphiker, als Zeichner lebt
er auch für uns noch fort, nicht weil er den Besten
seiner Zeit genug getan hat, sondern weil er, bei allen
Schranken, die der Zeitgeist und die Bedingungen
seines persönlichen Daseins so eng um ihn zogen, ein
Künstler gewesen ist.
Pvagev ßtbltopbtlen
oon
Rudotf StüausscPt?ag
| ie 1918 gegründete Gesellschaft deut-
scher Bücherfreunde in Böhmen
verdient mit ihren Publikationen die ungeteilte Auf-
merksamkeit der Sammlerwelt. Alle Werke, die sie
bisher erscheinen ließ, haben eine eigene Note, sind vom
Standpunkt der Historie, aber auch vom Standpunkt
der Bibliophilie höchst beachtenswert.
An der Spitze dieser Vereinigung steht der be-
kannte Prager Grillparzerforscher Professor Dr. August
S a u e r. Er hat hier ein sehr interessantes Heftchen
veröffentlicht, „Ulrike von Levetzows Er-
innerungen a n G o e t h e “ , persönliche Auf-
zeichnungeu Ulrikens, die durch Schenkung eines Fami-
lienmitgliedes in den Besitz des Aussiger Stadtmuseums
gelangten, durch dessen Entgegenkommen die Publika-
tion dieses wertvollen Dokumentes ermöglicht wurde.
In der Sauerschen Schrift steht Ulri'kens facsimilierte
Erzählung im Vordergrund. Umschrift und Nachwort
schließen sich an. Ulrike von Levetzow beendet die
Aufzeichnungen, die ihrem 76. Lebensjahre entstammen,
mit einer reizvollen deutsch-böhmischen Dialektwen-
dung: „Ich könnte wohl noch viel von der Zeit erzäh-
len, doch ich denke, das genügt, um all das Fabel-
hafte, was darüber gedruckt, zu widerlegen — denn
122