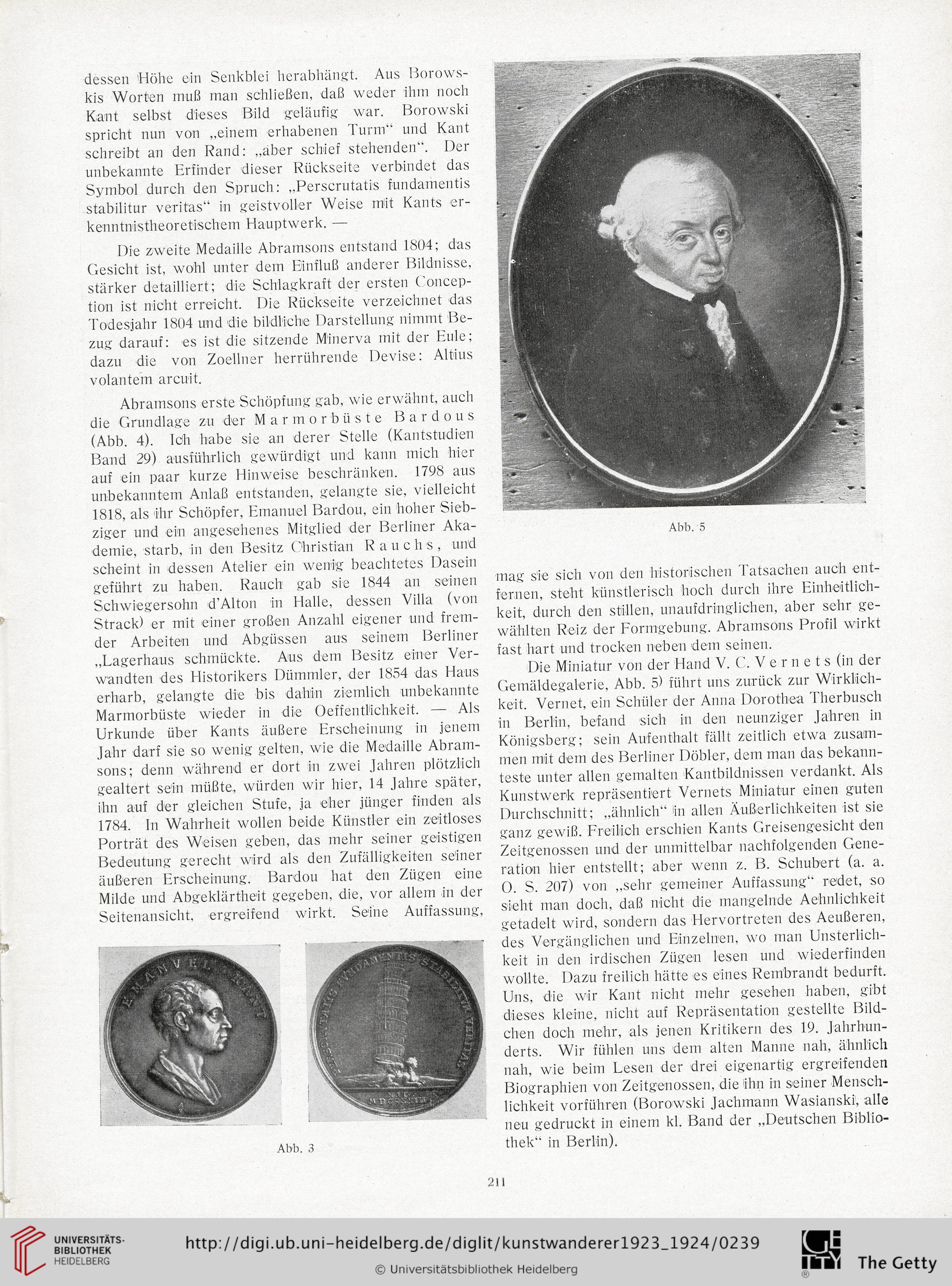dessen 'Höhe e<in Senkblei herabhängt. Aus Borows-
kis Worten muß rnan schließen, daß weder ihm noch
Kant selbst d'ieses Bild geläufig war. Borowski
spricht nun vou „einem erhabenen Turm“ und Kant
schreibt an den Rand: „äber schief stehenden“. Der
unbekannte Erfinder dieser Rückseite verbindet das
Symbol durch den Spruch: „Perscrutatis fundamentis
stabilitur veritas“ in geistvoller Weise mit Kants er-
kenntnistheoretischem Hauptwerk. —
Die zweite Medaille Abramsons entstand 1804; das
Gesicht ist, wohl unter detn Binfluß anderer Bildnisse,
stärker detailliert; die Schlagkraft der ersten C'oncep-
tion ist nicht erreicht. Die Rückseite verzeichnet das
Todesjahr 1804 und die bildliche Darstellung nimmt Be-
zug darauf: es ist die sitzende Minerva mit der Eule;
dazu die von Zoellner herrührende Devise: Altius
volantem arcuit.
Abramsons erste Schöpfung gab, wie erwähnt, auch
die Grundlage zu der Marmorbüste B a r d o u s
(Abb. 4). Idh habe sie an derer Stelle (Kantstudien
Band 29) ausführlich gewürdigt und kann mich hier
auf ein paar kurze Hinweise beschränken. 1798 aus
unbekanntem Anlaß entstanden, gelangte sie, vielleicht
1818, als ihr Schöpfer, Emanuel Bardou, ein hoher Sieb-
ziger und ein angesehenes Mitglied der Berliner Aka-
demie, starb, in deu Besitz Christian Rauchs, und
scheint in dessen Atelier ein wenig beachtetes Dasein
geführt zu haben. Rauch gab sie 1844 an seinen
Schwiegersohn d’Alton in Halle, dessen Villa (von
Strack) er mit einer großen Anzahl eigener und frem-
der Arbeiten und Abgüssen aus seinem Berliner
„Lagerhaus schmückte. Aus dem Besitz einer Ver-
wandten des Historikers Dümmler, der 1854 das Haus
erharb, gelangte die bis dahiin ziemlich unbekannte
Marmorbüste wieder in die Oeffentllchkeit. — Als
Urkunde über Kants äußere Ersoheinung in jenem
Jahr darf sie so wenig gelten, wie die Medaille Abram-
sons; denn während er dort in zwei Jahren plötzlich
gealtert se'in müßte, würden wir hier, 14 Jahre später,
ihn auf der gleichen Stufe, ja eher jünger finden als
1784. In Wahrheit wollen beide Künstler ein zeitloses
Porträt des Weisen geben, das mehr seiner geistigen
Bedeutung gerecht wird als den Zufälligkeiten seiner
äußeren Erscheinung. Bardou hat den Zügen eine
Milde und Abgeklärtheit gegeben, die, vor allem in der
Seitenansicht, ergreifend wirkt. Seine Auffassung,
Abb. 3
Abb. 5
mag sie sich von den histonischen Tatsachen auch ent-
fernen, steht künstlerisch hoch durcli ihre Einheitlich-
keit, durch den stillen, unaufdringlichen, aber sehr ge-
wählten Reiz der Formgebung. Abramsons Profil wirkt
fast hart und trocken neben dem seinen.
Die Miniatur von der Hand V. C. V e r n e t s (in der
Gemäldegalerie, Abb. 5) führt uns zurück zur Wirklüch-
keit. Vernet, ein Schüler der Anna Dorothea Therbusch
in Berl'in, befand sich in den neunziger Jahren in
Königsberg; sein Aufenthalt fällt zeitlich etwa zusam-
men mit dem des Berliner Döbler, dem man das bekann-
teste unter allen gemalten Kantbildnissen verdankt. Als
Kunstwerk repräsentiert Vernets Miniatur einen guten
Durchschnitt; „ähnlich“ in allen Äußierlichkeiten ist sie
ganz gewiß. Frellich erschien Kants Greisengesicht den
Zeitgenossen und der unmittelbar nachfolgenden Gene-
ration hier entstellt; aber wenn z. B. Schubert (a. a.
O. S. 207) von „sehr gemeiner Auffassung“ redet, so
sieht man doch, daß nicht die mangelnde Aehnlichkeit
getadelt wird, sondern das Hervortreten des Aeußeren,
des Vergänglichen und Einzelnen, wo man Unsterlich-
keit in den irdischen Zügen lesen und wiederfinden
wollte. Dazu freilich hätte es eines Rembrandt bedurft.
Uns, die wir Kant nicht mehr geseben haben, gibt
dieses kleine, nicht auf Repräsentation gestellte Bild-
chen doch mehr, als jenen Kritikern des 19. Jahrhun-
derts. Wir fühlen uns dem alten Manne nah, ähnlich
nah, wie beim Lesen der drei eigenartig ergreifenden
Biographien von Zeitgenossen, die ihn in seiner Mensch-
lichkeit vorführen (Borowski Jachmann Wasianski, alle
neu gedruckt in einem kl. Band der „Deutschen Biblio-
thek“ in Berlin).
211
kis Worten muß rnan schließen, daß weder ihm noch
Kant selbst d'ieses Bild geläufig war. Borowski
spricht nun vou „einem erhabenen Turm“ und Kant
schreibt an den Rand: „äber schief stehenden“. Der
unbekannte Erfinder dieser Rückseite verbindet das
Symbol durch den Spruch: „Perscrutatis fundamentis
stabilitur veritas“ in geistvoller Weise mit Kants er-
kenntnistheoretischem Hauptwerk. —
Die zweite Medaille Abramsons entstand 1804; das
Gesicht ist, wohl unter detn Binfluß anderer Bildnisse,
stärker detailliert; die Schlagkraft der ersten C'oncep-
tion ist nicht erreicht. Die Rückseite verzeichnet das
Todesjahr 1804 und die bildliche Darstellung nimmt Be-
zug darauf: es ist die sitzende Minerva mit der Eule;
dazu die von Zoellner herrührende Devise: Altius
volantem arcuit.
Abramsons erste Schöpfung gab, wie erwähnt, auch
die Grundlage zu der Marmorbüste B a r d o u s
(Abb. 4). Idh habe sie an derer Stelle (Kantstudien
Band 29) ausführlich gewürdigt und kann mich hier
auf ein paar kurze Hinweise beschränken. 1798 aus
unbekanntem Anlaß entstanden, gelangte sie, vielleicht
1818, als ihr Schöpfer, Emanuel Bardou, ein hoher Sieb-
ziger und ein angesehenes Mitglied der Berliner Aka-
demie, starb, in deu Besitz Christian Rauchs, und
scheint in dessen Atelier ein wenig beachtetes Dasein
geführt zu haben. Rauch gab sie 1844 an seinen
Schwiegersohn d’Alton in Halle, dessen Villa (von
Strack) er mit einer großen Anzahl eigener und frem-
der Arbeiten und Abgüssen aus seinem Berliner
„Lagerhaus schmückte. Aus dem Besitz einer Ver-
wandten des Historikers Dümmler, der 1854 das Haus
erharb, gelangte die bis dahiin ziemlich unbekannte
Marmorbüste wieder in die Oeffentllchkeit. — Als
Urkunde über Kants äußere Ersoheinung in jenem
Jahr darf sie so wenig gelten, wie die Medaille Abram-
sons; denn während er dort in zwei Jahren plötzlich
gealtert se'in müßte, würden wir hier, 14 Jahre später,
ihn auf der gleichen Stufe, ja eher jünger finden als
1784. In Wahrheit wollen beide Künstler ein zeitloses
Porträt des Weisen geben, das mehr seiner geistigen
Bedeutung gerecht wird als den Zufälligkeiten seiner
äußeren Erscheinung. Bardou hat den Zügen eine
Milde und Abgeklärtheit gegeben, die, vor allem in der
Seitenansicht, ergreifend wirkt. Seine Auffassung,
Abb. 3
Abb. 5
mag sie sich von den histonischen Tatsachen auch ent-
fernen, steht künstlerisch hoch durcli ihre Einheitlich-
keit, durch den stillen, unaufdringlichen, aber sehr ge-
wählten Reiz der Formgebung. Abramsons Profil wirkt
fast hart und trocken neben dem seinen.
Die Miniatur von der Hand V. C. V e r n e t s (in der
Gemäldegalerie, Abb. 5) führt uns zurück zur Wirklüch-
keit. Vernet, ein Schüler der Anna Dorothea Therbusch
in Berl'in, befand sich in den neunziger Jahren in
Königsberg; sein Aufenthalt fällt zeitlich etwa zusam-
men mit dem des Berliner Döbler, dem man das bekann-
teste unter allen gemalten Kantbildnissen verdankt. Als
Kunstwerk repräsentiert Vernets Miniatur einen guten
Durchschnitt; „ähnlich“ in allen Äußierlichkeiten ist sie
ganz gewiß. Frellich erschien Kants Greisengesicht den
Zeitgenossen und der unmittelbar nachfolgenden Gene-
ration hier entstellt; aber wenn z. B. Schubert (a. a.
O. S. 207) von „sehr gemeiner Auffassung“ redet, so
sieht man doch, daß nicht die mangelnde Aehnlichkeit
getadelt wird, sondern das Hervortreten des Aeußeren,
des Vergänglichen und Einzelnen, wo man Unsterlich-
keit in den irdischen Zügen lesen und wiederfinden
wollte. Dazu freilich hätte es eines Rembrandt bedurft.
Uns, die wir Kant nicht mehr geseben haben, gibt
dieses kleine, nicht auf Repräsentation gestellte Bild-
chen doch mehr, als jenen Kritikern des 19. Jahrhun-
derts. Wir fühlen uns dem alten Manne nah, ähnlich
nah, wie beim Lesen der drei eigenartig ergreifenden
Biographien von Zeitgenossen, die ihn in seiner Mensch-
lichkeit vorführen (Borowski Jachmann Wasianski, alle
neu gedruckt in einem kl. Band der „Deutschen Biblio-
thek“ in Berlin).
211